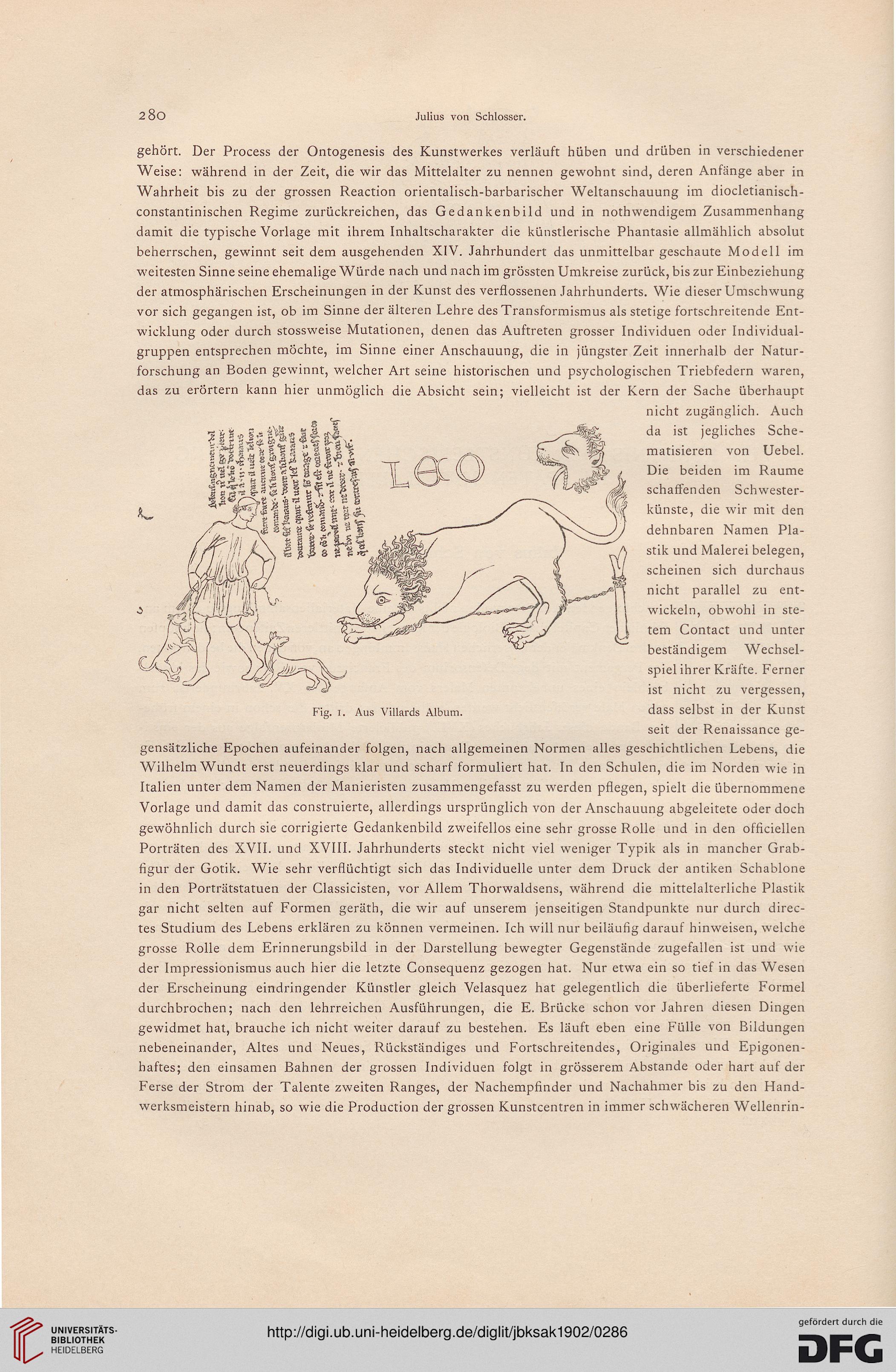2 8o Julius von Schlosser.
gehört. Der Process der Ontogenesis des Kunstwerkes verläuft hüben und drüben in verschiedener
Weise: während in der Zeit, die wir das Mittelalter zu nennen gewohnt sind, deren Anfänge aber in
Wahrheit bis zu der grossen Reaction orientalisch-barbarischer Weltanschauung im diocletianisch-
constantinischen Regime zurückreichen, das Gedankenbild und in nothwendigem Zusammenhang
damit die typische Vorlage mit ihrem Inhaltscharakter die künstlerische Phantasie allmählich absolut
beherrschen, gewinnt seit dem ausgehenden XIV. Jahrhundert das unmittelbar geschaute Modell im
weitesten Sinne seine ehemalige Würde nach und nach im grössten Umkreise zurück, bis zur Einbeziehung
der atmosphärischen Erscheinungen in der Kunst des verflossenen Jahrhunderts. Wie dieser Umschwung
vor sich gegangen ist, ob im Sinne der älteren Lehre des Transformismus als stetige fortschreitende Ent-
wicklung oder durch stossweise Mutationen, denen das Auftreten grosser Individuen oder Individual-
gruppen entsprechen möchte, im Sinne einer Anschauung, die in jüngster Zeit innerhalb der Natur-
forschung an Boden gewinnt, welcher Art seine historischen und psychologischen Triebfedern waren,
das zu erörtern kann hier unmöglich die Absicht sein; vielleicht ist der Kern der Sache überhaupt
nicht zugänglich. Auch
da ist jegliches Sche-
matisieren von Uebel.
Die beiden im Räume
schaffenden Schwester-
künste, die wir mit den
dehnbaren Namen Pla-
stik und Malerei belegen,
scheinen sich durchaus
nicht parallel zu ent-
wickeln, obwohl in ste-
tem Contact und unter
beständigem Wechsel-
spiel ihrer Kräfte. Ferner
ist nicht zu vergessen,
dass selbst in der Kunst
seit der Renaissance ge-
gensätzliche Epochen aufeinander folgen, nach allgemeinen Normen alles geschichtlichen Lebens, die
Wilhelm Wundt erst neuerdings klar und scharf formuliert hat. In den Schulen, die im Norden wie in
Italien unter dem Namen der Manieristen zusammengefasst zu werden pflegen, spielt die übernommene
Vorlage und damit das construierte, allerdings ursprünglich von der Anschauung abgeleitete oder doch
gewöhnlich durch sie corrigierte Gedankenbild zweifellos eine sehr grosse Rolle und in den officiellen
Porträten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts steckt nicht viel weniger Typik als in mancher Grab-
figur der Gotik. Wie sehr verflüchtigt sich das Individuelle unter dem Druck der antiken Schablone
in den Porträtstatuen der Classicisten, vor Allem Thorwaldsens, während die mittelalterliche Plastik
gar nicht selten auf Formen geräth, die wir auf unserem jenseitigen Standpunkte nur durch direc-
tes Studium des Lebens erklären zu können vermeinen. Ich will nur beiläufig darauf hinweisen, welche
grosse Rolle dem Erinnerungsbild in der Darstellung bewegter Gegenstände zugefallen ist und wie
der Impressionismus auch hier die letzte Consequenz gezogen hat. Nur etwa ein so tief in das Wesen
der Erscheinung eindringender Künstler gleich Velasquez hat gelegentlich die überlieferte Formel
durchbrochen; nach den lehrreichen Ausführungen, die E. Brücke schon vor Jahren diesen Dingen
gewidmet hat, brauche ich nicht weiter darauf zu bestehen. Es läuft eben eine Fülle von Bildungen
nebeneinander, Altes und Neues, Rückständiges und Fortschreitendes, Originales und Epigonen-
haftes; den einsamen Bahnen der grossen Individuen folgt in grösserem Abstände oder hart auf der
Ferse der Strom der Talente zweiten Ranges, der Nachempfinder und Nachahmer bis zu den Hand-
werksmeistern hinab, so wie die Production der grossen Kunstcentren in immer schwächeren Wellenrin-
gehört. Der Process der Ontogenesis des Kunstwerkes verläuft hüben und drüben in verschiedener
Weise: während in der Zeit, die wir das Mittelalter zu nennen gewohnt sind, deren Anfänge aber in
Wahrheit bis zu der grossen Reaction orientalisch-barbarischer Weltanschauung im diocletianisch-
constantinischen Regime zurückreichen, das Gedankenbild und in nothwendigem Zusammenhang
damit die typische Vorlage mit ihrem Inhaltscharakter die künstlerische Phantasie allmählich absolut
beherrschen, gewinnt seit dem ausgehenden XIV. Jahrhundert das unmittelbar geschaute Modell im
weitesten Sinne seine ehemalige Würde nach und nach im grössten Umkreise zurück, bis zur Einbeziehung
der atmosphärischen Erscheinungen in der Kunst des verflossenen Jahrhunderts. Wie dieser Umschwung
vor sich gegangen ist, ob im Sinne der älteren Lehre des Transformismus als stetige fortschreitende Ent-
wicklung oder durch stossweise Mutationen, denen das Auftreten grosser Individuen oder Individual-
gruppen entsprechen möchte, im Sinne einer Anschauung, die in jüngster Zeit innerhalb der Natur-
forschung an Boden gewinnt, welcher Art seine historischen und psychologischen Triebfedern waren,
das zu erörtern kann hier unmöglich die Absicht sein; vielleicht ist der Kern der Sache überhaupt
nicht zugänglich. Auch
da ist jegliches Sche-
matisieren von Uebel.
Die beiden im Räume
schaffenden Schwester-
künste, die wir mit den
dehnbaren Namen Pla-
stik und Malerei belegen,
scheinen sich durchaus
nicht parallel zu ent-
wickeln, obwohl in ste-
tem Contact und unter
beständigem Wechsel-
spiel ihrer Kräfte. Ferner
ist nicht zu vergessen,
dass selbst in der Kunst
seit der Renaissance ge-
gensätzliche Epochen aufeinander folgen, nach allgemeinen Normen alles geschichtlichen Lebens, die
Wilhelm Wundt erst neuerdings klar und scharf formuliert hat. In den Schulen, die im Norden wie in
Italien unter dem Namen der Manieristen zusammengefasst zu werden pflegen, spielt die übernommene
Vorlage und damit das construierte, allerdings ursprünglich von der Anschauung abgeleitete oder doch
gewöhnlich durch sie corrigierte Gedankenbild zweifellos eine sehr grosse Rolle und in den officiellen
Porträten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts steckt nicht viel weniger Typik als in mancher Grab-
figur der Gotik. Wie sehr verflüchtigt sich das Individuelle unter dem Druck der antiken Schablone
in den Porträtstatuen der Classicisten, vor Allem Thorwaldsens, während die mittelalterliche Plastik
gar nicht selten auf Formen geräth, die wir auf unserem jenseitigen Standpunkte nur durch direc-
tes Studium des Lebens erklären zu können vermeinen. Ich will nur beiläufig darauf hinweisen, welche
grosse Rolle dem Erinnerungsbild in der Darstellung bewegter Gegenstände zugefallen ist und wie
der Impressionismus auch hier die letzte Consequenz gezogen hat. Nur etwa ein so tief in das Wesen
der Erscheinung eindringender Künstler gleich Velasquez hat gelegentlich die überlieferte Formel
durchbrochen; nach den lehrreichen Ausführungen, die E. Brücke schon vor Jahren diesen Dingen
gewidmet hat, brauche ich nicht weiter darauf zu bestehen. Es läuft eben eine Fülle von Bildungen
nebeneinander, Altes und Neues, Rückständiges und Fortschreitendes, Originales und Epigonen-
haftes; den einsamen Bahnen der grossen Individuen folgt in grösserem Abstände oder hart auf der
Ferse der Strom der Talente zweiten Ranges, der Nachempfinder und Nachahmer bis zu den Hand-
werksmeistern hinab, so wie die Production der grossen Kunstcentren in immer schwächeren Wellenrin-