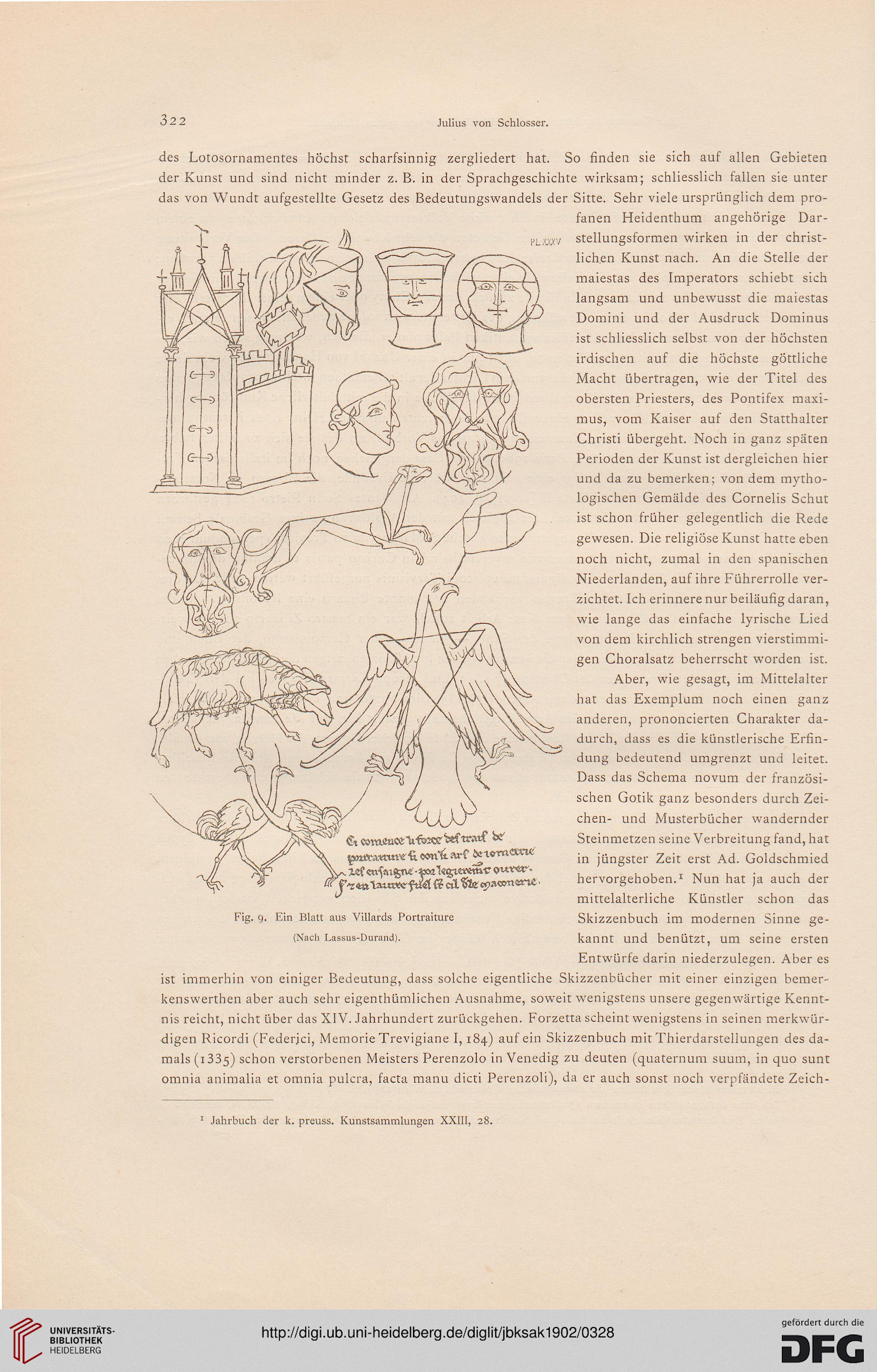2)22
Julius von Schlosser.
PL XXXV
des Lotosornamentes höchst scharfsinnig zergliedert hat. So finden sie sich auf allen Gebieten
der Kunst und sind nicht minder z. B. in der Sprachgeschichte wirksam; schliesslich fallen sie unter
das von Wundt aufgestellte Gesetz des Bedeutungswandels der Sitte. Sehr viele ursprunglich dem pro-
fanen Heidenthum angehörige Dar-
stellungsformen wirken in der christ-
lichen Kunst nach. An die Stelle der
maiestas des Imperators schiebt sich
langsam und unbewusst die maiestas
Domini und der Ausdruck Dominus
ist schliesslich selbst von der höchsten
irdischen auf die höchste göttliche
Macht übertragen, wie der Titel des
obersten Priesters, des Pontifex maxi-
mus, vom Kaiser auf den Statthalter
Christi übergeht. Noch in ganz späten
Perioden der Kunst ist dergleichen hier
und da zu bemerken; von dem mytho-
logischen Gemälde des Cornelis Schut
ist schon früher gelegentlich die Rede
gewesen. Die religiöse Kunst hatte eben
noch nicht, zumal in den spanischen
Niederlanden, auf ihre Führerrolle ver-
zichtet. Ich erinnere nur beiläufig daran,
wie lange das einfache lyrische Lied
von dem kirchlich strengen vierstimmi-
gen Choralsatz beherrscht worden ist.
Aber, wie gesagt, im Mittelalter
hat das Exemplum noch einen ganz
anderen, prononcierten Charakter da-
durch, dass es die künstlerische Erfin-
dung bedeutend umgrenzt und leitet.
Dass das Schema novum der französi-
schen Gotik ganz besonders durch Zei-
chen- und Musterbücher wandernder
Steinmetzen seine Verbreitung fand, hat
in jüngster Zeit erst Ad. Goldschmied
hervorgehoben.1 Nun hat ja auch der
mittelalterliche Künstler schon das
Skizzenbuch im modernen Sinne ge-
kannt und benützt, um seine ersten
Entwürfe darin niederzulegen. Aber es
ist immerhin von einiger Bedeutung, dass solche eigentliche Skizzenbücher mit einer einzigen bemer-
kenswerthen aber auch sehr eigenthümlichen Ausnahme, soweit wenigstens unsere gegenwärtige Kennt-
nis reicht, nicht über das XIV. Jahrhundert zurückgehen. Forzetta scheint wenigstens in seinen merkwür-
digen Ricordi (Federjci, Memorie Trevigiane I, 184) auf ein Skizzenbuch mit Thierdarstellungen des da-
mals (i335) schon verstorbenen Meisters Perenzolo in Venedig zu deuten (quaternum suum, in quo sunt
omnia animalia et omnia pulcra, facta manu dicti Perenzoli), da er auch sonst noch verpfändete Zeich-
et cwwace"U-fowrfef«wf &
Fig. 9.
Ein Blatt aus Villards Portraiture
(Nach Lassus-Durand).
1 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XXIII, 28.
Julius von Schlosser.
PL XXXV
des Lotosornamentes höchst scharfsinnig zergliedert hat. So finden sie sich auf allen Gebieten
der Kunst und sind nicht minder z. B. in der Sprachgeschichte wirksam; schliesslich fallen sie unter
das von Wundt aufgestellte Gesetz des Bedeutungswandels der Sitte. Sehr viele ursprunglich dem pro-
fanen Heidenthum angehörige Dar-
stellungsformen wirken in der christ-
lichen Kunst nach. An die Stelle der
maiestas des Imperators schiebt sich
langsam und unbewusst die maiestas
Domini und der Ausdruck Dominus
ist schliesslich selbst von der höchsten
irdischen auf die höchste göttliche
Macht übertragen, wie der Titel des
obersten Priesters, des Pontifex maxi-
mus, vom Kaiser auf den Statthalter
Christi übergeht. Noch in ganz späten
Perioden der Kunst ist dergleichen hier
und da zu bemerken; von dem mytho-
logischen Gemälde des Cornelis Schut
ist schon früher gelegentlich die Rede
gewesen. Die religiöse Kunst hatte eben
noch nicht, zumal in den spanischen
Niederlanden, auf ihre Führerrolle ver-
zichtet. Ich erinnere nur beiläufig daran,
wie lange das einfache lyrische Lied
von dem kirchlich strengen vierstimmi-
gen Choralsatz beherrscht worden ist.
Aber, wie gesagt, im Mittelalter
hat das Exemplum noch einen ganz
anderen, prononcierten Charakter da-
durch, dass es die künstlerische Erfin-
dung bedeutend umgrenzt und leitet.
Dass das Schema novum der französi-
schen Gotik ganz besonders durch Zei-
chen- und Musterbücher wandernder
Steinmetzen seine Verbreitung fand, hat
in jüngster Zeit erst Ad. Goldschmied
hervorgehoben.1 Nun hat ja auch der
mittelalterliche Künstler schon das
Skizzenbuch im modernen Sinne ge-
kannt und benützt, um seine ersten
Entwürfe darin niederzulegen. Aber es
ist immerhin von einiger Bedeutung, dass solche eigentliche Skizzenbücher mit einer einzigen bemer-
kenswerthen aber auch sehr eigenthümlichen Ausnahme, soweit wenigstens unsere gegenwärtige Kennt-
nis reicht, nicht über das XIV. Jahrhundert zurückgehen. Forzetta scheint wenigstens in seinen merkwür-
digen Ricordi (Federjci, Memorie Trevigiane I, 184) auf ein Skizzenbuch mit Thierdarstellungen des da-
mals (i335) schon verstorbenen Meisters Perenzolo in Venedig zu deuten (quaternum suum, in quo sunt
omnia animalia et omnia pulcra, facta manu dicti Perenzoli), da er auch sonst noch verpfändete Zeich-
et cwwace"U-fowrfef«wf &
Fig. 9.
Ein Blatt aus Villards Portraiture
(Nach Lassus-Durand).
1 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XXIII, 28.