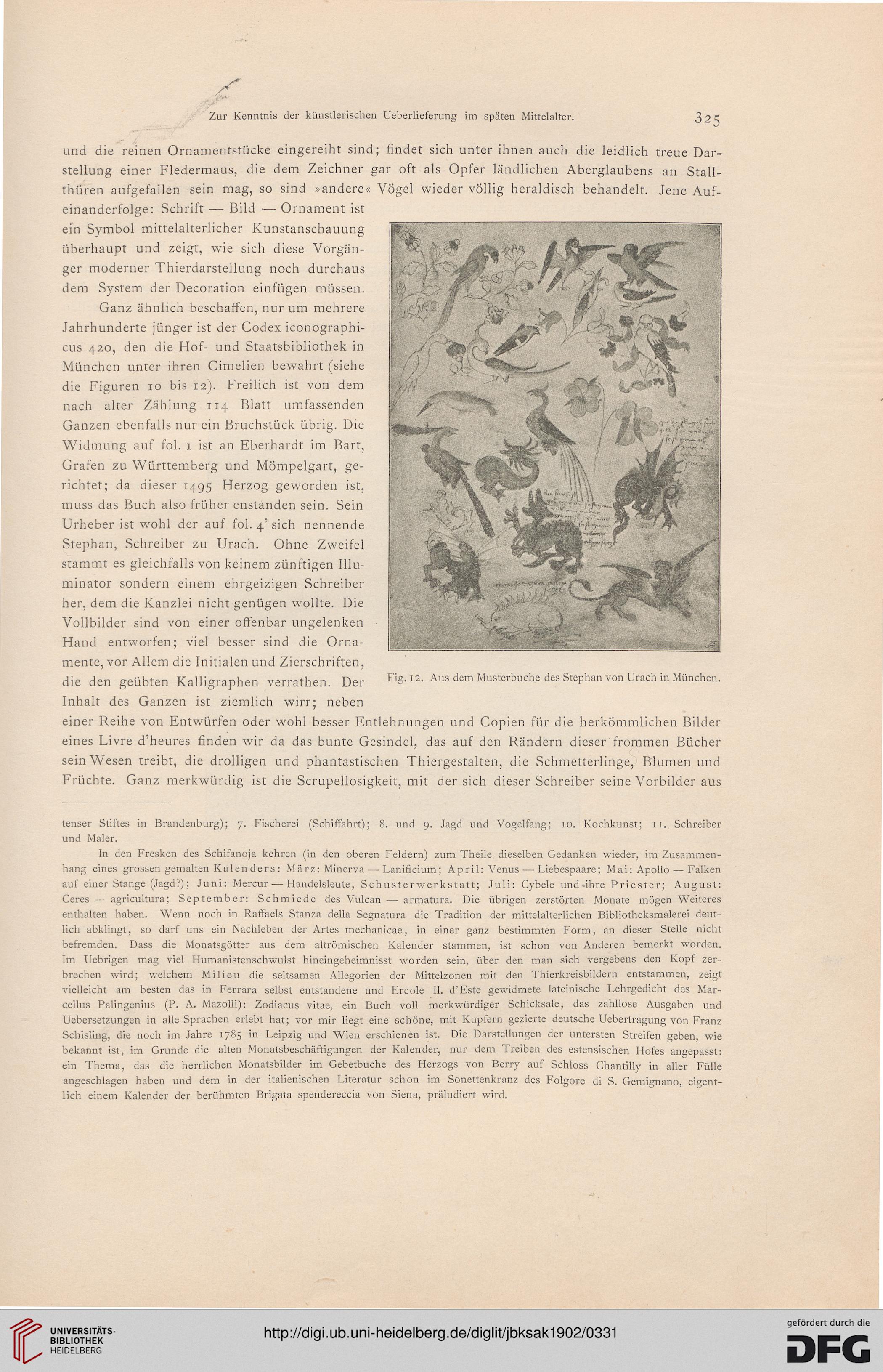Zur Kenntnis der künstlerischen Ueherlieferung im späten Mittelalter.
325
und die reinen Ornamentstücke eingereiht sind; findet sich unter ihnen auch die leidlich treue Dar-
stellung einer Fledermaus, die dem Zeichner gar oft als Opfer ländlichen Aberglaubens an Stall-
thüren aufgefallen sein mag, so sind »andere« Vögel wieder völlig heraldisch behandelt. Jene Auf-
einanderfolge: Schrift — Bild — Ornament ist
ein Symbol mittelalterlicher Kunstanschauung
überhaupt und zeigt, wie sich diese Vorgän-
ger moderner Thierdarstellung noch durchaus
dem System der Decoration einfügen müssen.
Ganz ähnlich beschaffen, nur um mehrere
Jahrhunderte jünger ist der Codex iconographi-
cus 420, den die Hof- und Staatsbibliothek in
München unter ihren Cimelien bewahrt (siehe
die Figuren 10 bis 12). Freilich ist von dem
nach alter Zählung 114 Blatt umfassenden
Ganzen ebenfalls nur ein Bruchstück übrig. Die
Widmung auf fol. 1 ist an Eberhardt im Bart,
Grafen zu Württemberg und Mömpelgart, ge-
richtet; da dieser 1495 Herzog geworden ist,
muss das Buch also früher enstanden sein. Sein
Urheber ist wohl der auf fol. 4' sich nennende
Stephan, Schreiber zu Urach. Ohne Zweifel
stammt es gleichfalls von keinem zünftigen Illu-
minator sondern einem ehrgeizigen Schreiber
her, dem die Kanzlei nicht genügen wollte. Die
Vollbilder sind von einer offenbar ungelenken
Hand entworfen; viel besser sind die Orna-
mente, vor Allem die Initialen und Zierschriften,
die den geübten Kalligraphen verrathen. Der
Inhalt des Ganzen ist ziemlich wirr; neben
einer Reihe von Entwürfen oder wohl besser Entlehnungen und Copien für die herkömmlichen Bilder
eines Livre d'heures finden wir da das bunte Gesindel, das auf den Rändern dieser frommen Bücher
sein Wesen treibt, die drolligen und phantastischen Thiergestalten, die Schmetterlinge, Blumen und
Früchte. Ganz merkwürdig ist die Scrupellosigkeit, mit der sich dieser Schreiber seine Vorbilder aus
""""IM
F ig. 12. Aus dem Musterbuche des Stephan von Urach in München.
tenser Stiftes in Brandenburg); 7. Fischerei (Schiffahrt); 8. und 9. Jagd und Vogelfang; 10. Kochkunst; Ii. Schreiber
und Maler.
In den Fresken des Schifanoja kehren (in den oberen Feldern) zum Theile dieselben Gedanken wieder, im Zusammen-
hang eines grossen gemalten Kaien ders : März: Minerva — Lanificium; April: Venus — Liebespaare; Mai: Apollo — Falken
auf einer Stange (Jagd?); Juni: Mercur — Handelsleute, Schusterwerkstatt; Juli: Cybele und-ihre Priester; August:
Ceres — agricultura; September: Schmiede des Vulcan — armatura. Die übrigen zerstörten Monate mögen Weiteres
enthalten haben. Wenn noch in Raffaels Stanza della Segnatura die Tradition der mittelalterlichen Bibliotheksmalerei deut-
lich abklingt, so darf uns ein Nachleben der Artes mechanicae, in einer ganz bestimmten Form, an dieser Stelle nicht
befremden. Dass die Monatsgötter aus dem altrömischen Kalender stammen, ist schon von Anderen bemerkt worden.
Im Uebrigen mag viel Humanistenschwulst hineingeheimnisst worden sein, über den man sich vergebens den Kopf zer-
brechen wird; welchem Milieu die seltsamen Allegorien der Mittelzonen mit den Thierkreisbildern entstammen, zeigt
vielleicht am besten das in Ferrara selbst entstandene und Ercole II. d'Este gewidmete lateinische Lehrgedicht des Mar-
cellus Palingenius (P. A. Mazolli): Zodiacus vitae, ein Buch voll merkwürdiger Schicksale, das zahllose Ausgaben und
Uebersetzungen in alle Sprachen erlebt hat; vor mir liegt eine schöne, mit Kupfern gezierte deutsche Uebertragung von Franz
Schisüng, die noch im Jahre 1785 in Leipzig und Wien erschienen ist. Die Darstellungen der untersten Streifen geben, wie
bekannt ist, im Grunde die alten Monatsbeschäftigungen der Kalender, nur dem Treiben des estensischen Hofes angepasst:
ein Thema, das die herrlichen Monatsbilder im Gebetbuche des Herzogs von Berry auf Schloss Chantilly in aller Fülle
angeschlagen haben und dem in der italienischen Literatur schon im Sonettenkranz des Folgore di S. Gemignano, eigent-
lich einem Kalender der berühmten Brigata spendereccia von Siena, präludiert wird.
325
und die reinen Ornamentstücke eingereiht sind; findet sich unter ihnen auch die leidlich treue Dar-
stellung einer Fledermaus, die dem Zeichner gar oft als Opfer ländlichen Aberglaubens an Stall-
thüren aufgefallen sein mag, so sind »andere« Vögel wieder völlig heraldisch behandelt. Jene Auf-
einanderfolge: Schrift — Bild — Ornament ist
ein Symbol mittelalterlicher Kunstanschauung
überhaupt und zeigt, wie sich diese Vorgän-
ger moderner Thierdarstellung noch durchaus
dem System der Decoration einfügen müssen.
Ganz ähnlich beschaffen, nur um mehrere
Jahrhunderte jünger ist der Codex iconographi-
cus 420, den die Hof- und Staatsbibliothek in
München unter ihren Cimelien bewahrt (siehe
die Figuren 10 bis 12). Freilich ist von dem
nach alter Zählung 114 Blatt umfassenden
Ganzen ebenfalls nur ein Bruchstück übrig. Die
Widmung auf fol. 1 ist an Eberhardt im Bart,
Grafen zu Württemberg und Mömpelgart, ge-
richtet; da dieser 1495 Herzog geworden ist,
muss das Buch also früher enstanden sein. Sein
Urheber ist wohl der auf fol. 4' sich nennende
Stephan, Schreiber zu Urach. Ohne Zweifel
stammt es gleichfalls von keinem zünftigen Illu-
minator sondern einem ehrgeizigen Schreiber
her, dem die Kanzlei nicht genügen wollte. Die
Vollbilder sind von einer offenbar ungelenken
Hand entworfen; viel besser sind die Orna-
mente, vor Allem die Initialen und Zierschriften,
die den geübten Kalligraphen verrathen. Der
Inhalt des Ganzen ist ziemlich wirr; neben
einer Reihe von Entwürfen oder wohl besser Entlehnungen und Copien für die herkömmlichen Bilder
eines Livre d'heures finden wir da das bunte Gesindel, das auf den Rändern dieser frommen Bücher
sein Wesen treibt, die drolligen und phantastischen Thiergestalten, die Schmetterlinge, Blumen und
Früchte. Ganz merkwürdig ist die Scrupellosigkeit, mit der sich dieser Schreiber seine Vorbilder aus
""""IM
F ig. 12. Aus dem Musterbuche des Stephan von Urach in München.
tenser Stiftes in Brandenburg); 7. Fischerei (Schiffahrt); 8. und 9. Jagd und Vogelfang; 10. Kochkunst; Ii. Schreiber
und Maler.
In den Fresken des Schifanoja kehren (in den oberen Feldern) zum Theile dieselben Gedanken wieder, im Zusammen-
hang eines grossen gemalten Kaien ders : März: Minerva — Lanificium; April: Venus — Liebespaare; Mai: Apollo — Falken
auf einer Stange (Jagd?); Juni: Mercur — Handelsleute, Schusterwerkstatt; Juli: Cybele und-ihre Priester; August:
Ceres — agricultura; September: Schmiede des Vulcan — armatura. Die übrigen zerstörten Monate mögen Weiteres
enthalten haben. Wenn noch in Raffaels Stanza della Segnatura die Tradition der mittelalterlichen Bibliotheksmalerei deut-
lich abklingt, so darf uns ein Nachleben der Artes mechanicae, in einer ganz bestimmten Form, an dieser Stelle nicht
befremden. Dass die Monatsgötter aus dem altrömischen Kalender stammen, ist schon von Anderen bemerkt worden.
Im Uebrigen mag viel Humanistenschwulst hineingeheimnisst worden sein, über den man sich vergebens den Kopf zer-
brechen wird; welchem Milieu die seltsamen Allegorien der Mittelzonen mit den Thierkreisbildern entstammen, zeigt
vielleicht am besten das in Ferrara selbst entstandene und Ercole II. d'Este gewidmete lateinische Lehrgedicht des Mar-
cellus Palingenius (P. A. Mazolli): Zodiacus vitae, ein Buch voll merkwürdiger Schicksale, das zahllose Ausgaben und
Uebersetzungen in alle Sprachen erlebt hat; vor mir liegt eine schöne, mit Kupfern gezierte deutsche Uebertragung von Franz
Schisüng, die noch im Jahre 1785 in Leipzig und Wien erschienen ist. Die Darstellungen der untersten Streifen geben, wie
bekannt ist, im Grunde die alten Monatsbeschäftigungen der Kalender, nur dem Treiben des estensischen Hofes angepasst:
ein Thema, das die herrlichen Monatsbilder im Gebetbuche des Herzogs von Berry auf Schloss Chantilly in aller Fülle
angeschlagen haben und dem in der italienischen Literatur schon im Sonettenkranz des Folgore di S. Gemignano, eigent-
lich einem Kalender der berühmten Brigata spendereccia von Siena, präludiert wird.