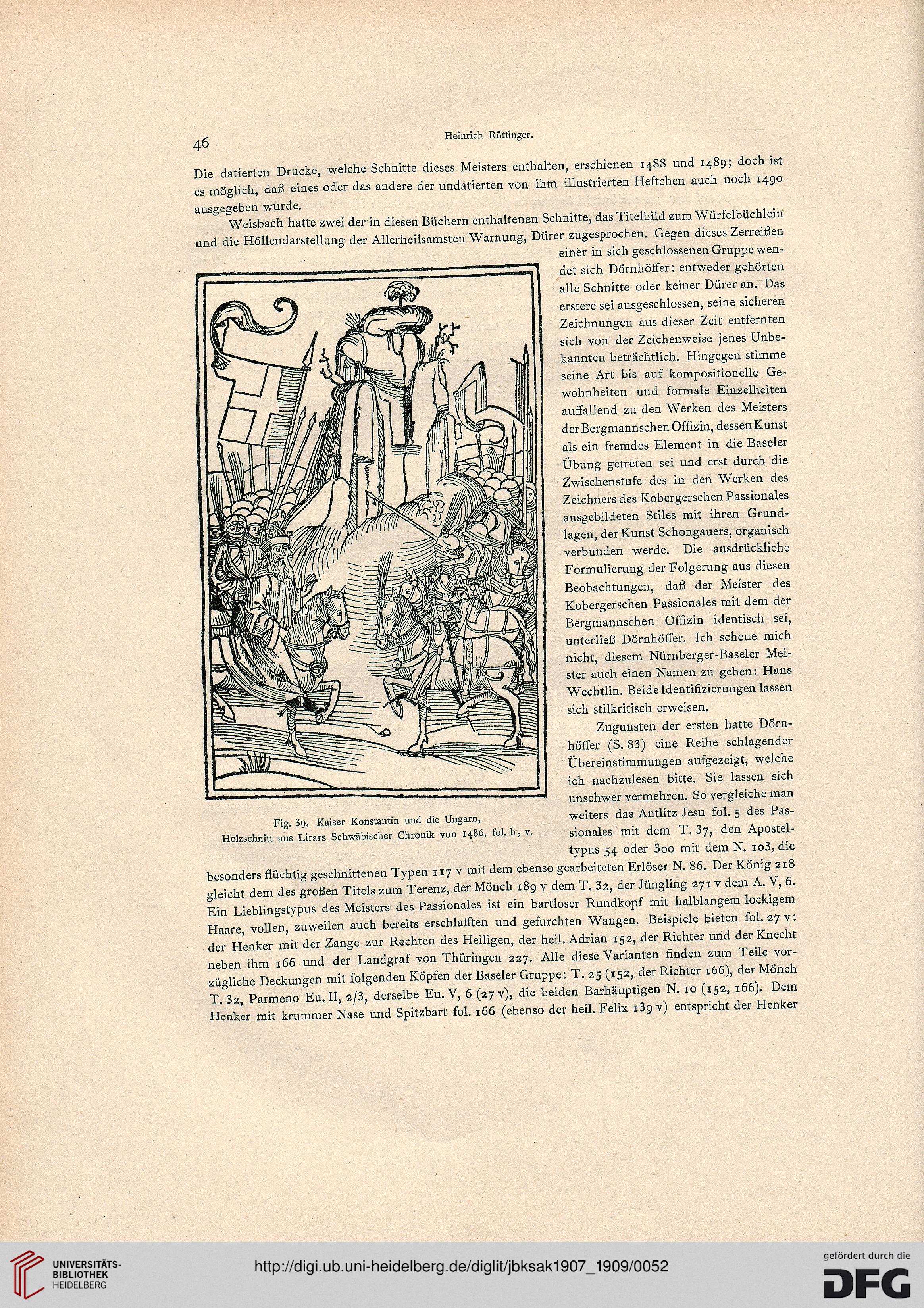46
Heinrich Röttinger.
Die datierten Drucke, welche Schnitte dieses Meisters enthalten, erschienen 1488 und 1489; doch ist
es möglich, daß eines oder das andere der undatierten von ihm illustrierten Heftchen auch noch 1490
ausgegeben wurde.
Weisbach hatte zwei der in diesen Büchern enthaltenen Schnitte, das Titelbild zum Würfelbüchlein
und die Höllendarstellung der Allerheilsamsten Warnung, Dürer zugesprochen. Gegen dieses Zerreißen
einer in sich geschlossenen Gruppe wen-
det sich DÖrnhöffer: entweder gehörten
alle Schnitte oder keiner Dürer an. Das
erstere sei ausgeschlossen, seine sicheren
Zeichnungen aus dieser Zeit entfernten
sich von der Zeichenweise jenes Unbe-
kannten beträchtlich. Hingegen stimme
seine Art bis auf kompositionelle Ge-
wohnheiten und formale Einzelheiten
auffallend zu den Werken des Meisters
derBergmannschen Offizin, dessenKunst
als ein fremdes Element in die Baseler
Übung getreten sei und erst durch die
Zwischenstufe des in den Werken des
Zeichners des Kobergerschen Passionales
ausgebildeten Stiles mit ihren Grund-
lagen, der Kunst Schongauers, organisch
verbunden werde. Die ausdrückliche
Formulierung der Folgerung aus diesen
Beobachtungen, daß der Meister des
Kobergerschen Passionales mit dem der
Bergmannschen Offizin identisch sei,
unterließ DÖrnhöffer. Ich scheue mich
nicht, diesem Nürnberger-Baseler Mei-
ster auch einen Namen zu geben: Hans
Wechtlin. Beide Identifizierungen lassen
sich stilkritisch erweisen.
Zugunsten der ersten hatte DÖrn-
höffer (S. 83) eine Reihe schlagender
Übereinstimmungen aufgezeigt, welche
ich nachzulesen bitte. Sie lassen sich
unschwer vermehren. So vergleiche man
weiters das Antlitz Jesu fol. 5 des Pas-
sionales mit dem T. 37, den Apostel-
typus 54 oder 3oo mit dem N. io3, die
besonders flüchtig geschnittenen Typen 117 v mit dem ebenso gearbeiteten Erlöser N. 86. Der König 218
gleicht dem des großen Titels zum Terenz, der Mönch 189 v dem T. 32, der Jüngling 271 v dem A. V, 6.
Ein Lieblingstypus des Meisters des Passionales ist ein bartloser Rundkopf mit halblangem lockigem
Haare, vollen, zuweilen auch bereits erschlafften und gefurchten Wangen. Beispiele bieten fol. 27 v:
der Henker mit der Zange zur Rechten des Heiligen, der heil. Adrian 152, der Richter und der Knecht
neben ihm 166 und der Landgraf von Thüringen 227. Alle diese Varianten finden zum Teile vor-
zügliche Deckungen mit folgenden Köpfen der Baseler Gruppe: T. 25 (152, der Richter 166), der Mönch
T. 32, Parmeno Eu. II, 2/3, derselbe Eu. V, 6 (27 V), die beiden Barhäuptigen N. 10 (152, 166). Dem
Henker mit krummer Nase und Spitzbart fol. 166 (ebenso der heil. Felix i3g v) entspricht der Henker
Fig. 39. Kaiser Konstantin und die Ungarn,
Holzschnitt aus Lirars Schwäbischer Chronik von i486, fol. b7 v.
Heinrich Röttinger.
Die datierten Drucke, welche Schnitte dieses Meisters enthalten, erschienen 1488 und 1489; doch ist
es möglich, daß eines oder das andere der undatierten von ihm illustrierten Heftchen auch noch 1490
ausgegeben wurde.
Weisbach hatte zwei der in diesen Büchern enthaltenen Schnitte, das Titelbild zum Würfelbüchlein
und die Höllendarstellung der Allerheilsamsten Warnung, Dürer zugesprochen. Gegen dieses Zerreißen
einer in sich geschlossenen Gruppe wen-
det sich DÖrnhöffer: entweder gehörten
alle Schnitte oder keiner Dürer an. Das
erstere sei ausgeschlossen, seine sicheren
Zeichnungen aus dieser Zeit entfernten
sich von der Zeichenweise jenes Unbe-
kannten beträchtlich. Hingegen stimme
seine Art bis auf kompositionelle Ge-
wohnheiten und formale Einzelheiten
auffallend zu den Werken des Meisters
derBergmannschen Offizin, dessenKunst
als ein fremdes Element in die Baseler
Übung getreten sei und erst durch die
Zwischenstufe des in den Werken des
Zeichners des Kobergerschen Passionales
ausgebildeten Stiles mit ihren Grund-
lagen, der Kunst Schongauers, organisch
verbunden werde. Die ausdrückliche
Formulierung der Folgerung aus diesen
Beobachtungen, daß der Meister des
Kobergerschen Passionales mit dem der
Bergmannschen Offizin identisch sei,
unterließ DÖrnhöffer. Ich scheue mich
nicht, diesem Nürnberger-Baseler Mei-
ster auch einen Namen zu geben: Hans
Wechtlin. Beide Identifizierungen lassen
sich stilkritisch erweisen.
Zugunsten der ersten hatte DÖrn-
höffer (S. 83) eine Reihe schlagender
Übereinstimmungen aufgezeigt, welche
ich nachzulesen bitte. Sie lassen sich
unschwer vermehren. So vergleiche man
weiters das Antlitz Jesu fol. 5 des Pas-
sionales mit dem T. 37, den Apostel-
typus 54 oder 3oo mit dem N. io3, die
besonders flüchtig geschnittenen Typen 117 v mit dem ebenso gearbeiteten Erlöser N. 86. Der König 218
gleicht dem des großen Titels zum Terenz, der Mönch 189 v dem T. 32, der Jüngling 271 v dem A. V, 6.
Ein Lieblingstypus des Meisters des Passionales ist ein bartloser Rundkopf mit halblangem lockigem
Haare, vollen, zuweilen auch bereits erschlafften und gefurchten Wangen. Beispiele bieten fol. 27 v:
der Henker mit der Zange zur Rechten des Heiligen, der heil. Adrian 152, der Richter und der Knecht
neben ihm 166 und der Landgraf von Thüringen 227. Alle diese Varianten finden zum Teile vor-
zügliche Deckungen mit folgenden Köpfen der Baseler Gruppe: T. 25 (152, der Richter 166), der Mönch
T. 32, Parmeno Eu. II, 2/3, derselbe Eu. V, 6 (27 V), die beiden Barhäuptigen N. 10 (152, 166). Dem
Henker mit krummer Nase und Spitzbart fol. 166 (ebenso der heil. Felix i3g v) entspricht der Henker
Fig. 39. Kaiser Konstantin und die Ungarn,
Holzschnitt aus Lirars Schwäbischer Chronik von i486, fol. b7 v.