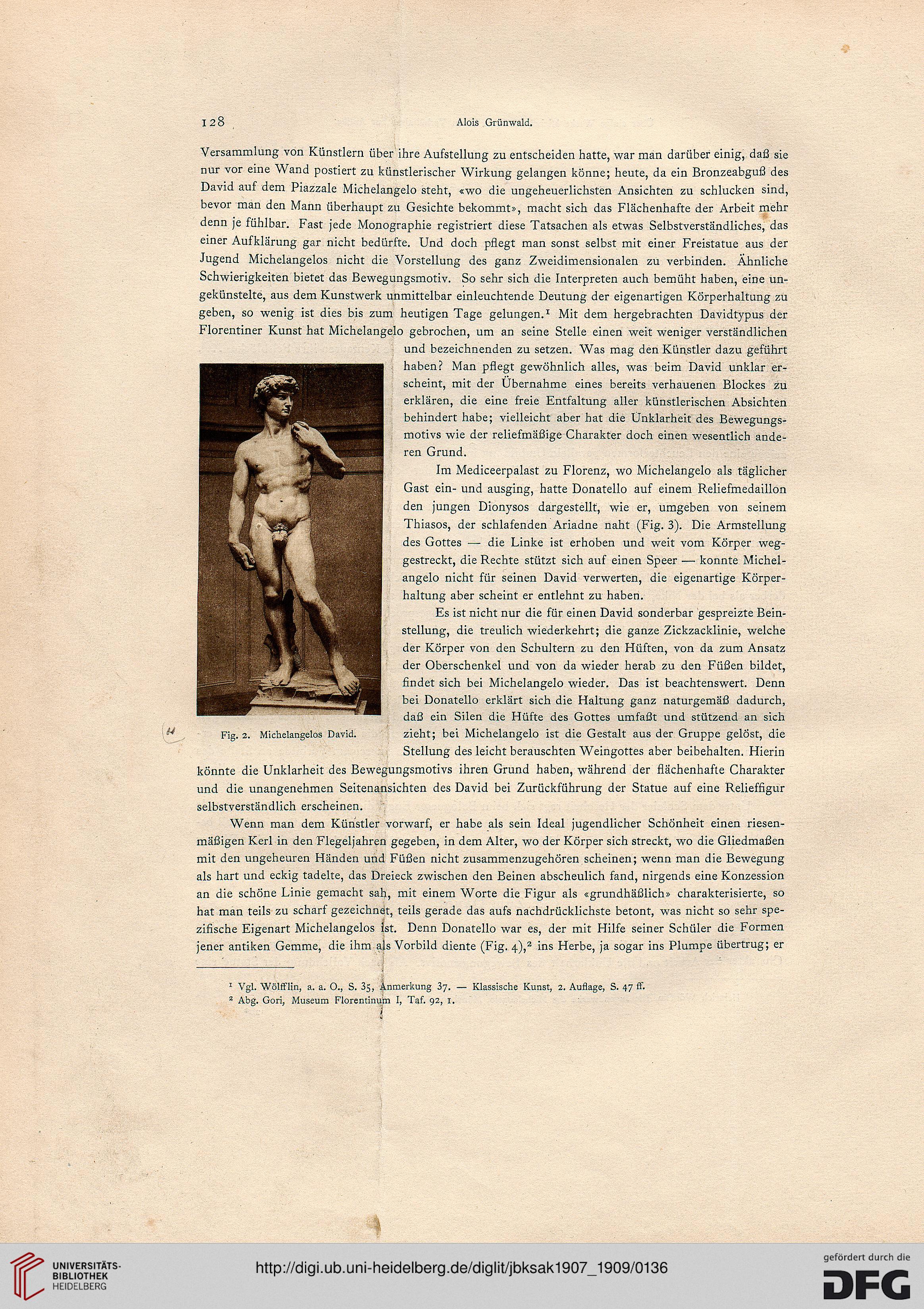128
Alois Grünwald.
Versammlung von Künstlern über ihre Aufstellung zu entscheiden hatte, war man darüber einig, daß sie
nur vor eine Wand postiert zu künstlerischer Wirkung gelangen könne; heute, da ein Bronzeabguß des
David auf dem Piazzale Michelangelo steht, «wo die ungeheuerlichsten Ansichten zu schlucken sind,
bevor man den Mann überhaupt zu Gesichte bekommt», macht sich das Flächenhafte der Arbeit mehr
denn je fühlbar. Fast jede Monographie registriert diese Tatsachen als etwas Selbstverständliches, das
einer Aufklärung gar nicht bedürfte. Und doch pflegt man sonst selbst mit einer Freistatue aus der
Jugend Michelangelos nicht die Vorstellung des ganz Zweidimensionalen zu verbinden. Ähnliche
Schwierigkeiten bietet das Bewegungsmotiv. So sehr sich die Interpreten auch bemüht haben, eine un-
gekünstelte, aus dem Kunstwerk unmittelbar einleuchtende Deutung der eigenartigen Körperhaltung zu
geben, so wenig ist dies bis zum heutigen Tage gelungen.1 Mit dem hergebrachten Davidtypus der
Florentiner Kunst hat Michelangelo gebrochen, um an seine Stelle einen weit weniger verständlichen
und bezeichnenden zu setzen. Was mag den Künstler dazu geführt
haben? Man pflegt gewöhnlich alles, was beim David unklar er-
scheint, mit der Übernahme eines bereits verhauenen Blockes zu
erklären, die eine freie Entfaltung aller künstlerischen Absichten
behindert habe; vielleicht aber hat die Unklarheit des Bewegungs-
motivs wie der reliefmäßige Charakter doch einen wesentlich ande-
ren Grund.
Im Mediceerpalast zu Florenz, wo Michelangelo als täglicher
Gast ein- und ausging, hatte Donatello auf einem Reliefmedaillon
den jungen Dionysos dargestellt, wie er, umgeben von seinem
Thiasos, der schlafenden Ariadne naht (Fig. 3). Die Armstellung
des Gottes — die Linke ist erhoben und weit vom Körper weg-
gestreckt, die Rechte stützt sich auf einen Speer — konnte Michel-
angelo nicht für seinen David verwerten, die eigenartige Körper-
haltung aber scheint er entlehnt zu haben.
Es ist nicht nur die für einen David sonderbar gespreizte Bein-
stellung, die treulich wiederkehrt; die ganze Zickzacklinie, welche
der Körper von den Schultern zu den Hüften, von da zum Ansatz
der Oberschenkel und von da wieder herab zu den Füßen bildet,
findet sich bei Michelangelo wieder. Das ist beachtenswert. Denn
bei Donatello erklärt sich die Haltung ganz naturgemäß dadurch,
daß ein Silen die Hüfte des Gottes umfaßt und stützend an sich
Fig. 2. Michelangelos David. zieht; bei Michelangelo ist die Gestalt aus der Gruppe gelöst, die
Stellung des leicht berauschten Weingottes aber beibehalten. Hierin
könnte die Unklarheit des Bewegungsmotivs ihren Grund haben, während der flächenhafte Charakter
und die unangenehmen Seitenansichten des David bei Zurückführung der Statue auf eine Relieffigur
selbstverständlich erscheinen.
Wenn man dem Künstler vorwarf, er habe als sein Ideal jugendlicher Schönheit einen riesen-
mäßigen Kerl in den Flegeljahren gegeben, in dem Alter, wo der Körper sich streckt, wo die Gliedmaßen
mit den ungeheuren Händen und Füßen nicht zusammenzugehören scheinen; wenn man die Bewegung
als hart und eckig tadelte, das Dreieck zwischen den Beinen abscheulich fand, nirgends eine Konzession
an die schöne Linie gemacht sah, mit einem Worte die Figur als «grundhäßlich» charakterisierte, so
hat man teils zu scharf gezeichnet, teils gerade das aufs nachdrücklichste betont, was nicht so sehr spe-
zifische Eigenart Michelangelos Ist. Denn Donatello war es, der mit Hilfe seiner Schüler die Formen
jener antiken Gemme, die ihm als Vorbild diente (Fig. 4),2 ins Herbe, ja sogar ins Plumpe übertrug; er
1 Vgl. Wölfflin, a. a. O., S. 35, Anmerkung 37. — Klassische Kunst, 2. Auflage, S. 47 ff.
2 Abg. Gori, Museum Florentinum I, Taf. 92, 1.
Alois Grünwald.
Versammlung von Künstlern über ihre Aufstellung zu entscheiden hatte, war man darüber einig, daß sie
nur vor eine Wand postiert zu künstlerischer Wirkung gelangen könne; heute, da ein Bronzeabguß des
David auf dem Piazzale Michelangelo steht, «wo die ungeheuerlichsten Ansichten zu schlucken sind,
bevor man den Mann überhaupt zu Gesichte bekommt», macht sich das Flächenhafte der Arbeit mehr
denn je fühlbar. Fast jede Monographie registriert diese Tatsachen als etwas Selbstverständliches, das
einer Aufklärung gar nicht bedürfte. Und doch pflegt man sonst selbst mit einer Freistatue aus der
Jugend Michelangelos nicht die Vorstellung des ganz Zweidimensionalen zu verbinden. Ähnliche
Schwierigkeiten bietet das Bewegungsmotiv. So sehr sich die Interpreten auch bemüht haben, eine un-
gekünstelte, aus dem Kunstwerk unmittelbar einleuchtende Deutung der eigenartigen Körperhaltung zu
geben, so wenig ist dies bis zum heutigen Tage gelungen.1 Mit dem hergebrachten Davidtypus der
Florentiner Kunst hat Michelangelo gebrochen, um an seine Stelle einen weit weniger verständlichen
und bezeichnenden zu setzen. Was mag den Künstler dazu geführt
haben? Man pflegt gewöhnlich alles, was beim David unklar er-
scheint, mit der Übernahme eines bereits verhauenen Blockes zu
erklären, die eine freie Entfaltung aller künstlerischen Absichten
behindert habe; vielleicht aber hat die Unklarheit des Bewegungs-
motivs wie der reliefmäßige Charakter doch einen wesentlich ande-
ren Grund.
Im Mediceerpalast zu Florenz, wo Michelangelo als täglicher
Gast ein- und ausging, hatte Donatello auf einem Reliefmedaillon
den jungen Dionysos dargestellt, wie er, umgeben von seinem
Thiasos, der schlafenden Ariadne naht (Fig. 3). Die Armstellung
des Gottes — die Linke ist erhoben und weit vom Körper weg-
gestreckt, die Rechte stützt sich auf einen Speer — konnte Michel-
angelo nicht für seinen David verwerten, die eigenartige Körper-
haltung aber scheint er entlehnt zu haben.
Es ist nicht nur die für einen David sonderbar gespreizte Bein-
stellung, die treulich wiederkehrt; die ganze Zickzacklinie, welche
der Körper von den Schultern zu den Hüften, von da zum Ansatz
der Oberschenkel und von da wieder herab zu den Füßen bildet,
findet sich bei Michelangelo wieder. Das ist beachtenswert. Denn
bei Donatello erklärt sich die Haltung ganz naturgemäß dadurch,
daß ein Silen die Hüfte des Gottes umfaßt und stützend an sich
Fig. 2. Michelangelos David. zieht; bei Michelangelo ist die Gestalt aus der Gruppe gelöst, die
Stellung des leicht berauschten Weingottes aber beibehalten. Hierin
könnte die Unklarheit des Bewegungsmotivs ihren Grund haben, während der flächenhafte Charakter
und die unangenehmen Seitenansichten des David bei Zurückführung der Statue auf eine Relieffigur
selbstverständlich erscheinen.
Wenn man dem Künstler vorwarf, er habe als sein Ideal jugendlicher Schönheit einen riesen-
mäßigen Kerl in den Flegeljahren gegeben, in dem Alter, wo der Körper sich streckt, wo die Gliedmaßen
mit den ungeheuren Händen und Füßen nicht zusammenzugehören scheinen; wenn man die Bewegung
als hart und eckig tadelte, das Dreieck zwischen den Beinen abscheulich fand, nirgends eine Konzession
an die schöne Linie gemacht sah, mit einem Worte die Figur als «grundhäßlich» charakterisierte, so
hat man teils zu scharf gezeichnet, teils gerade das aufs nachdrücklichste betont, was nicht so sehr spe-
zifische Eigenart Michelangelos Ist. Denn Donatello war es, der mit Hilfe seiner Schüler die Formen
jener antiken Gemme, die ihm als Vorbild diente (Fig. 4),2 ins Herbe, ja sogar ins Plumpe übertrug; er
1 Vgl. Wölfflin, a. a. O., S. 35, Anmerkung 37. — Klassische Kunst, 2. Auflage, S. 47 ff.
2 Abg. Gori, Museum Florentinum I, Taf. 92, 1.