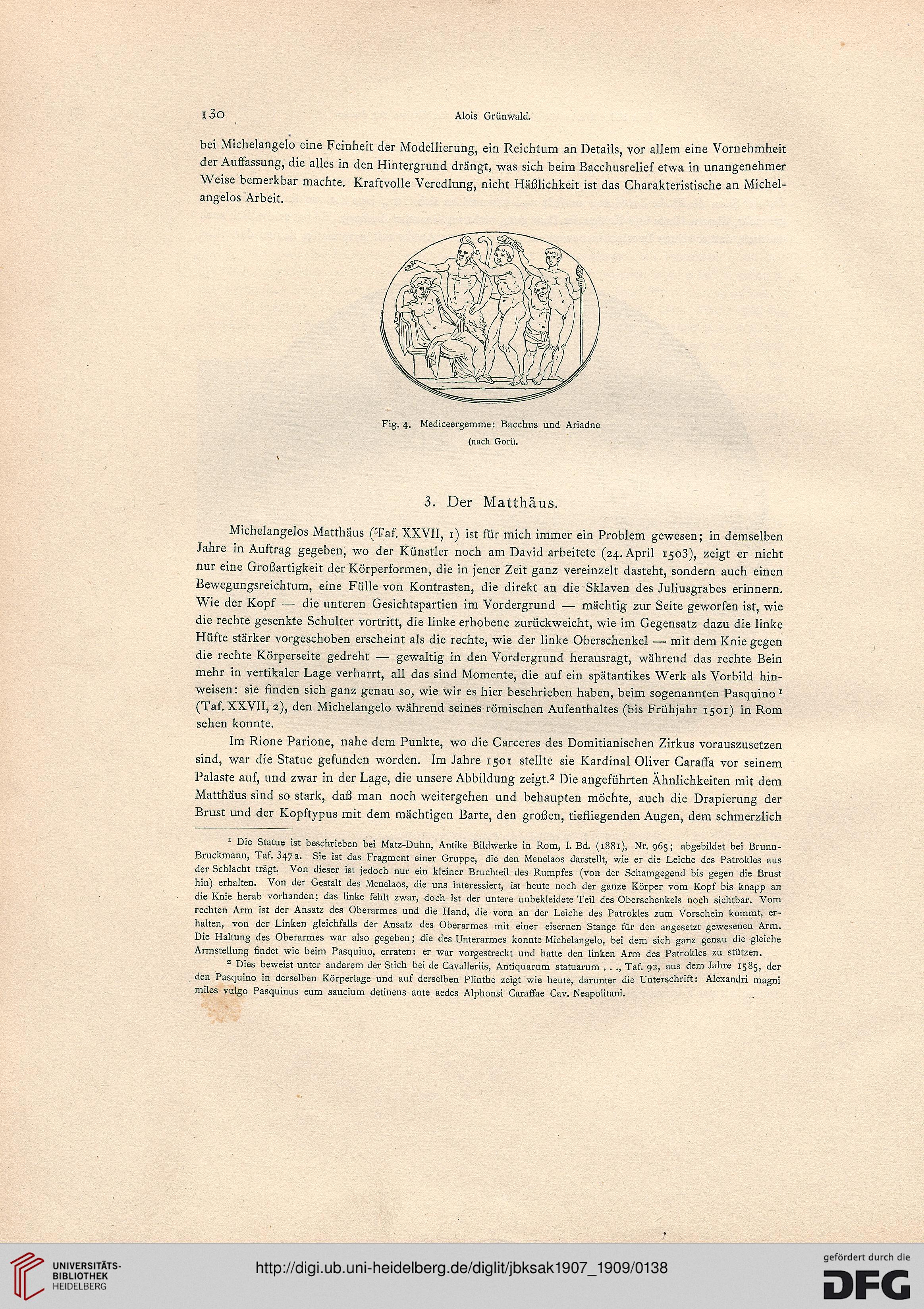i3o
Alois Grünwald.
bei Michelangelo eine Feinheit der Modellierung, ein Reichtum an Details, vor allem eine Vornehmheit
der Auffassung, die alles in den Hintergrund drängt, was sich beim Bacchusrelief etwa in unangenehmer
Weise bemerkbar machte. Kraftvolle Veredlung, nicht Häßlichkeit ist das Charakteristische an Michel-
angelos Arbeit.
Fig. 4. Mediceergemme: Bacchus und Ariadnc
(nach Gori).
3. Der Matthäus.
Michelangelos Matthäus (Taf. XXVII, 1) ist für mich immer ein Problem gewesen; in demselben
Jahre in Auftrag gegeben, wo der Künstler noch am David arbeitete (24. April 1503), zeigt er nicht
nur eine Großartigkeit der Körperformen, die in jener Zeit ganz vereinzelt dasteht, sondern auch einen
Bewegungsreichtum, eine Fülle von Kontrasten, die direkt an die Sklaven des Juliusgrabes erinnern.
Wie der Kopf — die unteren Gesichtspartien im Vordergrund — mächtig zur Seite geworfen ist, wie
die rechte gesenkte Schulter vortritt, die linke erhobene zurückweicht, wie im Gegensatz dazu die linke
Hüfte stärker vorgeschoben erscheint als die rechte, wie der linke Oberschenkel — mit dem Knie gegen
die rechte Körperseite gedreht — gewaltig in den Vordergrund herausragt, während das rechte Bein
mehr in vertikaler Lage verharrt, all das sind Momente, die auf ein spätantikes Werk als Vorbild hin-
weisen: sie finden sich ganz genau so, wie wir es hier beschrieben haben, beim sogenannten Pasquino 1
(Taf. XXVII, 2), den Michelangelo während seines römischen Aufenthaltes (bis Frühjahr 1501) in Rom
sehen konnte.
Im Rione Parione, nahe dem Punkte, wo die Carceres des Domitianischen Zirkus vorauszusetzen
sind, war die Statue gefunden worden. Im Jahre 1501 stellte sie Kardinal Oliver Caraffa vor seinem
Palaste auf, und zwar in der Lage, die unsere Abbildung zeigt.2 Die angeführten Ähnlichkeiten mit dem
Matthäus sind so stark, daß man noch weitergehen und behaupten möchte, auch die Drapierung der
Brust und der Kopftypus mit dem mächtigen Barte, den großen, tiefliegenden Augen, dem schmerzlich
1 Die Statue ist beschrieben bei Matz-Duhn, Antike Bildwerke in Rom, I. Bd. (1881), Nr. 965; abgebildet bei Brunn-
Bruckmann, Taf. 347 a. Sie ist das Fragment einer Gruppe, die den Menelaos darstellt, wie er die Leiche des Patrokles aus
der Schlacht trägt. Von dieser ist jedoch nur ein kleiner Bruchteil des Rumpfes (von der Schamgegend bis gegen die Brust
hin) erhalten. Von der Gestalt des Menelaos, die uns interessiert, ist heute noch der ganze Körper vom Kopf bis knapp an
die Knie herab vorhanden; das linke fehlt zwar, doch ist der untere unbekleidete Teil des Oberschenkels noch sichtbar. Vom
rechten Arm ist der Ansatz des Oberarmes und die Hand, die vorn an der Leiche des Patrokles zum Vorschein kommt, er-
halten, von der Linken gleichfalls der Ansatz des Oberarmes mit einer eisernen Stange für den angesetzt gewesenen Arm.
Die Haltung des Oberarmes war also gegeben; die des Unterarmes konnte Michelangelo, bei dem sich ganz genau die gleiche
Armstellung findet wie beim Pasquino, erraten: er war vorgestreckt und hatte den linken Arm des Patrokles zu stützen.
2 Dies beweist unter anderem der Stich bei de Cavalleriis, Antiquarum statuarum . . ., Taf. 92, aus dem Jahre 1585, der
den Pasquino in derselben Körperlage und auf derselben Plinthe zeigt wie heute, darunter die Unterschrift: Alexandri magni
miles vulgo Pasquinus eum saucium detinens ante aedes Alphonsi Caraffae Cav. Neapolitani.
Alois Grünwald.
bei Michelangelo eine Feinheit der Modellierung, ein Reichtum an Details, vor allem eine Vornehmheit
der Auffassung, die alles in den Hintergrund drängt, was sich beim Bacchusrelief etwa in unangenehmer
Weise bemerkbar machte. Kraftvolle Veredlung, nicht Häßlichkeit ist das Charakteristische an Michel-
angelos Arbeit.
Fig. 4. Mediceergemme: Bacchus und Ariadnc
(nach Gori).
3. Der Matthäus.
Michelangelos Matthäus (Taf. XXVII, 1) ist für mich immer ein Problem gewesen; in demselben
Jahre in Auftrag gegeben, wo der Künstler noch am David arbeitete (24. April 1503), zeigt er nicht
nur eine Großartigkeit der Körperformen, die in jener Zeit ganz vereinzelt dasteht, sondern auch einen
Bewegungsreichtum, eine Fülle von Kontrasten, die direkt an die Sklaven des Juliusgrabes erinnern.
Wie der Kopf — die unteren Gesichtspartien im Vordergrund — mächtig zur Seite geworfen ist, wie
die rechte gesenkte Schulter vortritt, die linke erhobene zurückweicht, wie im Gegensatz dazu die linke
Hüfte stärker vorgeschoben erscheint als die rechte, wie der linke Oberschenkel — mit dem Knie gegen
die rechte Körperseite gedreht — gewaltig in den Vordergrund herausragt, während das rechte Bein
mehr in vertikaler Lage verharrt, all das sind Momente, die auf ein spätantikes Werk als Vorbild hin-
weisen: sie finden sich ganz genau so, wie wir es hier beschrieben haben, beim sogenannten Pasquino 1
(Taf. XXVII, 2), den Michelangelo während seines römischen Aufenthaltes (bis Frühjahr 1501) in Rom
sehen konnte.
Im Rione Parione, nahe dem Punkte, wo die Carceres des Domitianischen Zirkus vorauszusetzen
sind, war die Statue gefunden worden. Im Jahre 1501 stellte sie Kardinal Oliver Caraffa vor seinem
Palaste auf, und zwar in der Lage, die unsere Abbildung zeigt.2 Die angeführten Ähnlichkeiten mit dem
Matthäus sind so stark, daß man noch weitergehen und behaupten möchte, auch die Drapierung der
Brust und der Kopftypus mit dem mächtigen Barte, den großen, tiefliegenden Augen, dem schmerzlich
1 Die Statue ist beschrieben bei Matz-Duhn, Antike Bildwerke in Rom, I. Bd. (1881), Nr. 965; abgebildet bei Brunn-
Bruckmann, Taf. 347 a. Sie ist das Fragment einer Gruppe, die den Menelaos darstellt, wie er die Leiche des Patrokles aus
der Schlacht trägt. Von dieser ist jedoch nur ein kleiner Bruchteil des Rumpfes (von der Schamgegend bis gegen die Brust
hin) erhalten. Von der Gestalt des Menelaos, die uns interessiert, ist heute noch der ganze Körper vom Kopf bis knapp an
die Knie herab vorhanden; das linke fehlt zwar, doch ist der untere unbekleidete Teil des Oberschenkels noch sichtbar. Vom
rechten Arm ist der Ansatz des Oberarmes und die Hand, die vorn an der Leiche des Patrokles zum Vorschein kommt, er-
halten, von der Linken gleichfalls der Ansatz des Oberarmes mit einer eisernen Stange für den angesetzt gewesenen Arm.
Die Haltung des Oberarmes war also gegeben; die des Unterarmes konnte Michelangelo, bei dem sich ganz genau die gleiche
Armstellung findet wie beim Pasquino, erraten: er war vorgestreckt und hatte den linken Arm des Patrokles zu stützen.
2 Dies beweist unter anderem der Stich bei de Cavalleriis, Antiquarum statuarum . . ., Taf. 92, aus dem Jahre 1585, der
den Pasquino in derselben Körperlage und auf derselben Plinthe zeigt wie heute, darunter die Unterschrift: Alexandri magni
miles vulgo Pasquinus eum saucium detinens ante aedes Alphonsi Caraffae Cav. Neapolitani.