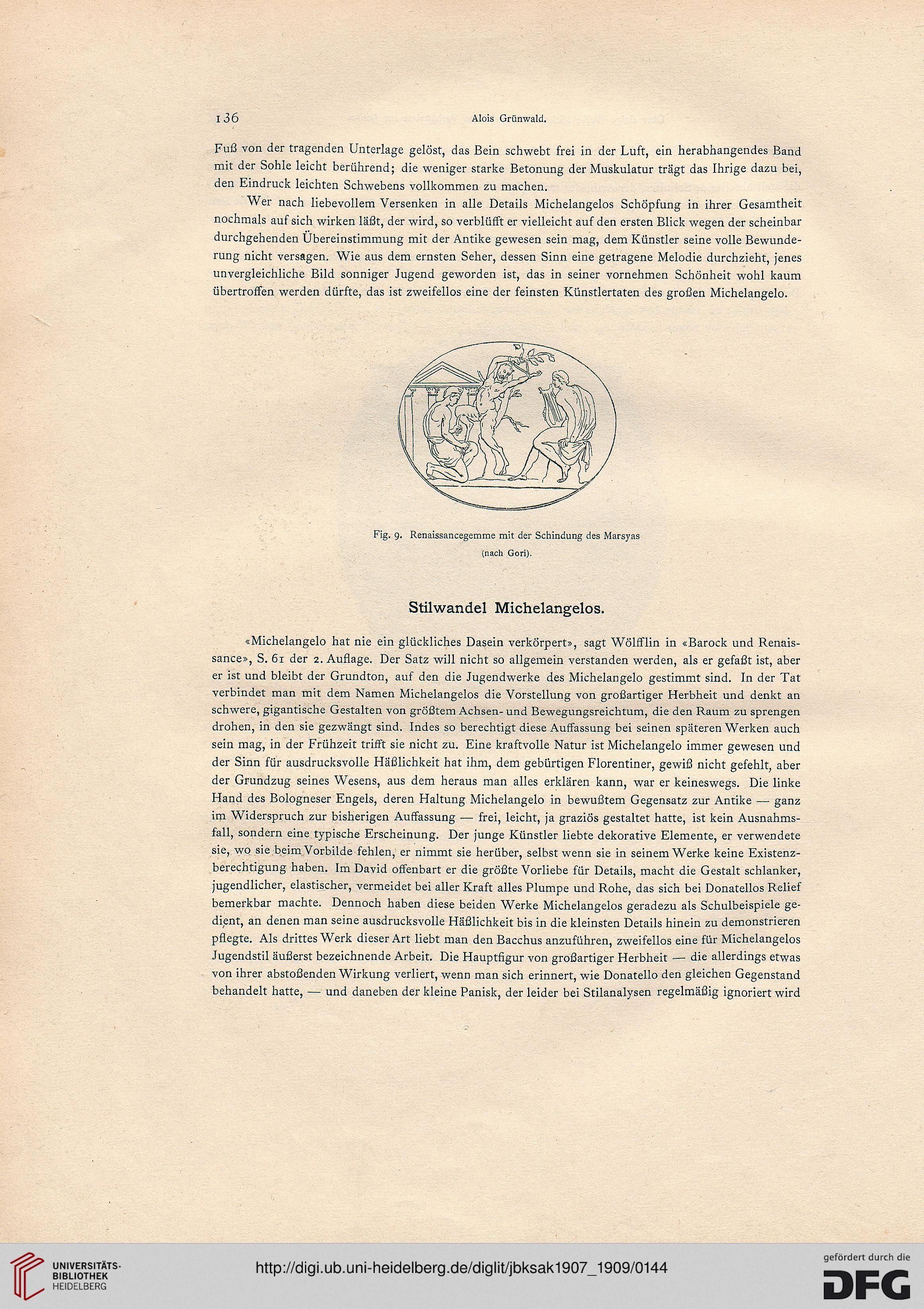i36
Alois Grünwald.
Fuß von der tragenden Unterlage gelöst, das Bein schwebt frei in der Luft, ein herabhängendes Band
mit der Sohle leicht berührend; die weniger starke Betonung der Muskulatur trägt das Ihrige dazu bei,
den Eindruck leichten Schwebens vollkommen zu machen.
Wer nach liebevollem Versenken in alle Details Michelangelos Schöpfung in ihrer Gesamtheit
nochmals auf sich wirken läßt, der wird, so verblüfft er vielleicht auf den ersten Blick wegen der scheinbar
durchgehenden Ubereinstimmung mit der Antike gewesen sein mag, dem Künstler seine volle Bewunde-
rung nicht versagen. Wie aus dem ernsten Seher, dessen Sinn eine getragene Melodie durchzieht, jenes
unvergleichliche Bild sonniger Jugend geworden ist, das in seiner vornehmen Schönheit wohl kaum
übertroffen werden dürfte, das ist zweifellos eine der feinsten Künstlertaten des großen Michelangelo.
«Michelangelo hat nie ein glückliches Dasein verkörpert», sagt Wölfflin in «Barock und Renais-
sance», S. 61 der 2. Auflage. Der Satz will nicht so allgemein verstanden werden, als er gefaßt ist, aber
er ist und bleibt der Grundton, auf den die Jugendwerke des Michelangelo gestimmt sind. In der Tat
verbindet man mit dem Namen Michelangelos die Vorstellung von großartiger Herbheit und denkt an
schwere, gigantische Gestalten von größtem Achsen- und Bewegungsreichtum, die den Raum zu sprengen
drohen, in den sie gezwängt sind. Indes so berechtigt diese Auffassung bei seinen späteren Werken auch
sein mag, in der Frühzeit trifft sie nicht zu. Eine kraftvolle Natur ist Michelangelo immer gewesen und
der Sinn für ausdrucksvolle Häßlichkeit hat ihm, dem gebürtigen Florentiner, gewiß nicht gefehlt, aber
der Grundzug seines Wesens, aus dem heraus man alles erklären kann, war er keineswegs. Die linke
Hand des Bologneser Engels, deren Haltung Michelangelo in bewußtem Gegensatz zur Antike — ganz
im Widerspruch zur bisherigen Auffassung — frei, leicht, ja graziös gestaltet hatte, ist kein Ausnahms-
fall, sondern eine typische Erscheinung. Der junge Künstler liebte dekorative Elemente, er verwendete
sie, wo sie beim Vorbilde fehlen, er nimmt sie herüber, selbst wenn sie in seinem Werke keine Existenz-
berechtigung haben. Im David offenbart er die größte Vorliebe für Details, macht die Gestalt schlanker,
jugendlicher, elastischer, vermeidet bei aller Kraft alles Plumpe und Rohe, das sich bei Donatellos Relief
bemerkbar machte. Dennoch haben diese beiden Werke Michelangelos geradezu als Schulbeispiele ge-
dient, an denen man seine ausdrucksvolle Häßlichkeit bis in die kleinsten Details hinein zu demonstrieren
pflegte. Als drittes Werk dieser Art liebt man den Bacchus anzuführen, zweifellos eine für Michelangelos
Jugendstil äußerst bezeichnende Arbeit. Die Hauptfigur von großartiger Herbheit — die allerdings etwas
von ihrer abstoßenden Wirkung verliert, wenn man sich erinnert, wie Donatello den gleichen Gegenstand
behandelt hatte, — und daneben der kleine Panisk, der leider bei Stilanalysen regelmäßig ignoriert wird
Fig. 9. Renaissancegemme mit der Schindung des Marsyas
(nach Gori).
Stilwandel Michelangelos.
Alois Grünwald.
Fuß von der tragenden Unterlage gelöst, das Bein schwebt frei in der Luft, ein herabhängendes Band
mit der Sohle leicht berührend; die weniger starke Betonung der Muskulatur trägt das Ihrige dazu bei,
den Eindruck leichten Schwebens vollkommen zu machen.
Wer nach liebevollem Versenken in alle Details Michelangelos Schöpfung in ihrer Gesamtheit
nochmals auf sich wirken läßt, der wird, so verblüfft er vielleicht auf den ersten Blick wegen der scheinbar
durchgehenden Ubereinstimmung mit der Antike gewesen sein mag, dem Künstler seine volle Bewunde-
rung nicht versagen. Wie aus dem ernsten Seher, dessen Sinn eine getragene Melodie durchzieht, jenes
unvergleichliche Bild sonniger Jugend geworden ist, das in seiner vornehmen Schönheit wohl kaum
übertroffen werden dürfte, das ist zweifellos eine der feinsten Künstlertaten des großen Michelangelo.
«Michelangelo hat nie ein glückliches Dasein verkörpert», sagt Wölfflin in «Barock und Renais-
sance», S. 61 der 2. Auflage. Der Satz will nicht so allgemein verstanden werden, als er gefaßt ist, aber
er ist und bleibt der Grundton, auf den die Jugendwerke des Michelangelo gestimmt sind. In der Tat
verbindet man mit dem Namen Michelangelos die Vorstellung von großartiger Herbheit und denkt an
schwere, gigantische Gestalten von größtem Achsen- und Bewegungsreichtum, die den Raum zu sprengen
drohen, in den sie gezwängt sind. Indes so berechtigt diese Auffassung bei seinen späteren Werken auch
sein mag, in der Frühzeit trifft sie nicht zu. Eine kraftvolle Natur ist Michelangelo immer gewesen und
der Sinn für ausdrucksvolle Häßlichkeit hat ihm, dem gebürtigen Florentiner, gewiß nicht gefehlt, aber
der Grundzug seines Wesens, aus dem heraus man alles erklären kann, war er keineswegs. Die linke
Hand des Bologneser Engels, deren Haltung Michelangelo in bewußtem Gegensatz zur Antike — ganz
im Widerspruch zur bisherigen Auffassung — frei, leicht, ja graziös gestaltet hatte, ist kein Ausnahms-
fall, sondern eine typische Erscheinung. Der junge Künstler liebte dekorative Elemente, er verwendete
sie, wo sie beim Vorbilde fehlen, er nimmt sie herüber, selbst wenn sie in seinem Werke keine Existenz-
berechtigung haben. Im David offenbart er die größte Vorliebe für Details, macht die Gestalt schlanker,
jugendlicher, elastischer, vermeidet bei aller Kraft alles Plumpe und Rohe, das sich bei Donatellos Relief
bemerkbar machte. Dennoch haben diese beiden Werke Michelangelos geradezu als Schulbeispiele ge-
dient, an denen man seine ausdrucksvolle Häßlichkeit bis in die kleinsten Details hinein zu demonstrieren
pflegte. Als drittes Werk dieser Art liebt man den Bacchus anzuführen, zweifellos eine für Michelangelos
Jugendstil äußerst bezeichnende Arbeit. Die Hauptfigur von großartiger Herbheit — die allerdings etwas
von ihrer abstoßenden Wirkung verliert, wenn man sich erinnert, wie Donatello den gleichen Gegenstand
behandelt hatte, — und daneben der kleine Panisk, der leider bei Stilanalysen regelmäßig ignoriert wird
Fig. 9. Renaissancegemme mit der Schindung des Marsyas
(nach Gori).
Stilwandel Michelangelos.