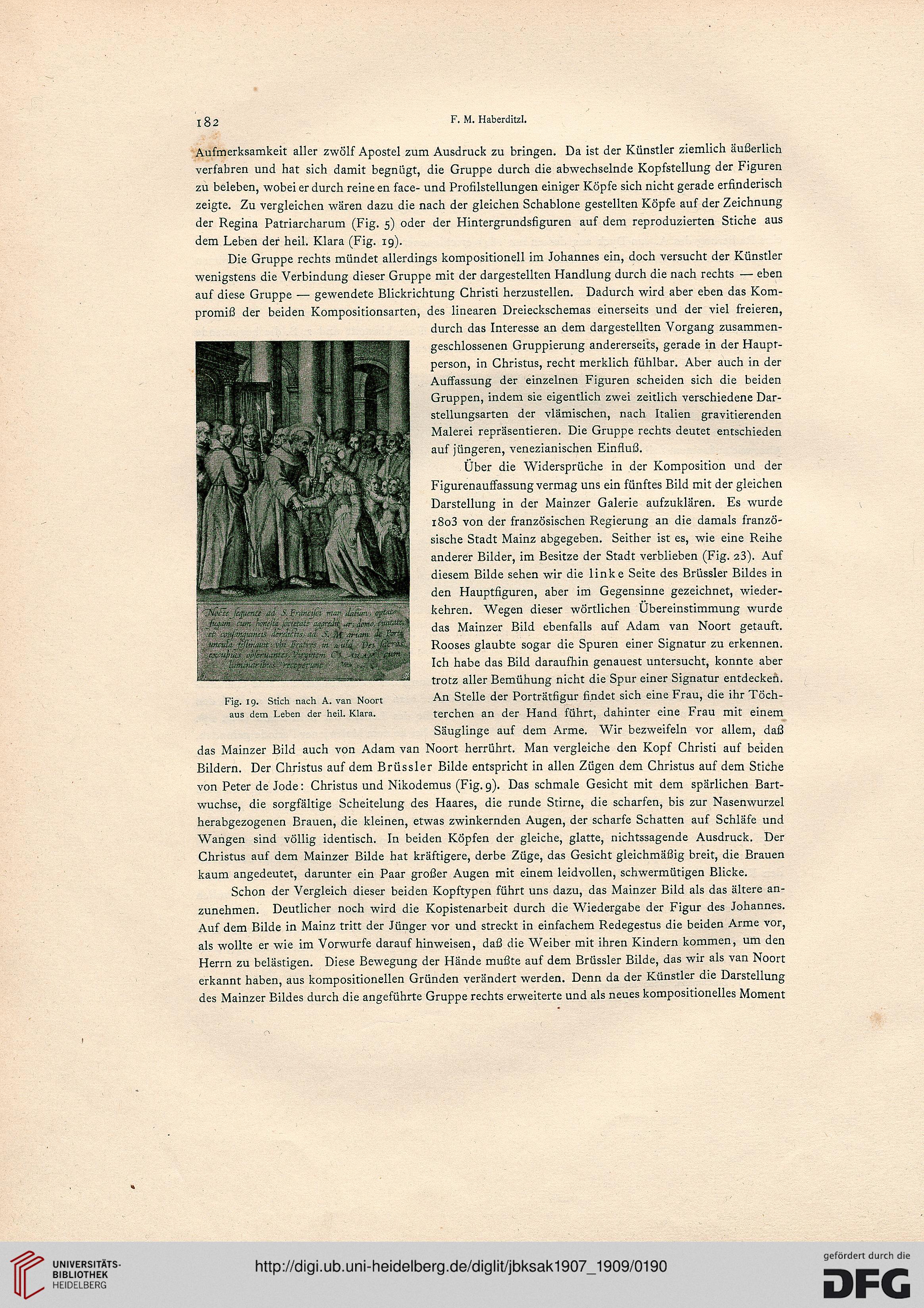182
F. M. Haberditzl.
Aufmerksamkeit aller zwölf Apostel zum Ausdruck zu bringen. Da ist der Künstler ziemlich äußerlich
verfahren und hat sich damit begnügt, die Gruppe durch die abwechselnde Kopfstellung der Figuren
zu beleben, wobei er durch reine en face- und Profilstellungen einiger Köpfe sich nicht gerade erfinderisch
zeigte. Zu vergleichen wären dazu die nach der gleichen Schablone gestellten Köpfe auf der Zeichnung
der Regina Patriarcharum (Fig. 5) oder der Hintergrundsfiguren auf dem reproduzierten Stiche aus
dem Leben der heil. Klara (Fig. ig).
Die Gruppe rechts mündet allerdings kompositioneil im Johannes ein, doch versucht der Künstler
wenigstens die Verbindung dieser Gruppe mit der dargestellten Handlung durch die nach rechts — eben
auf diese Gruppe — gewendete Blickrichtung Christi herzustellen. Dadurch wird aber eben das Kom-
promiß der beiden Kompositionsarten, des linearen Dreieckschemas einerseits und der viel freieren,
durch das Interesse an dem dargestellten Vorgang zusammen-
geschlossenen Gruppierung andererseits, gerade in der Haupt-
person, in Christus, recht merklich fühlbar. Aber auch in der
Auffassung der einzelnen Figuren scheiden sich die beiden
Gruppen, indem sie eigentlich zwei zeitlich verschiedene Dar-
stellungsarten der vlämischen, nach Italien gravitierenden
Malerei repräsentieren. Die Gruppe rechts deutet entschieden
auf jüngeren, venezianischen Einfluß.
Uber die Widersprüche in der Komposition und der
Figurenauffassung vermag uns ein fünftes Bild mit der gleichen
Darstellung in der Mainzer Galerie aufzuklären. Es wurde
i8o3 von der französischen Regierung an die damals franzö-
sische Stadt Mainz abgegeben. Seither ist es, wie eine Reihe
anderer Bilder, im Besitze der Stadt verblieben (Fig. 23). Auf
diesem Bilde sehen wir die linke Seite des Brüssler Bildes in
den Hauptfiguren, aber im Gegensinne gezeichnet, wieder-
kehren. Wegen dieser wörtlichen Ubereinstimmung wurde
■Hj das Mainzer Bild ebenfalls auf Adam van Noort getauft.
HHf Rooses glaubte sogar die Spuren einer Signatur zu erkennen.
Ich habe das Bild daraufhin genauest untersucht, konnte aber
trotz aller Bemühung nicht die Spur einer Signatur entdecken.
Fig. 19. Stich nach A. van Noort An Stelle der Porträtfigur findet sich eine Frau, die ihr Töch-
aus dem Leben der heil. Klara. terchen an der Hand führt, dahinter eine Frau mit einem
Säuglinge auf dem Arme. Wir bezweifeln vor allem, daß
das Mainzer Bild auch von Adam van Noort herrührt. Man vergleiche den Kopf Christi auf beiden
Bildern. Der Christus auf dem Brüssler Bilde entspricht in allen Zügen dem Christus auf dem Stiche
von Peter de Jode: Christus und Nikodemus (Fig. 9). Das schmale Gesicht mit dem spärlichen Bart-
wuchse, die sorgfältige Scheitelung des Haares, die runde Stirne, die scharfen, bis zur Nasenwurzel
herabgezogenen Brauen, die kleinen, etwas zwinkernden Augen, der scharfe Schatten auf Schläfe und
Wangen sind völlig identisch. In beiden Köpfen der gleiche, glatte, nichtssagende Ausdruck. Der
Christus auf dem Mainzer Bilde hat kräftigere, derbe Züge, das Gesicht gleichmäßig breit, die Brauen
kaum angedeutet, darunter ein Paar großer Augen mit einem leidvollen, schwermütigen Blicke.
Schon der Vergleich dieser beiden Kopftypen führt uns dazu, das Mainzer Bild als das ältere an-
zunehmen. Deutlicher noch wird die Kopistenarbeit durch die Wiedergabe der Figur des Johannes.
Auf dem Bilde in Mainz tritt der Jünger vor und streckt in einfachem Redegestus die beiden Arme vor,
als wollte er wie im Vorwurfe daraufhinweisen, daß die Weiber mit ihren Kindern kommen, um den
Herrn zu belästigen. Diese Bewegung der Hände mußte auf dem Brüssler Bilde, das wir als van Noort
erkannt haben, aus kompositionellen Gründen verändert werden. Denn da der Künstler die Darstellung
des Mainzer Bildes durch die angeführte Gruppe rechts erweiterte und als neues kompositionelles Moment
F. M. Haberditzl.
Aufmerksamkeit aller zwölf Apostel zum Ausdruck zu bringen. Da ist der Künstler ziemlich äußerlich
verfahren und hat sich damit begnügt, die Gruppe durch die abwechselnde Kopfstellung der Figuren
zu beleben, wobei er durch reine en face- und Profilstellungen einiger Köpfe sich nicht gerade erfinderisch
zeigte. Zu vergleichen wären dazu die nach der gleichen Schablone gestellten Köpfe auf der Zeichnung
der Regina Patriarcharum (Fig. 5) oder der Hintergrundsfiguren auf dem reproduzierten Stiche aus
dem Leben der heil. Klara (Fig. ig).
Die Gruppe rechts mündet allerdings kompositioneil im Johannes ein, doch versucht der Künstler
wenigstens die Verbindung dieser Gruppe mit der dargestellten Handlung durch die nach rechts — eben
auf diese Gruppe — gewendete Blickrichtung Christi herzustellen. Dadurch wird aber eben das Kom-
promiß der beiden Kompositionsarten, des linearen Dreieckschemas einerseits und der viel freieren,
durch das Interesse an dem dargestellten Vorgang zusammen-
geschlossenen Gruppierung andererseits, gerade in der Haupt-
person, in Christus, recht merklich fühlbar. Aber auch in der
Auffassung der einzelnen Figuren scheiden sich die beiden
Gruppen, indem sie eigentlich zwei zeitlich verschiedene Dar-
stellungsarten der vlämischen, nach Italien gravitierenden
Malerei repräsentieren. Die Gruppe rechts deutet entschieden
auf jüngeren, venezianischen Einfluß.
Uber die Widersprüche in der Komposition und der
Figurenauffassung vermag uns ein fünftes Bild mit der gleichen
Darstellung in der Mainzer Galerie aufzuklären. Es wurde
i8o3 von der französischen Regierung an die damals franzö-
sische Stadt Mainz abgegeben. Seither ist es, wie eine Reihe
anderer Bilder, im Besitze der Stadt verblieben (Fig. 23). Auf
diesem Bilde sehen wir die linke Seite des Brüssler Bildes in
den Hauptfiguren, aber im Gegensinne gezeichnet, wieder-
kehren. Wegen dieser wörtlichen Ubereinstimmung wurde
■Hj das Mainzer Bild ebenfalls auf Adam van Noort getauft.
HHf Rooses glaubte sogar die Spuren einer Signatur zu erkennen.
Ich habe das Bild daraufhin genauest untersucht, konnte aber
trotz aller Bemühung nicht die Spur einer Signatur entdecken.
Fig. 19. Stich nach A. van Noort An Stelle der Porträtfigur findet sich eine Frau, die ihr Töch-
aus dem Leben der heil. Klara. terchen an der Hand führt, dahinter eine Frau mit einem
Säuglinge auf dem Arme. Wir bezweifeln vor allem, daß
das Mainzer Bild auch von Adam van Noort herrührt. Man vergleiche den Kopf Christi auf beiden
Bildern. Der Christus auf dem Brüssler Bilde entspricht in allen Zügen dem Christus auf dem Stiche
von Peter de Jode: Christus und Nikodemus (Fig. 9). Das schmale Gesicht mit dem spärlichen Bart-
wuchse, die sorgfältige Scheitelung des Haares, die runde Stirne, die scharfen, bis zur Nasenwurzel
herabgezogenen Brauen, die kleinen, etwas zwinkernden Augen, der scharfe Schatten auf Schläfe und
Wangen sind völlig identisch. In beiden Köpfen der gleiche, glatte, nichtssagende Ausdruck. Der
Christus auf dem Mainzer Bilde hat kräftigere, derbe Züge, das Gesicht gleichmäßig breit, die Brauen
kaum angedeutet, darunter ein Paar großer Augen mit einem leidvollen, schwermütigen Blicke.
Schon der Vergleich dieser beiden Kopftypen führt uns dazu, das Mainzer Bild als das ältere an-
zunehmen. Deutlicher noch wird die Kopistenarbeit durch die Wiedergabe der Figur des Johannes.
Auf dem Bilde in Mainz tritt der Jünger vor und streckt in einfachem Redegestus die beiden Arme vor,
als wollte er wie im Vorwurfe daraufhinweisen, daß die Weiber mit ihren Kindern kommen, um den
Herrn zu belästigen. Diese Bewegung der Hände mußte auf dem Brüssler Bilde, das wir als van Noort
erkannt haben, aus kompositionellen Gründen verändert werden. Denn da der Künstler die Darstellung
des Mainzer Bildes durch die angeführte Gruppe rechts erweiterte und als neues kompositionelles Moment