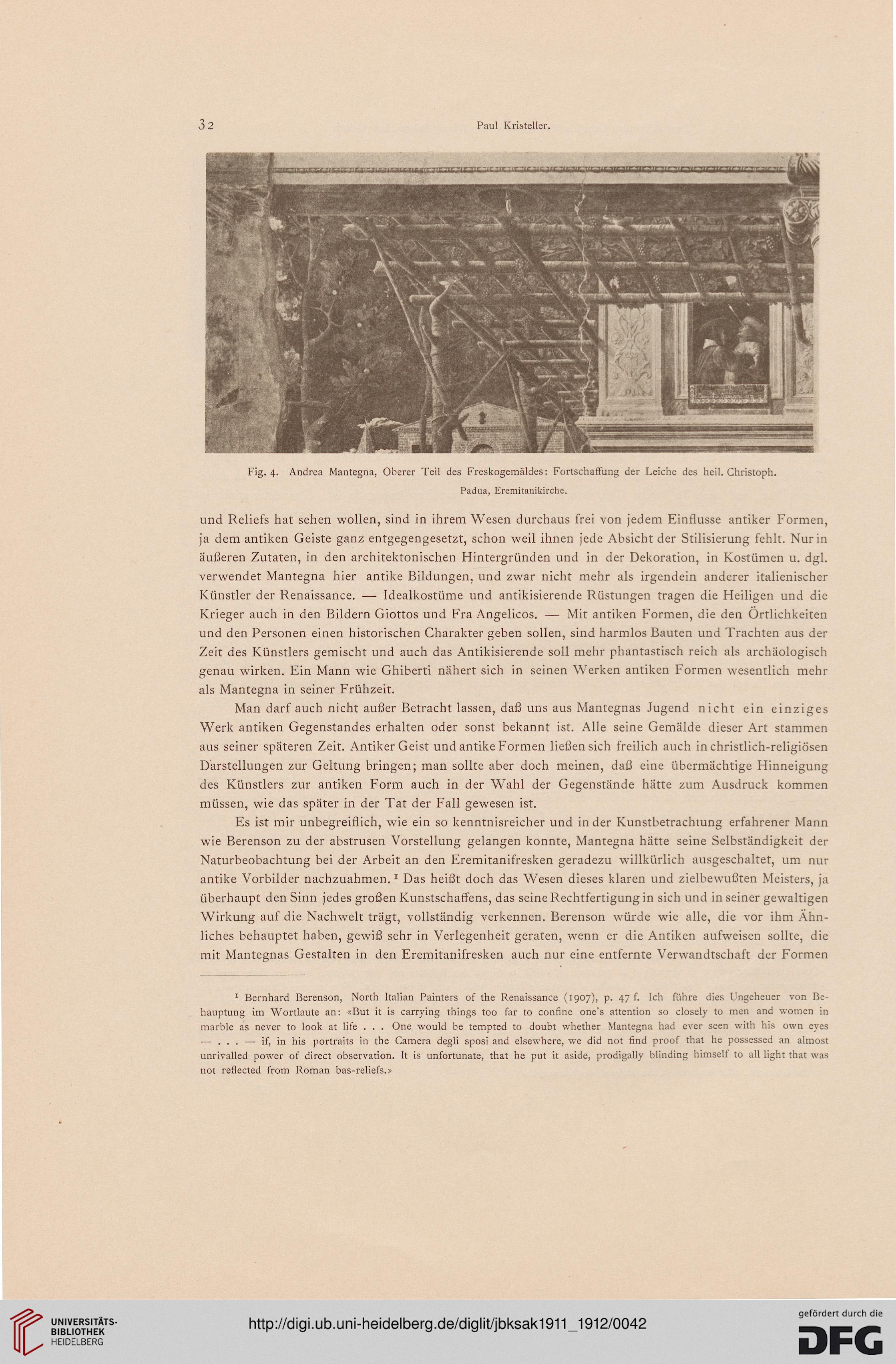32
Paul Kristeller.
Fig. 4. Andrea Mantegna, Oberer Teil des Freskogemäldes: Fortschaffung der Leiche des heil. Christoph.
Padua, Eremitanikirchc.
und Reliefs hat sehen wollen, sind in ihrem Wesen durchaus frei von jedem Einflüsse antiker Formen,
ja dem antiken Geiste ganz entgegengesetzt, schon weil ihnen jede Absicht der Stilisierung fehlt. Nur in
äußeren Zutaten, in den architektonischen Hintergründen und in der Dekoration, in Kostümen u. dgl.
verwendet Mantegna hier antike Bildungen, und zwar nicht mehr als irgendein anderer italienischer
Künstler der Renaissance. — Idealkostüme und antikisierende Rüstungen tragen die Heiligen und die
Krieger auch in den Bildern Giottos und Fra Angelicos. — Mit antiken Formen, die den Ortlichkeiten
und den Personen einen historischen Charakter geben sollen, sind harmlos Bauten und Trachten aus der
Zeit des Künstlers gemischt und auch das Antikisierende soll mehr phantastisch reich als archäologisch
genau wirken. Ein Mann wie Ghiberti nähert sich in seinen Werken antiken Formen wesentlich mehr
als Mantegna in seiner Frühzeit.
Man darf auch nicht außer Betracht lassen, daß uns aus Mantegnas Jugend nicht ein einziges
Werk antiken Gegenstandes erhalten oder sonst bekannt ist. Alle seine Gemälde dieser Art stammen
aus seiner späteren Zeit. Antiker Geist und antike F'ormen ließen sich freilich auch in christlich-religiösen
Darstellungen zur Geltung bringen; man sollte aber doch meinen, daß eine übermächtige Hinneigung
des Künstlers zur antiken Form auch in der Wahl der Gegenstände hätte zum Ausdruck kommen
müssen, wie das später in der Tat der Fall gewesen ist.
Es ist mir unbegreiflich, wie ein so kenntnisreicher und in der Kunstbetrachtung erfahrener Mann
wie Berenson zu der abstrusen Vorstellung gelangen konnte, Mantegna hätte seine Selbständigkeit der
Naturbeobachtung bei der Arbeit an den Eremitanifresken geradezu willkürlich ausgeschaltet, um nur
antike Vorbilder nachzuahmen.1 Das heißt doch das Wesen dieses klaren und zielbewußten Meisters, ja
überhaupt den Sinn jedes großen Kunstschaffens, das seine Rechtfertigung in sich und in seiner gewaltigen
Wirkung auf die Nachwelt trägt, vollständig verkennen. Berenson würde wie alle, die vor ihm Ahn-
liches behauptet haben, gewiß sehr in Verlegenheit geraten, wenn er die Antiken aufweisen sollte, die
mit Mantegnas Gestalten in den Eremitanifresken auch nur eine entfernte Verwandtschaft der Formen
1 Bernhard Berenson, North Italian Painters of the Renaissance (1907), p. 47 f. Ich führe dies Ungeheuer von Be-
hauptung im Wortlaute an: «But it is carrying things too far to confine one's attention so closely to men and women in
marble as never to look at life . . . One would be tempted to doubt whether Mantegna had ever seen with his own eyes
— ... — if, in his portraits in the Camera degli sposi and elsewhere, we did not find proof that he possessed an almost
unrivalled power of direct Observation. 1t is unfortunate, that he put it aside, prodigally blinding himself to all light that was
not reflected from Roman bas-reliefs.»
Paul Kristeller.
Fig. 4. Andrea Mantegna, Oberer Teil des Freskogemäldes: Fortschaffung der Leiche des heil. Christoph.
Padua, Eremitanikirchc.
und Reliefs hat sehen wollen, sind in ihrem Wesen durchaus frei von jedem Einflüsse antiker Formen,
ja dem antiken Geiste ganz entgegengesetzt, schon weil ihnen jede Absicht der Stilisierung fehlt. Nur in
äußeren Zutaten, in den architektonischen Hintergründen und in der Dekoration, in Kostümen u. dgl.
verwendet Mantegna hier antike Bildungen, und zwar nicht mehr als irgendein anderer italienischer
Künstler der Renaissance. — Idealkostüme und antikisierende Rüstungen tragen die Heiligen und die
Krieger auch in den Bildern Giottos und Fra Angelicos. — Mit antiken Formen, die den Ortlichkeiten
und den Personen einen historischen Charakter geben sollen, sind harmlos Bauten und Trachten aus der
Zeit des Künstlers gemischt und auch das Antikisierende soll mehr phantastisch reich als archäologisch
genau wirken. Ein Mann wie Ghiberti nähert sich in seinen Werken antiken Formen wesentlich mehr
als Mantegna in seiner Frühzeit.
Man darf auch nicht außer Betracht lassen, daß uns aus Mantegnas Jugend nicht ein einziges
Werk antiken Gegenstandes erhalten oder sonst bekannt ist. Alle seine Gemälde dieser Art stammen
aus seiner späteren Zeit. Antiker Geist und antike F'ormen ließen sich freilich auch in christlich-religiösen
Darstellungen zur Geltung bringen; man sollte aber doch meinen, daß eine übermächtige Hinneigung
des Künstlers zur antiken Form auch in der Wahl der Gegenstände hätte zum Ausdruck kommen
müssen, wie das später in der Tat der Fall gewesen ist.
Es ist mir unbegreiflich, wie ein so kenntnisreicher und in der Kunstbetrachtung erfahrener Mann
wie Berenson zu der abstrusen Vorstellung gelangen konnte, Mantegna hätte seine Selbständigkeit der
Naturbeobachtung bei der Arbeit an den Eremitanifresken geradezu willkürlich ausgeschaltet, um nur
antike Vorbilder nachzuahmen.1 Das heißt doch das Wesen dieses klaren und zielbewußten Meisters, ja
überhaupt den Sinn jedes großen Kunstschaffens, das seine Rechtfertigung in sich und in seiner gewaltigen
Wirkung auf die Nachwelt trägt, vollständig verkennen. Berenson würde wie alle, die vor ihm Ahn-
liches behauptet haben, gewiß sehr in Verlegenheit geraten, wenn er die Antiken aufweisen sollte, die
mit Mantegnas Gestalten in den Eremitanifresken auch nur eine entfernte Verwandtschaft der Formen
1 Bernhard Berenson, North Italian Painters of the Renaissance (1907), p. 47 f. Ich führe dies Ungeheuer von Be-
hauptung im Wortlaute an: «But it is carrying things too far to confine one's attention so closely to men and women in
marble as never to look at life . . . One would be tempted to doubt whether Mantegna had ever seen with his own eyes
— ... — if, in his portraits in the Camera degli sposi and elsewhere, we did not find proof that he possessed an almost
unrivalled power of direct Observation. 1t is unfortunate, that he put it aside, prodigally blinding himself to all light that was
not reflected from Roman bas-reliefs.»