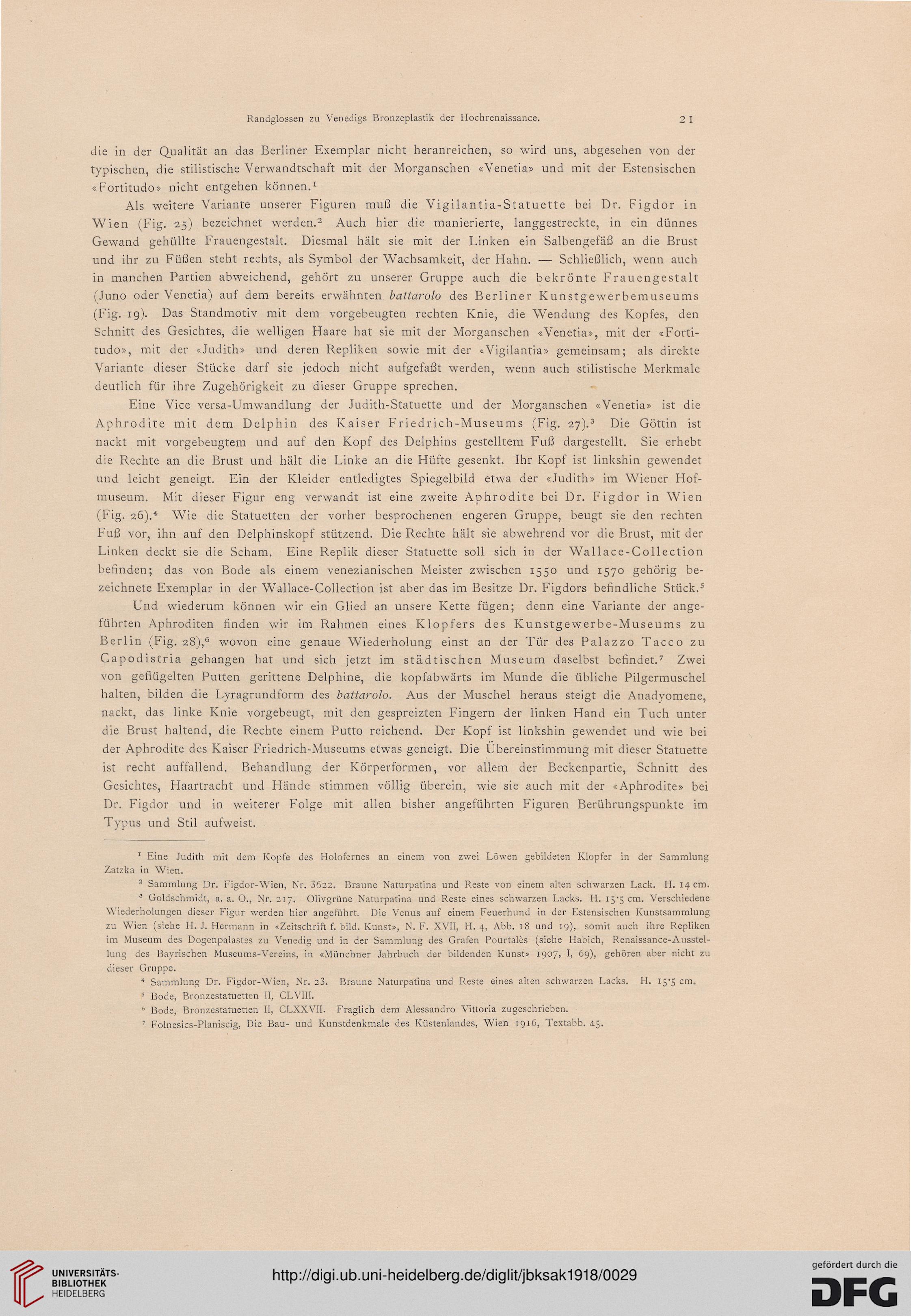Randglossen zu Venedigs Bronzeplastik der Hochrenaissance.
die in der Qualität an das Berliner Exemplar nicht heranreichen, so wird uns, abgesehen von der
typischen, die stilistische Verwandtschaft mit der Morganschen «Venetia» und mit der Estensischen
«Fortitudo» nicht entgehen können.1
Als weitere Variante unserer Figuren muß die Vigilantia-Statuette bei Dr. Figdor in
Wien (Fig. 25) bezeichnet werden.2 Auch hier die manierierte, langgestreckte, in ein dünnes
Gewand gehüllte Frauengestalt. Diesmal hält sie mit der Linken ein Salbengefäß an die Brust
und ihr zu Füßen steht rechts, als Symbol der Wachsamkeit, der Hahn. —■ Schließlich, wenn auch
in manchen Partien abweichend, gehört zu unserer Gruppe auch die bekrönte Frauengestalt
(Juno oder Venetia) auf dem bereits erwähnten battarolo des Berliner Kunstgewerbemuseums
(Fig. 19). Das Standmotiv mit dem vorgebeugten rechten Knie, die Wendung des Kopfes, den
Schnitt des Gesichtes, die welligen Haare hat sie mit der Morganschen «Venetia», mit der «Forti-
tudo», mit der «Judith» und deren Repliken sowie mit der «Vigilantia» gemeinsam; als direkte
Variante dieser Stücke darf sie jedoch nicht aufgefaßt werden, wenn auch stilistische Merkmale
deutlich für ihre Zugehörigkeit zu dieser Gruppe sprechen.
Eine Vice versa-Umwandlung der Judith-Statuette und der Morganschen «Venetia» ist die
Aphrodite mit dem Delphin des Kaiser Friedrich-Museums (Fig. 27).3 Die Göttin ist
nackt mit vorgebeugtem und auf den Kopf des Delphins gestelltem Fuß dargestellt. Sie erhebt
die Rechte an die Brust und hält die Linke an die Hüfte gesenkt. Ihr Kopf ist linkshin gewendet
und leicht geneigt. Ein der Kleider entledigtes Spiegelbild etwa der «Judith» im Wiener Hof-
museum. Mit dieser Figur eng verwandt ist eine zweite Aphrodite bei Dr. Figdor in Wien
(Fig. 26).4 Wie die Statuetten der vorher besprochenen engeren Gruppe, beugt sie den rechten
Fuß vor, ihn auf den Delphinskopf stützend. Die Rechte hält sie abwehrend vor die Brust, mit der
Linken deckt sie die Scham. Eine Replik dieser Statuette soll sich in der Wallace-Collection
befinden; das von Bode als einem venezianischen Meister zwischen 1550 und 1570 gehörig be-
zeichnete Exemplar in der Wallace-Collection ist aber das im Besitze Dr. Figdors befindliche Stück.5
Und wiederum können wir ein Glied an unsere Kette fügen; denn eine Variante der ange-
führten Aphroditen finden wir im Rahmen eines Klopfers des Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin (Fig. 28),6 wovon eine genaue Wiederholung einst an der Tür des Palazzo Tacco zu
Capodistria gehangen hat und sich jetzt im städtischen Museum daselbst befindet.7 Zwei
von geflügelten Putten gerittene Delphine, die kopfabwärts im Munde die übliche Pilgermuschel
halten, bilden die Lyragrundform des battarolo. Aus der Muschel heraus steigt die Anadvomene,
nackt, das linke Knie vorgebeugt, mit den gespreizten Fingern der linken Hand ein Tuch unter
die Brust haltend, die Rechte einem Putto reichend. Der Kopf ist linkshin gewendet und wie bei
der Aphrodite des Kaiser Friedrich-Museums etwas geneigt. Die Übereinstimmung mit dieser Statuette
ist recht auffallend. Behandlung der Körperformen, vor allem der Beckenpartie, Schnitt des
Gesichtes, Haartracht und Hände stimmen völlig überein, wie sie auch mit der «Aphrodite» bei
Dr. Figdor und in weiterer Folge mit allen bisher angeführten Figuren Berührungspunkte im
Typus und Stil aufweist.
1 Eine Judith mit dem Kopfe des Holofernes an einem von zwei Löwen gebildeten Klopfer in der Sammlung
Zatzka in Wien.
2 Sammlung Dr. Figdor-Wien, Nr. 3622. Braune Naturpatina und Reste von einem alten schwarzen Lack. H. 14 cm.
3 Goldschmidt, a.a.O., Nr. 217. Olivgrüne Naturpatina und Reste eines schwarzen Lacks. H. 15-5 cm. Verschiedene
Wiederholungen dieser Figur werden hier angeführt. Die Venus auf einem Feuerhund in der Estensischen Kunstsammlung
zu Wien (siehe H. J. Hermann in «Zeitschrift f. hild. Kunst», N. F. XVII, H. 4, Abb. 18 und 19), somit auch ihre Repliken
im Museum des Dogenpalastes zu Venedig und in der Sammlung des Grafen Pourtales (siehe Habich, Renaissance-Ausstel-
lung des Bayrischen Museums-Vereins, in «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst» 1907, I, 69), gehören aber nicht zu
dieser Gruppe.
* Sammlung Dr. Figdor-Wien, Nr. 23. Braune Naturpatina und Reste eines alten schwarzen Lacks. H. 15-5 cm.
3 Bode, Bronzestatuetten II, CLVIII.
6 Bode, Bronzestatuetten II, CLXXVI1. Fraglich dem Alessandro Vittoria zugeschrieben.
' Folnesics-Planiscig, Die Bau- und Kunstdenkmale des Küstenlandes, Wien 1916, Textabb. 45.
die in der Qualität an das Berliner Exemplar nicht heranreichen, so wird uns, abgesehen von der
typischen, die stilistische Verwandtschaft mit der Morganschen «Venetia» und mit der Estensischen
«Fortitudo» nicht entgehen können.1
Als weitere Variante unserer Figuren muß die Vigilantia-Statuette bei Dr. Figdor in
Wien (Fig. 25) bezeichnet werden.2 Auch hier die manierierte, langgestreckte, in ein dünnes
Gewand gehüllte Frauengestalt. Diesmal hält sie mit der Linken ein Salbengefäß an die Brust
und ihr zu Füßen steht rechts, als Symbol der Wachsamkeit, der Hahn. —■ Schließlich, wenn auch
in manchen Partien abweichend, gehört zu unserer Gruppe auch die bekrönte Frauengestalt
(Juno oder Venetia) auf dem bereits erwähnten battarolo des Berliner Kunstgewerbemuseums
(Fig. 19). Das Standmotiv mit dem vorgebeugten rechten Knie, die Wendung des Kopfes, den
Schnitt des Gesichtes, die welligen Haare hat sie mit der Morganschen «Venetia», mit der «Forti-
tudo», mit der «Judith» und deren Repliken sowie mit der «Vigilantia» gemeinsam; als direkte
Variante dieser Stücke darf sie jedoch nicht aufgefaßt werden, wenn auch stilistische Merkmale
deutlich für ihre Zugehörigkeit zu dieser Gruppe sprechen.
Eine Vice versa-Umwandlung der Judith-Statuette und der Morganschen «Venetia» ist die
Aphrodite mit dem Delphin des Kaiser Friedrich-Museums (Fig. 27).3 Die Göttin ist
nackt mit vorgebeugtem und auf den Kopf des Delphins gestelltem Fuß dargestellt. Sie erhebt
die Rechte an die Brust und hält die Linke an die Hüfte gesenkt. Ihr Kopf ist linkshin gewendet
und leicht geneigt. Ein der Kleider entledigtes Spiegelbild etwa der «Judith» im Wiener Hof-
museum. Mit dieser Figur eng verwandt ist eine zweite Aphrodite bei Dr. Figdor in Wien
(Fig. 26).4 Wie die Statuetten der vorher besprochenen engeren Gruppe, beugt sie den rechten
Fuß vor, ihn auf den Delphinskopf stützend. Die Rechte hält sie abwehrend vor die Brust, mit der
Linken deckt sie die Scham. Eine Replik dieser Statuette soll sich in der Wallace-Collection
befinden; das von Bode als einem venezianischen Meister zwischen 1550 und 1570 gehörig be-
zeichnete Exemplar in der Wallace-Collection ist aber das im Besitze Dr. Figdors befindliche Stück.5
Und wiederum können wir ein Glied an unsere Kette fügen; denn eine Variante der ange-
führten Aphroditen finden wir im Rahmen eines Klopfers des Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin (Fig. 28),6 wovon eine genaue Wiederholung einst an der Tür des Palazzo Tacco zu
Capodistria gehangen hat und sich jetzt im städtischen Museum daselbst befindet.7 Zwei
von geflügelten Putten gerittene Delphine, die kopfabwärts im Munde die übliche Pilgermuschel
halten, bilden die Lyragrundform des battarolo. Aus der Muschel heraus steigt die Anadvomene,
nackt, das linke Knie vorgebeugt, mit den gespreizten Fingern der linken Hand ein Tuch unter
die Brust haltend, die Rechte einem Putto reichend. Der Kopf ist linkshin gewendet und wie bei
der Aphrodite des Kaiser Friedrich-Museums etwas geneigt. Die Übereinstimmung mit dieser Statuette
ist recht auffallend. Behandlung der Körperformen, vor allem der Beckenpartie, Schnitt des
Gesichtes, Haartracht und Hände stimmen völlig überein, wie sie auch mit der «Aphrodite» bei
Dr. Figdor und in weiterer Folge mit allen bisher angeführten Figuren Berührungspunkte im
Typus und Stil aufweist.
1 Eine Judith mit dem Kopfe des Holofernes an einem von zwei Löwen gebildeten Klopfer in der Sammlung
Zatzka in Wien.
2 Sammlung Dr. Figdor-Wien, Nr. 3622. Braune Naturpatina und Reste von einem alten schwarzen Lack. H. 14 cm.
3 Goldschmidt, a.a.O., Nr. 217. Olivgrüne Naturpatina und Reste eines schwarzen Lacks. H. 15-5 cm. Verschiedene
Wiederholungen dieser Figur werden hier angeführt. Die Venus auf einem Feuerhund in der Estensischen Kunstsammlung
zu Wien (siehe H. J. Hermann in «Zeitschrift f. hild. Kunst», N. F. XVII, H. 4, Abb. 18 und 19), somit auch ihre Repliken
im Museum des Dogenpalastes zu Venedig und in der Sammlung des Grafen Pourtales (siehe Habich, Renaissance-Ausstel-
lung des Bayrischen Museums-Vereins, in «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst» 1907, I, 69), gehören aber nicht zu
dieser Gruppe.
* Sammlung Dr. Figdor-Wien, Nr. 23. Braune Naturpatina und Reste eines alten schwarzen Lacks. H. 15-5 cm.
3 Bode, Bronzestatuetten II, CLVIII.
6 Bode, Bronzestatuetten II, CLXXVI1. Fraglich dem Alessandro Vittoria zugeschrieben.
' Folnesics-Planiscig, Die Bau- und Kunstdenkmale des Küstenlandes, Wien 1916, Textabb. 45.