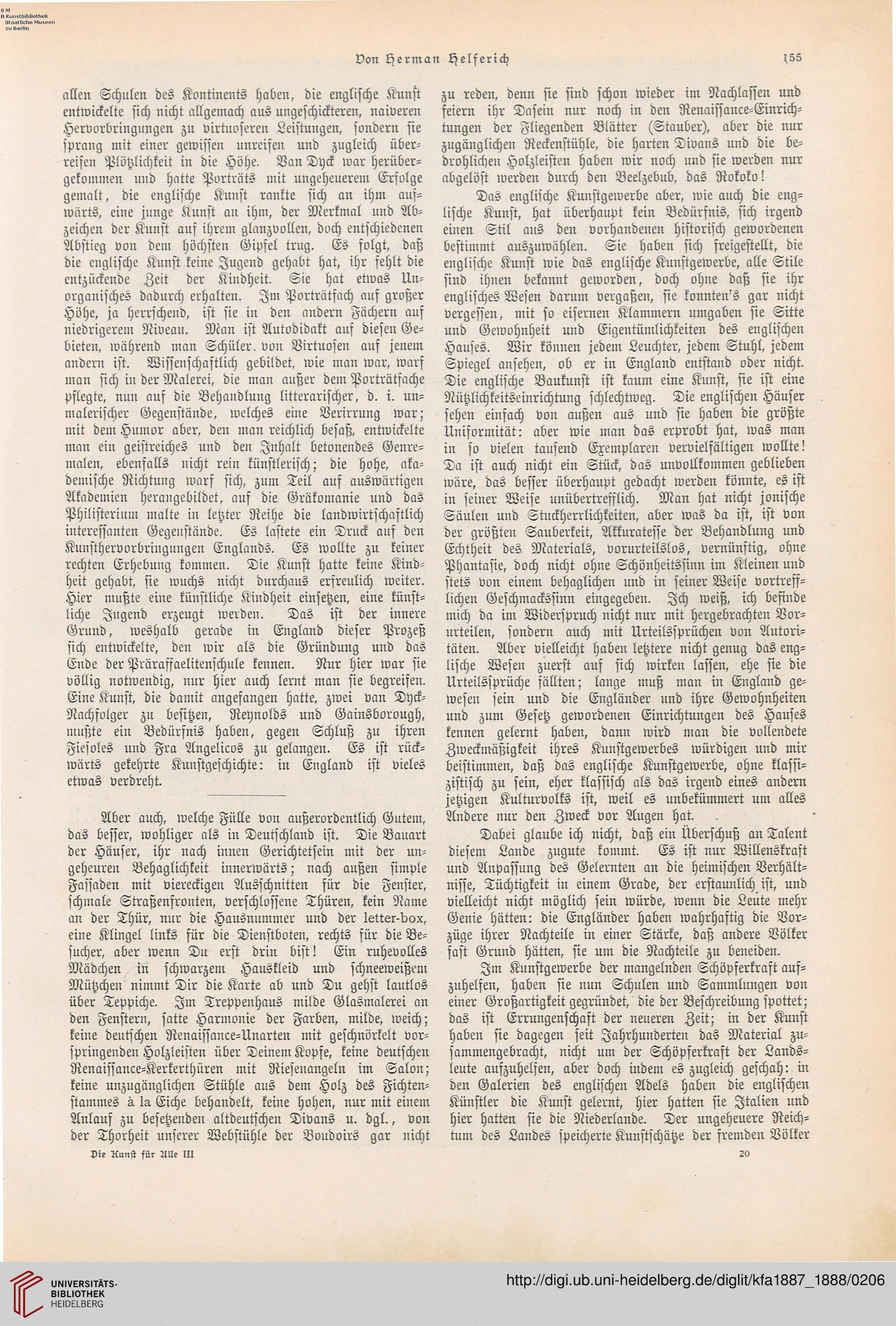von Herman Helferich
f55
allen Schulen des Kontinents haben, die englische Kunst
entwickelte sich nicht allgemach aus ungeschickteren, naiveren
Hervorbringungen zu virtuoseren Leistungen, sondern sie
sprang mit einer gewissen unreifen und zugleich über-
reifen Plötzlichkeit in die Höhe. Van Dyck war herüber-
gekommen und hatte Porträts mit ungeheuerem Erfolge
gemalt, die englische Kunst rankte sich an ihm auf-
wärts, eine junge Kunst an ihm, der Merkmal und Ab-
zeichen der Kunst auf ihrem glanzvollen, doch entschiedenen
Abstieg von dem höchsten Gipfel trug. Es folgt, daß
die englische Kunst keine Jugend gehabt hat, ihr fehlt die
entzückende Zeit der Kindheit. Sie hat etwas Un-
organisches dadurch erhalten. Im Porträtfach auf großer
Höhe, ja herrschend, ist sie in den andern Fächern auf
niedrigerem Niveau. Man ist Autodidakt auf diesen Ge-
bieten, während man Schüler, von Virtuosen auf jenem
andern ist. Wissenschaftlich gebildet, wie man war, warf
man sich in der Malerei, die man außer dem Porträtfache
pflegte, nun auf die Behandlung litterarischer, d. i. un-
malerischer Gegenstände, welches eine Verirrung war;
mit dem Humor aber, den man reichlich besaß, entwickelte
man ein geistreiches und den Inhalt betonendes Genre-
malen, ebenfalls nicht rein künstlerisch; die hohe, aka-
demische Richtung warf sich, zum Teil auf auswärtigen
Akademien herangebildet, auf die Gräkomanie und das
Philisterium malte in letzter Reihe die landwirtschaftlich
interessanten Gegenstände. Es lastete ein Druck auf den
Kunsthervorbringungen Englands. Es wollte zu keiner
rechten Erhebung kommen. Die Kunst hatte keine Kind-
heit gehabt, sie wuchs nicht durchaus erfreulich weiter.
Hier mußte eine künstliche Kindheit einsetzen, eine künst-
liche Jugend erzeugt werden. Das ist der innere
Grund, weshalb gerade in England dieser Prozeß
sich entwickelte, den wir als die Gründung und das
Ende der Präraffaelitenschule kennen. Nur hier war sie
völlig notwendig, nur hier auch lernt man sie begreifen.
Eine Kunst, die damit angefangen hatte, zwei van Dyck-
Nachfolger zu besitzen, Reynolds und Gainsborough,
mußte ein Bedürfnis haben, gegen Schluß zu ihren
Fiesoles und Fra Angelicos zu gelangen. Es ist rück-
wärts gekehrte Kunstgeschichte: in England ist vieles
etwas verdreht.
Aber auch, welche Fülle von außerordentlich Gutem,
das besser, wohliger als in Deutschland ist. Die Bauart
der Häuser, ihr nach innen Gerichtetsein mit der un-
geheuren Behaglichkeit innerwärts; nach außen simple
Fassaden mit viereckigen Ausschnitten für die Fenster,
schmale Straßenfronten, verschlossene Thüren, kein Name
an der Thür, nur die Hausnummer und der letter-box,
eine Klingel links für die Dienstboten, rechts für die Be-
sucher, aber wenn Du erst drin bist! Ein ruhevolles
Mädchen in schwarzem Hauskleid und schneeweißem
Mützchen nimmt Dir die Karte ab und Du gehst lautlos
über Teppiche. Im Treppenhaus milde Glasmalerei an
den Fenstern, satte Harmonie der Farben, milde, weich;
keine deutschen Renaissance-Unarten mit geschnörkelt vor-
springenden Holzleisten über Deinem Kopfe, keine deutschen
Renaissance-Kerkerthüren mit Riesenangeln im Salon;
keine unzugänglichen Stühle aus dem Holz des Fichten-
stammes ä In Eiche behandelt, keine hohen, nur mit einem
Anlauf zu besetzenden altdeutschen Divans u. dgl., von
der Thorheit unserer Webstühle der Boudoirs gar nicht
Ui- Nun« für Alle Ul
zu reden, denn sie sind schon wieder im Nachlassen und
feiern ihr Dasein nur noch in den Renaissance-Einrich-
tungen der Fliegenden Blätter (Stäuber), aber die nur
zugänglichen Reckenstühle, die harten Divans und die be-
drohlichen Holzleisten haben wir noch und sie werden nur
abgelöst werden durch den Beelzebub, das Rokoko!
Das englische Kunstgewerbe aber, wie auch die eng-
lische Kunst, hat überhaupt kein Bedürfnis, sich irgend
einen Stil aus den vorhandenen historisch gewordenen
bestimmt auszuwühlen. Sie haben sich freigestellt, die
englische Kunst wie das englische Kunstgewerbe, alle Stile
sind ihnen bekannt geworden, doch ohne daß sie ihr
englisches Wesen darum vergaßen, sie konnten's gar nicht
vergessen, mit so eisernen Klammern umgaben sie Sitte
und Gewohnheit und Eigentümlichkeiten des englischen
Hauses. Wir können jedem Leuchter, jedem Stuhl, jedem
Spiegel ansehen, ob er in England entstand oder nicht.
Die englische Baukunst ist kaum eine Kunst, sie ist eine
Nützlichkeitseinrichtung schlechtweg. Die englischen Häuser
sehen einfach von außen aus und sie haben die größte
Uniformität: aber wie man das erprobt hat, was man
in so vielen tausend Exemplaren vervielfältigen wollte!
Da ist auch nicht ein Stück, das unvollkommen geblieben
wäre, das besser überhaupt gedacht werden könnte, es ist
in seiner Weise unübertrefflich. Man hat nicht jonische
Säulen und Stuckherrlichkeiten, aber was da ist, ist von
der größten Sauberkeit, Akkuratesse der Behandlung und
Echtheit des Materials, vorurteilslos, vernünftig, ohne
Phantasie, doch nicht ohne Schönheitssinn im Kleinen und
stets von einem behaglichen und in seiner Weise vortreff-
lichen Geschmackssinn eingegeben. Ich weiß, ich befinde
mich da im Widerspruch nicht nur mit hergebrachten Vor-
urteilen, sondern auch mit Urteilssprüchen von Autori-
täten. Aber vielleicht haben letztere nicht genug das eng-
lische Wesen zuerst auf sich wirken lassen, ehe sie die
Urteilssprüche fällten; lange muß man in England ge-
wesen sein und die Engländer und ihre Gewohnheiten
und zum Gesetz gewordenen Einrichtungen des Hauses
kennen gelernt haben, dann wird man die vollendete
Zweckmäßigkeit ihres Kunstgewerbes würdigen und mir
beistimmen, daß das englische Kunstgewerbe, ohne klassi-
zistisch zu sein, eher klassisch als das irgend eines andern
jetzigen Kulturvolks ist, weil es unbekümmert um alles
Andere nur den Zweck vor Augen hat.
Dabei glaube ich nicht, daß ein Überschuß an Talent
diesem Lande zugute kommt. Es ist nur Willenskraft
und Anpassung des Gelernten an die heimischen Verhält-
nisse, Tüchtigkeit in einem Grade, der erstaunlich ist, und
vielleicht nicht möglich sein würde, wenn die Leute mehr
Genie hätten: die Engländer haben wahrhaftig die Vor-
züge ihrer Nachteile in einer Stärke, daß andere Völker
fast Grund hätten, sie um die Nachteile zu beneiden.
Im Kunstgewerbe der mangelnden Schöpferkraft auf-
zuhelfen, haben sie nun Schulen und Sammlungen von
einer Großartigkeit gegründet, die der Beschreibung spottet;
das ist Errungenschaft der neueren Zeit; in der Kunst
haben sie dagegen seit Jahrhunderten das Material zu-
sammengebracht, nicht um der Schöpferkraft der Lands-
leute aufzuhelfen, aber doch indem es zugleich geschah: in
den Galerien des englischen Adels haben die englischen
Künstler die Kunst gelernt, hier hatten sie Italien und
hier hatten sie die Niederlande. Der ungeheuere Reich-
tum des Landes speicherte Künstschätze der fremden Völker
ro
f55
allen Schulen des Kontinents haben, die englische Kunst
entwickelte sich nicht allgemach aus ungeschickteren, naiveren
Hervorbringungen zu virtuoseren Leistungen, sondern sie
sprang mit einer gewissen unreifen und zugleich über-
reifen Plötzlichkeit in die Höhe. Van Dyck war herüber-
gekommen und hatte Porträts mit ungeheuerem Erfolge
gemalt, die englische Kunst rankte sich an ihm auf-
wärts, eine junge Kunst an ihm, der Merkmal und Ab-
zeichen der Kunst auf ihrem glanzvollen, doch entschiedenen
Abstieg von dem höchsten Gipfel trug. Es folgt, daß
die englische Kunst keine Jugend gehabt hat, ihr fehlt die
entzückende Zeit der Kindheit. Sie hat etwas Un-
organisches dadurch erhalten. Im Porträtfach auf großer
Höhe, ja herrschend, ist sie in den andern Fächern auf
niedrigerem Niveau. Man ist Autodidakt auf diesen Ge-
bieten, während man Schüler, von Virtuosen auf jenem
andern ist. Wissenschaftlich gebildet, wie man war, warf
man sich in der Malerei, die man außer dem Porträtfache
pflegte, nun auf die Behandlung litterarischer, d. i. un-
malerischer Gegenstände, welches eine Verirrung war;
mit dem Humor aber, den man reichlich besaß, entwickelte
man ein geistreiches und den Inhalt betonendes Genre-
malen, ebenfalls nicht rein künstlerisch; die hohe, aka-
demische Richtung warf sich, zum Teil auf auswärtigen
Akademien herangebildet, auf die Gräkomanie und das
Philisterium malte in letzter Reihe die landwirtschaftlich
interessanten Gegenstände. Es lastete ein Druck auf den
Kunsthervorbringungen Englands. Es wollte zu keiner
rechten Erhebung kommen. Die Kunst hatte keine Kind-
heit gehabt, sie wuchs nicht durchaus erfreulich weiter.
Hier mußte eine künstliche Kindheit einsetzen, eine künst-
liche Jugend erzeugt werden. Das ist der innere
Grund, weshalb gerade in England dieser Prozeß
sich entwickelte, den wir als die Gründung und das
Ende der Präraffaelitenschule kennen. Nur hier war sie
völlig notwendig, nur hier auch lernt man sie begreifen.
Eine Kunst, die damit angefangen hatte, zwei van Dyck-
Nachfolger zu besitzen, Reynolds und Gainsborough,
mußte ein Bedürfnis haben, gegen Schluß zu ihren
Fiesoles und Fra Angelicos zu gelangen. Es ist rück-
wärts gekehrte Kunstgeschichte: in England ist vieles
etwas verdreht.
Aber auch, welche Fülle von außerordentlich Gutem,
das besser, wohliger als in Deutschland ist. Die Bauart
der Häuser, ihr nach innen Gerichtetsein mit der un-
geheuren Behaglichkeit innerwärts; nach außen simple
Fassaden mit viereckigen Ausschnitten für die Fenster,
schmale Straßenfronten, verschlossene Thüren, kein Name
an der Thür, nur die Hausnummer und der letter-box,
eine Klingel links für die Dienstboten, rechts für die Be-
sucher, aber wenn Du erst drin bist! Ein ruhevolles
Mädchen in schwarzem Hauskleid und schneeweißem
Mützchen nimmt Dir die Karte ab und Du gehst lautlos
über Teppiche. Im Treppenhaus milde Glasmalerei an
den Fenstern, satte Harmonie der Farben, milde, weich;
keine deutschen Renaissance-Unarten mit geschnörkelt vor-
springenden Holzleisten über Deinem Kopfe, keine deutschen
Renaissance-Kerkerthüren mit Riesenangeln im Salon;
keine unzugänglichen Stühle aus dem Holz des Fichten-
stammes ä In Eiche behandelt, keine hohen, nur mit einem
Anlauf zu besetzenden altdeutschen Divans u. dgl., von
der Thorheit unserer Webstühle der Boudoirs gar nicht
Ui- Nun« für Alle Ul
zu reden, denn sie sind schon wieder im Nachlassen und
feiern ihr Dasein nur noch in den Renaissance-Einrich-
tungen der Fliegenden Blätter (Stäuber), aber die nur
zugänglichen Reckenstühle, die harten Divans und die be-
drohlichen Holzleisten haben wir noch und sie werden nur
abgelöst werden durch den Beelzebub, das Rokoko!
Das englische Kunstgewerbe aber, wie auch die eng-
lische Kunst, hat überhaupt kein Bedürfnis, sich irgend
einen Stil aus den vorhandenen historisch gewordenen
bestimmt auszuwühlen. Sie haben sich freigestellt, die
englische Kunst wie das englische Kunstgewerbe, alle Stile
sind ihnen bekannt geworden, doch ohne daß sie ihr
englisches Wesen darum vergaßen, sie konnten's gar nicht
vergessen, mit so eisernen Klammern umgaben sie Sitte
und Gewohnheit und Eigentümlichkeiten des englischen
Hauses. Wir können jedem Leuchter, jedem Stuhl, jedem
Spiegel ansehen, ob er in England entstand oder nicht.
Die englische Baukunst ist kaum eine Kunst, sie ist eine
Nützlichkeitseinrichtung schlechtweg. Die englischen Häuser
sehen einfach von außen aus und sie haben die größte
Uniformität: aber wie man das erprobt hat, was man
in so vielen tausend Exemplaren vervielfältigen wollte!
Da ist auch nicht ein Stück, das unvollkommen geblieben
wäre, das besser überhaupt gedacht werden könnte, es ist
in seiner Weise unübertrefflich. Man hat nicht jonische
Säulen und Stuckherrlichkeiten, aber was da ist, ist von
der größten Sauberkeit, Akkuratesse der Behandlung und
Echtheit des Materials, vorurteilslos, vernünftig, ohne
Phantasie, doch nicht ohne Schönheitssinn im Kleinen und
stets von einem behaglichen und in seiner Weise vortreff-
lichen Geschmackssinn eingegeben. Ich weiß, ich befinde
mich da im Widerspruch nicht nur mit hergebrachten Vor-
urteilen, sondern auch mit Urteilssprüchen von Autori-
täten. Aber vielleicht haben letztere nicht genug das eng-
lische Wesen zuerst auf sich wirken lassen, ehe sie die
Urteilssprüche fällten; lange muß man in England ge-
wesen sein und die Engländer und ihre Gewohnheiten
und zum Gesetz gewordenen Einrichtungen des Hauses
kennen gelernt haben, dann wird man die vollendete
Zweckmäßigkeit ihres Kunstgewerbes würdigen und mir
beistimmen, daß das englische Kunstgewerbe, ohne klassi-
zistisch zu sein, eher klassisch als das irgend eines andern
jetzigen Kulturvolks ist, weil es unbekümmert um alles
Andere nur den Zweck vor Augen hat.
Dabei glaube ich nicht, daß ein Überschuß an Talent
diesem Lande zugute kommt. Es ist nur Willenskraft
und Anpassung des Gelernten an die heimischen Verhält-
nisse, Tüchtigkeit in einem Grade, der erstaunlich ist, und
vielleicht nicht möglich sein würde, wenn die Leute mehr
Genie hätten: die Engländer haben wahrhaftig die Vor-
züge ihrer Nachteile in einer Stärke, daß andere Völker
fast Grund hätten, sie um die Nachteile zu beneiden.
Im Kunstgewerbe der mangelnden Schöpferkraft auf-
zuhelfen, haben sie nun Schulen und Sammlungen von
einer Großartigkeit gegründet, die der Beschreibung spottet;
das ist Errungenschaft der neueren Zeit; in der Kunst
haben sie dagegen seit Jahrhunderten das Material zu-
sammengebracht, nicht um der Schöpferkraft der Lands-
leute aufzuhelfen, aber doch indem es zugleich geschah: in
den Galerien des englischen Adels haben die englischen
Künstler die Kunst gelernt, hier hatten sie Italien und
hier hatten sie die Niederlande. Der ungeheuere Reich-
tum des Landes speicherte Künstschätze der fremden Völker
ro