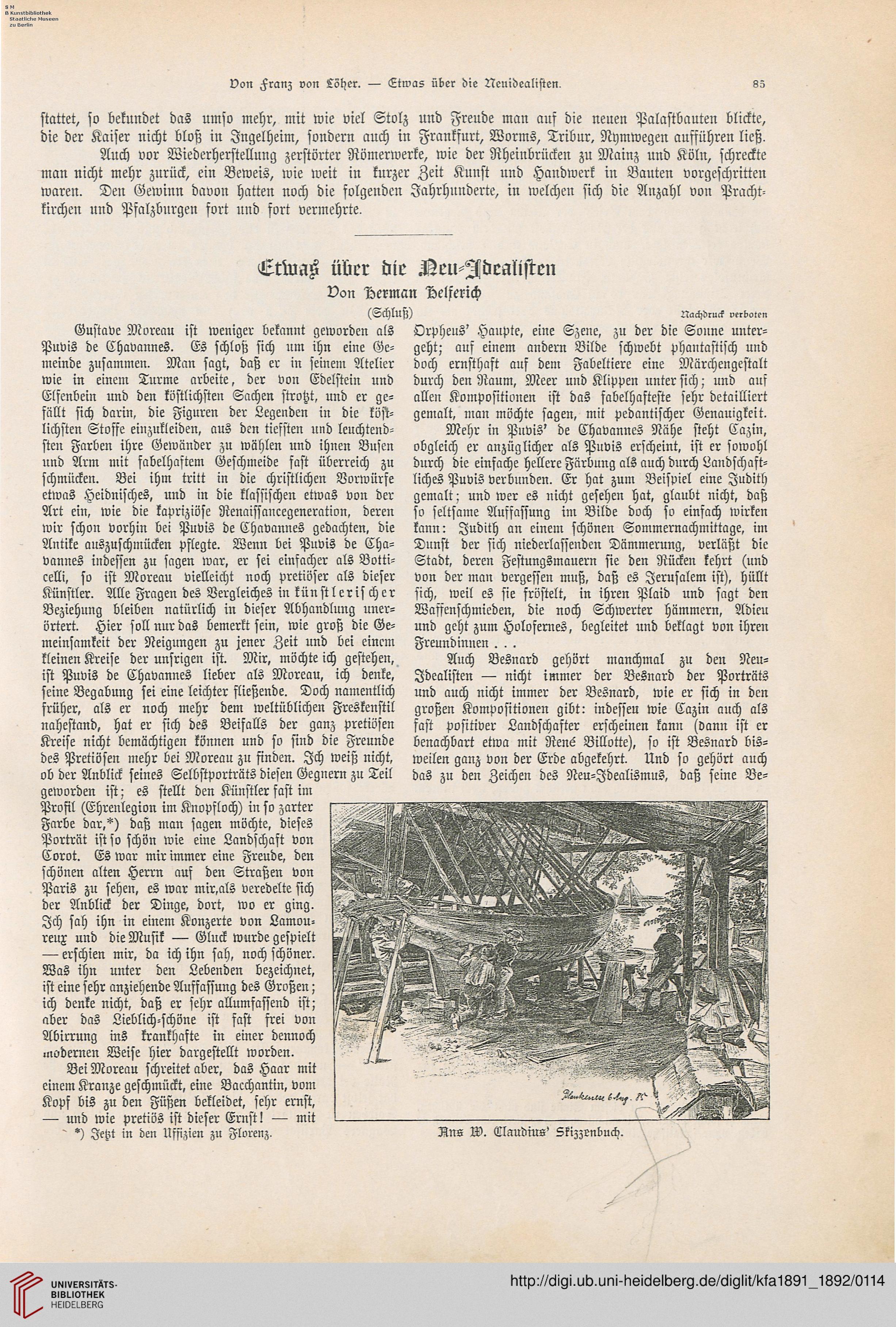von Franz von Löher. — Etwas über die Nenidealisten.
85
stattet, so bekundet das umso mehr, mit wie viel Stolz und Freude man auf die neuen Palastbauten blickte,
die der Kaiser nicht bloß in Ingelheim, sondern auch in Frankfurt, Worms, Tribur, Nymwegen aufführen ließ.
Auch vor Wiederherstellung zerstörter Römerwerke, wie der Rheinbrücken zu Mainz und Köln, schreckte
man nicht mehr zurück, ein Beweis, wie weit in kurzer Zeit Kunst und Handwerk in Bauten vorgeschritten
waren. Den Gewinn davon hatten noch die folgenden Jahrhunderte, in welchen sich die Anzahl von Pracht-
kirchen und Pfalzbnrgen fort und fort vermehrte.
LttväF uücr die Oeu-Wealifken
von Berman Beistrich
(Schluß)
Gustave Moreau ist weniger bekannt geworden als
Puvis de Chavannes. Es schloß sich um ihn eine Ge-
meinde zusammen. Man sagt, daß er in seinem Atelier
wie in einem Turme arbeite, der von Edelstein und
Elfenbein und den köstlichsten Sachen strotzt, und er ge-
fällt sich darin, die Figuren der Legenden in die köst-
lichsten Stoffe einzukleiden, aus den tiefsten und leuchtend-
sten Farben ihre Gewänder zu wählen und ihnen Busen
und Arm mit fabelhaftem Geschmeide fast überreich zu
schmücken. Bei ihm tritt in die christlichen Vorwürfe
etwas Heidnisches, und in die klassischen etwas von der
Art ein, wie die kapriziöse Renaissancegeneration, deren
wir schon vorhin bei Puvis de Chavannes gedachten, die
Antike auszuschmücken pflegte. Wenn bei Puvis de Cha-
vannes indessen zu sagen war, er sei einfacher als Botti-
celli, so ist Moreau vielleicht noch pretiöser als dieser
Künstler. Alle Fragen des Vergleiches in künstlerischer
Beziehung bleiben natürlich in dieser Abhandlung uner-
örtert. Hier soll nur das bemerkt sein, wie groß die Ge-
meinsamkeit der Neigungen zu jener Zeit und bei einem
kleinen Kreise der unsrigen ist. Mir, möchte ich gestehen,
ist Puvis de Chavannes lieber als Moreau, ich denke,
seine Begabung sei eine leichter fließende. Doch namentlich
früher, als er noch mehr dem weltüblichen Freskenstil
nahestand, hat er sich des Beifalls der ganz pretiösen
Kreise nicht bemächtigen können und so sind die Freunde
des Pretiösen mehr bei Moreau zu finden. Ich weiß nicht,
ob der Anblick seines Selbstporträts diesen Gegnern zu Teil
geworden ist; es stellt den Künstler fast im
Profil (Ehrenlegion im Knopfloch) in so zarter
Farbe dar,*) daß man sagen möchte, dieses
Porträt ist so schön wie eine Landschaft von
Corot. Es war mir immer eine Freude, den
schönen alten Herrn auf den Straßen von
Paris zu sehen, es war mir,als veredelte sich
der Anblick der Dinge, dort, wo er ging.
Ich sah ihn in einem Konzerte von Lamou-
reux und die Musik — Gluck wurde gespielt
— erschien mir, da ich ihn sah, noch schöner.
Was ihn unter den Lebenden bezeichnet,
ist eine sehr anziehende Auffassung des Großen;
ich denke nicht, daß er sehr allumfassend ist;
aber das Lieblich-schöne ist fast frei von
Abirrung ins krankhafte in einer dennoch
modernen Weise hier dargestellt worden.
Bei Moreau schreitet aber, das Haar mit
einem Kranze geschmückt, eine Bacchantin, vom
Kopf bis zu den Füßen bekleidet, sehr ernst,
— und wie pretiös ist dieser Ernst! — mit
" *) Jetzt in den Uffizien zu Florenz.
Orpheus' Haupte, eine Szene, zu der die Sonne unter-
geht; auf einem andern Bilde schwebt phantastisch und
doch ernsthaft auf dem Fabeltiere eine Märchengestalt
durch den Raum, Meer und Klippen unter sich; und auf
allen Kompositionen ist das fabelhafteste sehr detailliert
gemalt, man möchte sagen, mit pedantischer Genauigkeit.
Mehr in Puvis' de Chavannes Nähe steht Cazin,
obgleich er anzüglicher als Puvis erscheint, ist er sowohl
durch die einfache hellere Färbung als auch durch Landschaft-
liches Puvis verbunden. Er hat zum Beispiel eine Judith
gemalt; und wer es nicht gesehen hat, glaubt nicht, daß
so seltsame Auffassung im Bilde doch so einfach wirken
kann: Judith an einem schönen Sommernachmittage, im
Dunst der sich niederlassenden Dämmerung, verläßt die
Stadt, deren Festungsmauern sie den Rücken kehrt (und
von der man vergessen muß, daß es Jerusalem ist), hüllt
sich, weil es sie fröstelt, in ihren Plaid und sagt den
Waffenschmieden, die noch Schwerter hämmern, Adieu
und geht zum Holofernes, begleitet und beklagt von ihren
Freundinnen. . .
Auch Besnard gehört manchmal zu den Neu-
Jdealisten — nicht immer der Besnard der Porträts
und auch nicht immer der Besnard, wie er sich in den
großen Kompositionen gibt: indessen wie Cazin auch als
fast positiver Landschafter erscheinen kann (vann ist er
benachbart etwa mit Rens Billotte), so ist Besnard bis-
weilen ganz von der Erde abgekehrt. Und so gehört auch
das zu den Zeichen des Neu-Jdealismus, daß seine Be-
85
stattet, so bekundet das umso mehr, mit wie viel Stolz und Freude man auf die neuen Palastbauten blickte,
die der Kaiser nicht bloß in Ingelheim, sondern auch in Frankfurt, Worms, Tribur, Nymwegen aufführen ließ.
Auch vor Wiederherstellung zerstörter Römerwerke, wie der Rheinbrücken zu Mainz und Köln, schreckte
man nicht mehr zurück, ein Beweis, wie weit in kurzer Zeit Kunst und Handwerk in Bauten vorgeschritten
waren. Den Gewinn davon hatten noch die folgenden Jahrhunderte, in welchen sich die Anzahl von Pracht-
kirchen und Pfalzbnrgen fort und fort vermehrte.
LttväF uücr die Oeu-Wealifken
von Berman Beistrich
(Schluß)
Gustave Moreau ist weniger bekannt geworden als
Puvis de Chavannes. Es schloß sich um ihn eine Ge-
meinde zusammen. Man sagt, daß er in seinem Atelier
wie in einem Turme arbeite, der von Edelstein und
Elfenbein und den köstlichsten Sachen strotzt, und er ge-
fällt sich darin, die Figuren der Legenden in die köst-
lichsten Stoffe einzukleiden, aus den tiefsten und leuchtend-
sten Farben ihre Gewänder zu wählen und ihnen Busen
und Arm mit fabelhaftem Geschmeide fast überreich zu
schmücken. Bei ihm tritt in die christlichen Vorwürfe
etwas Heidnisches, und in die klassischen etwas von der
Art ein, wie die kapriziöse Renaissancegeneration, deren
wir schon vorhin bei Puvis de Chavannes gedachten, die
Antike auszuschmücken pflegte. Wenn bei Puvis de Cha-
vannes indessen zu sagen war, er sei einfacher als Botti-
celli, so ist Moreau vielleicht noch pretiöser als dieser
Künstler. Alle Fragen des Vergleiches in künstlerischer
Beziehung bleiben natürlich in dieser Abhandlung uner-
örtert. Hier soll nur das bemerkt sein, wie groß die Ge-
meinsamkeit der Neigungen zu jener Zeit und bei einem
kleinen Kreise der unsrigen ist. Mir, möchte ich gestehen,
ist Puvis de Chavannes lieber als Moreau, ich denke,
seine Begabung sei eine leichter fließende. Doch namentlich
früher, als er noch mehr dem weltüblichen Freskenstil
nahestand, hat er sich des Beifalls der ganz pretiösen
Kreise nicht bemächtigen können und so sind die Freunde
des Pretiösen mehr bei Moreau zu finden. Ich weiß nicht,
ob der Anblick seines Selbstporträts diesen Gegnern zu Teil
geworden ist; es stellt den Künstler fast im
Profil (Ehrenlegion im Knopfloch) in so zarter
Farbe dar,*) daß man sagen möchte, dieses
Porträt ist so schön wie eine Landschaft von
Corot. Es war mir immer eine Freude, den
schönen alten Herrn auf den Straßen von
Paris zu sehen, es war mir,als veredelte sich
der Anblick der Dinge, dort, wo er ging.
Ich sah ihn in einem Konzerte von Lamou-
reux und die Musik — Gluck wurde gespielt
— erschien mir, da ich ihn sah, noch schöner.
Was ihn unter den Lebenden bezeichnet,
ist eine sehr anziehende Auffassung des Großen;
ich denke nicht, daß er sehr allumfassend ist;
aber das Lieblich-schöne ist fast frei von
Abirrung ins krankhafte in einer dennoch
modernen Weise hier dargestellt worden.
Bei Moreau schreitet aber, das Haar mit
einem Kranze geschmückt, eine Bacchantin, vom
Kopf bis zu den Füßen bekleidet, sehr ernst,
— und wie pretiös ist dieser Ernst! — mit
" *) Jetzt in den Uffizien zu Florenz.
Orpheus' Haupte, eine Szene, zu der die Sonne unter-
geht; auf einem andern Bilde schwebt phantastisch und
doch ernsthaft auf dem Fabeltiere eine Märchengestalt
durch den Raum, Meer und Klippen unter sich; und auf
allen Kompositionen ist das fabelhafteste sehr detailliert
gemalt, man möchte sagen, mit pedantischer Genauigkeit.
Mehr in Puvis' de Chavannes Nähe steht Cazin,
obgleich er anzüglicher als Puvis erscheint, ist er sowohl
durch die einfache hellere Färbung als auch durch Landschaft-
liches Puvis verbunden. Er hat zum Beispiel eine Judith
gemalt; und wer es nicht gesehen hat, glaubt nicht, daß
so seltsame Auffassung im Bilde doch so einfach wirken
kann: Judith an einem schönen Sommernachmittage, im
Dunst der sich niederlassenden Dämmerung, verläßt die
Stadt, deren Festungsmauern sie den Rücken kehrt (und
von der man vergessen muß, daß es Jerusalem ist), hüllt
sich, weil es sie fröstelt, in ihren Plaid und sagt den
Waffenschmieden, die noch Schwerter hämmern, Adieu
und geht zum Holofernes, begleitet und beklagt von ihren
Freundinnen. . .
Auch Besnard gehört manchmal zu den Neu-
Jdealisten — nicht immer der Besnard der Porträts
und auch nicht immer der Besnard, wie er sich in den
großen Kompositionen gibt: indessen wie Cazin auch als
fast positiver Landschafter erscheinen kann (vann ist er
benachbart etwa mit Rens Billotte), so ist Besnard bis-
weilen ganz von der Erde abgekehrt. Und so gehört auch
das zu den Zeichen des Neu-Jdealismus, daß seine Be-