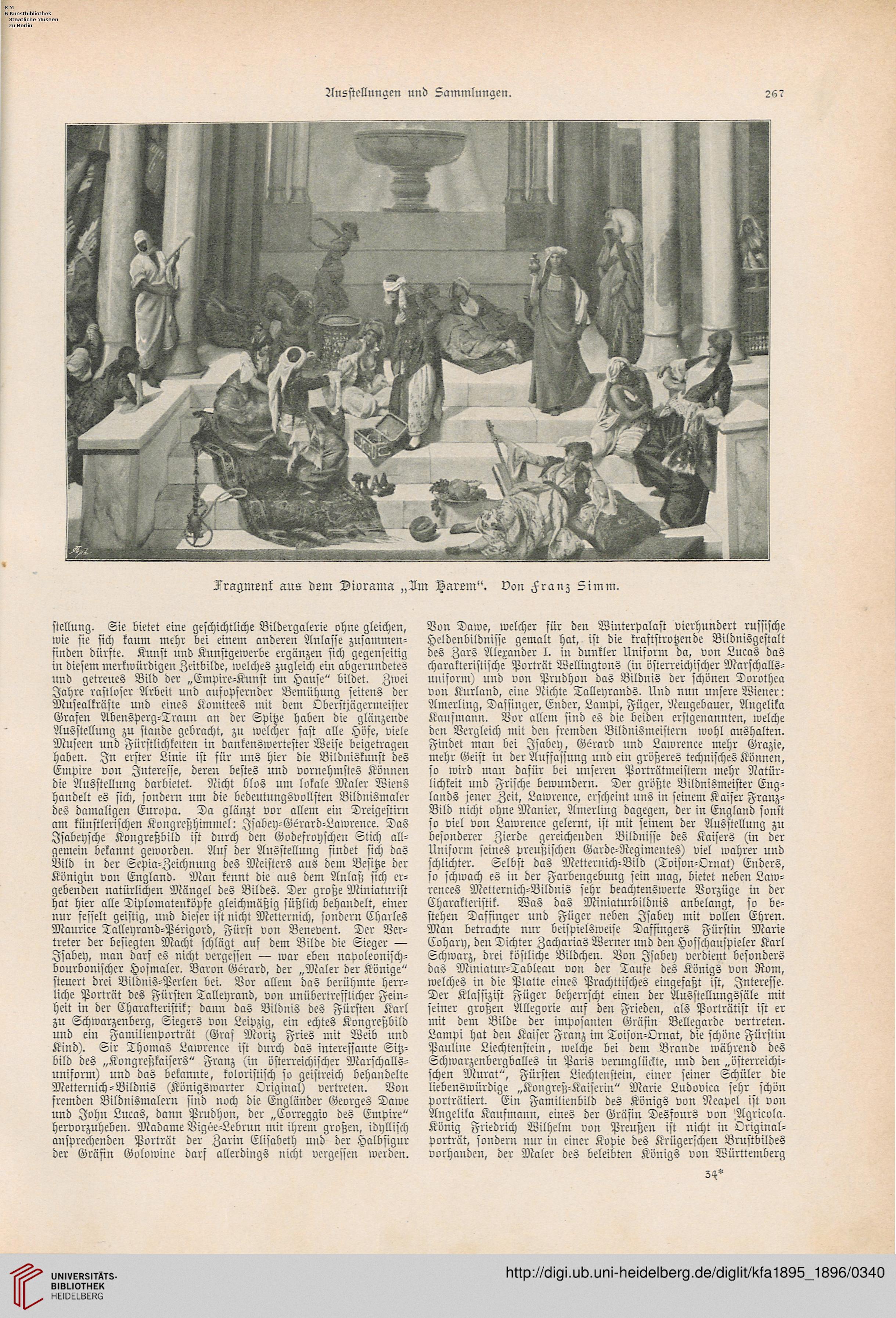Ausstellungen und Sammlungen.
267
stellung. Sie bietet eine geschichtliche Bildergalerie ohne gleichen,
wie sie sich kaum mehr bei einem anderen Anlasse zusammen-
finden dürfte. Kunst und Kunstgewerbe ergänzen sich gegenseitig
in diesem merkwürdigen Zeitbilde, welches zugleich ein abgerundetes
und getreues Bild der „Empire-Kunst im Hause" bildet. Zwei
Jahre rastloser Arbeit und aufopfernder Bemühung seitens der
Musealkräfte und eines Komitees mit dem Oberstjägermeister
Grafen Abensperg-Traun an der Spitze haben die glänzende
Ausstellung zu stände gebracht, zu welcher fast alle Höfe, viele
Museen und Fürstlichkeiten in dankenswertester Weise beigetragen
haben. In erster Linie ist für uns hier die Bildniskunst des
Empire von Interesse, deren bestes und vornehmstes Können
die Ausstellung darbietet. Nicht blos um lokale Maler Wiens
handelt es sich, sondern um die bedeutungsvollsten Bildnismaler
des damaligen Europa. Da glänzt vor allem ein Dreigestirn
am künstlerischen Kongreßhimmel: Jsabey-Gerard-Lawrence. Das
Jsabeysche Kongreßbild ist durch den Godefroyscheu Stich all-
gemein bekannt geworden. Auf der Ausstellung findet sich das
Bild in der Sepia-Zeichnung des Meisters aus dem Besitze der
Königin von England. Man kennt die aus dem Anlaß sich er-
gebenden natürlichen Mängel des Bildes. Der große Miniaturist
hat hier alle Diplomatenköpfe gleichmäßig süßlich behandelt, einer
nur fesselt geistig, und dieser ist nicht Metternich, sondern Charles
Maurice Talleyrand-Perigord, Fürst von Benevent. Der Ver-
treter der besiegten Macht schlägt auf dem Bilde die Sieger —
Jsabey, man darf es nicht vergessen — war eben napoleonisch-
bourbonischer Hofmaler. Baron Gerard, der „Maler der Könige"
steuert drei Bildnis-Perlen bei. Vor allem das berühmte herr-
liche Porträt des Fürsten Talleyrand, von unübertrefflicher Fein-
heit in der Charakteristik; daun das Bildnis des Fürsten Karl
zu Schwarzenberg, Siegers von Leipzig, ein echtes Kongreßbild
und ein Familienporträt (Graf Moriz Fries mit Weib und
Kind). Sir Thomas Lawrence ist durch das interessante Sitz-
bild des „Kongreßkaisers" Franz (in österreichischer Marschalls-
uniform) und das bekannte, koloristisch so geistreich behandelte
Metternich-Bildnis (Königswarter Original) vertreten. Von
fremden Bildnismalern sind noch die Engländer Georges Dawe
und John Lucas, dann Prudhon, der „Correggio des Empire"
hervorzuheben. Madame Vigoe-Lebrun mir ihrem großen, idyllisch
ansprechenden Porträt der Zarin Elisabeth und der Halbsigur
der Gräfin Golowine darf allerdings nicht vergessen werden.
Von Dawe, welcher für den Winterpalast vierhundert russische
Heldenbildnisse gemalt hat, ist die kraftstrotzende Bildnisgestalt
des Zars Alexander l. in dunkler Uniform da, von Lucas das
charakteristische Porträt Wellingtons (in österreichischer Marschalls-
uniform) und von Prudhon das Bildnis der schönen Dorothea
von Kurland, eine Nichte Talleyrands. Und nun unsere Wiener:
Amerling, Dasfinger, Ender, Lampi, Füger, Neugebauer, Angelika
Kaufmann. Vor allem sind es die beiden erstgenannten, welche
den Vergleich mit den fremden Bildnismeistern wohl aushalten.
Findet man bei Jsabey, Gerard und Lawrence mehr Grazie,
mehr Geist in der Auffassung und ein größeres technisches Können,
so wird man dafür bei unseren Porträtmeistern mehr Natür-
lichkeit und Frische bewundern. Der größte Bildnismeister Eng-
lands jener Zeit, Lawrence, erscheint uns in seinem Kaiser Franz-
Bild nicht ohne Manier, Amerling dagegen, der in England sonst
so viel von Lawrence gelernt, ist mit seinem der Ausstellung zu
besonderer Zierde gereichenden Bildnisse des Kaisers (in der
Uniform seines preußischen Garde-Regimentes) viel wahrer und
schlichter. Selbst das Metternich-Bild (Toison-Ornat) Enders,
so schwach es in der Farbengebung sein mag, bietet neben Law-
rences Metternich-Bildnis sehr beachtenswerte Vorzüge in der
Charakteristik. Was das Miniaturbildnis anbelangt, so be-
stehen Daffinger und Füger neben Jsabey mit vollen Ehren.
Man betrachte nur beispielsweise Daffingers Fürstin Marie
Cohary, den Dichter Zacharias Werner und den Hosschauspieler Karl
Schwarz, drei köstliche Bildchen. Von Jsabey verdient besonders
das Mmiatur-Tableau von der Taufe des Königs von Rom,
welches in die Platte eines Prachttisches eingefaßt ist, Interesse.
Der Klassizist Füger beherrscht einen der Ausstellungssäle mit
seiner großen Allegorie auf den Frieden, als Porträtist ist er
mit dem Bilde der imposanten Gräfin Bellegarde vertreten.
Lampi hat den Kaiser Franz im Toison-Ornat, die schöne Fürstin
Pauline Liechtenstein, welche bei dem Brande während des
Schwarzenbergballes in Paris verunglückte, und den „österreichi-
schen Murat", Fürsten Liechtenstein, einer seiner Schüler die
liebenswürdige „Kongreß-Kaiserin" Marie Ludovica sehr schön
porträtiert. Ein Familienbild des Königs von Neapel ist von
Angelika Kaufmann, eines der Gräfin Desfours von Mgricola.
König Friedrich Wilhelm von Preußen ist nicht in Original-
porträt, sondern nur in einer Kopie des Krügerschen Brustbildes
vorhanden, der Maler des beleibten Königs von Württemberg
267
stellung. Sie bietet eine geschichtliche Bildergalerie ohne gleichen,
wie sie sich kaum mehr bei einem anderen Anlasse zusammen-
finden dürfte. Kunst und Kunstgewerbe ergänzen sich gegenseitig
in diesem merkwürdigen Zeitbilde, welches zugleich ein abgerundetes
und getreues Bild der „Empire-Kunst im Hause" bildet. Zwei
Jahre rastloser Arbeit und aufopfernder Bemühung seitens der
Musealkräfte und eines Komitees mit dem Oberstjägermeister
Grafen Abensperg-Traun an der Spitze haben die glänzende
Ausstellung zu stände gebracht, zu welcher fast alle Höfe, viele
Museen und Fürstlichkeiten in dankenswertester Weise beigetragen
haben. In erster Linie ist für uns hier die Bildniskunst des
Empire von Interesse, deren bestes und vornehmstes Können
die Ausstellung darbietet. Nicht blos um lokale Maler Wiens
handelt es sich, sondern um die bedeutungsvollsten Bildnismaler
des damaligen Europa. Da glänzt vor allem ein Dreigestirn
am künstlerischen Kongreßhimmel: Jsabey-Gerard-Lawrence. Das
Jsabeysche Kongreßbild ist durch den Godefroyscheu Stich all-
gemein bekannt geworden. Auf der Ausstellung findet sich das
Bild in der Sepia-Zeichnung des Meisters aus dem Besitze der
Königin von England. Man kennt die aus dem Anlaß sich er-
gebenden natürlichen Mängel des Bildes. Der große Miniaturist
hat hier alle Diplomatenköpfe gleichmäßig süßlich behandelt, einer
nur fesselt geistig, und dieser ist nicht Metternich, sondern Charles
Maurice Talleyrand-Perigord, Fürst von Benevent. Der Ver-
treter der besiegten Macht schlägt auf dem Bilde die Sieger —
Jsabey, man darf es nicht vergessen — war eben napoleonisch-
bourbonischer Hofmaler. Baron Gerard, der „Maler der Könige"
steuert drei Bildnis-Perlen bei. Vor allem das berühmte herr-
liche Porträt des Fürsten Talleyrand, von unübertrefflicher Fein-
heit in der Charakteristik; daun das Bildnis des Fürsten Karl
zu Schwarzenberg, Siegers von Leipzig, ein echtes Kongreßbild
und ein Familienporträt (Graf Moriz Fries mit Weib und
Kind). Sir Thomas Lawrence ist durch das interessante Sitz-
bild des „Kongreßkaisers" Franz (in österreichischer Marschalls-
uniform) und das bekannte, koloristisch so geistreich behandelte
Metternich-Bildnis (Königswarter Original) vertreten. Von
fremden Bildnismalern sind noch die Engländer Georges Dawe
und John Lucas, dann Prudhon, der „Correggio des Empire"
hervorzuheben. Madame Vigoe-Lebrun mir ihrem großen, idyllisch
ansprechenden Porträt der Zarin Elisabeth und der Halbsigur
der Gräfin Golowine darf allerdings nicht vergessen werden.
Von Dawe, welcher für den Winterpalast vierhundert russische
Heldenbildnisse gemalt hat, ist die kraftstrotzende Bildnisgestalt
des Zars Alexander l. in dunkler Uniform da, von Lucas das
charakteristische Porträt Wellingtons (in österreichischer Marschalls-
uniform) und von Prudhon das Bildnis der schönen Dorothea
von Kurland, eine Nichte Talleyrands. Und nun unsere Wiener:
Amerling, Dasfinger, Ender, Lampi, Füger, Neugebauer, Angelika
Kaufmann. Vor allem sind es die beiden erstgenannten, welche
den Vergleich mit den fremden Bildnismeistern wohl aushalten.
Findet man bei Jsabey, Gerard und Lawrence mehr Grazie,
mehr Geist in der Auffassung und ein größeres technisches Können,
so wird man dafür bei unseren Porträtmeistern mehr Natür-
lichkeit und Frische bewundern. Der größte Bildnismeister Eng-
lands jener Zeit, Lawrence, erscheint uns in seinem Kaiser Franz-
Bild nicht ohne Manier, Amerling dagegen, der in England sonst
so viel von Lawrence gelernt, ist mit seinem der Ausstellung zu
besonderer Zierde gereichenden Bildnisse des Kaisers (in der
Uniform seines preußischen Garde-Regimentes) viel wahrer und
schlichter. Selbst das Metternich-Bild (Toison-Ornat) Enders,
so schwach es in der Farbengebung sein mag, bietet neben Law-
rences Metternich-Bildnis sehr beachtenswerte Vorzüge in der
Charakteristik. Was das Miniaturbildnis anbelangt, so be-
stehen Daffinger und Füger neben Jsabey mit vollen Ehren.
Man betrachte nur beispielsweise Daffingers Fürstin Marie
Cohary, den Dichter Zacharias Werner und den Hosschauspieler Karl
Schwarz, drei köstliche Bildchen. Von Jsabey verdient besonders
das Mmiatur-Tableau von der Taufe des Königs von Rom,
welches in die Platte eines Prachttisches eingefaßt ist, Interesse.
Der Klassizist Füger beherrscht einen der Ausstellungssäle mit
seiner großen Allegorie auf den Frieden, als Porträtist ist er
mit dem Bilde der imposanten Gräfin Bellegarde vertreten.
Lampi hat den Kaiser Franz im Toison-Ornat, die schöne Fürstin
Pauline Liechtenstein, welche bei dem Brande während des
Schwarzenbergballes in Paris verunglückte, und den „österreichi-
schen Murat", Fürsten Liechtenstein, einer seiner Schüler die
liebenswürdige „Kongreß-Kaiserin" Marie Ludovica sehr schön
porträtiert. Ein Familienbild des Königs von Neapel ist von
Angelika Kaufmann, eines der Gräfin Desfours von Mgricola.
König Friedrich Wilhelm von Preußen ist nicht in Original-
porträt, sondern nur in einer Kopie des Krügerschen Brustbildes
vorhanden, der Maler des beleibten Königs von Württemberg