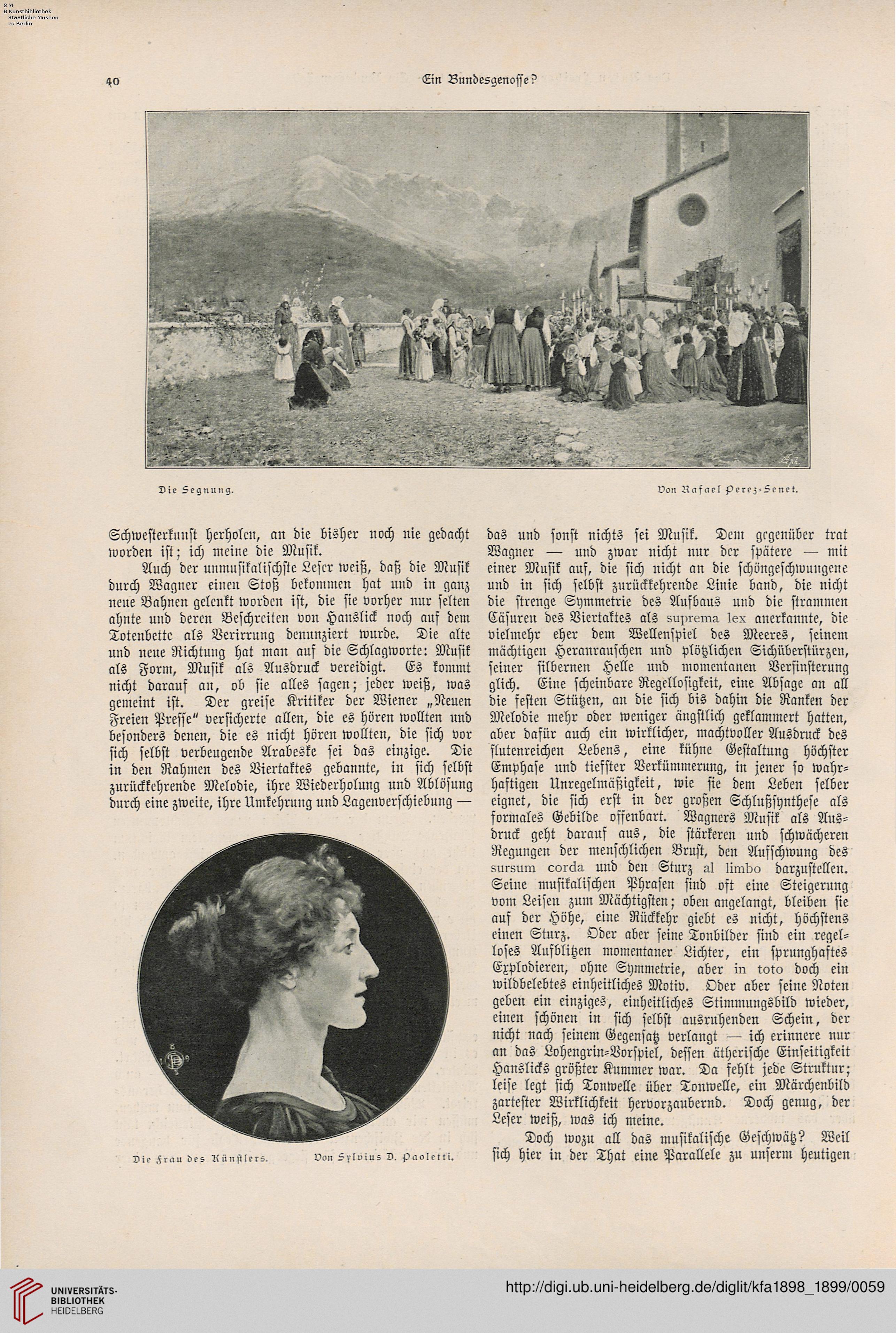Schwesterkunst herholcu, an die bisher noch nie gedacht
worden ist; ich meine die Musik.
Auch der unmusikalischste Leser weiß, daß die Musik
durch Wagner einen Stoß bekommen hat und in ganz
neue Bahnen gelenkt worden ist, die sie vorher nur selten
ahnte und deren Beschrcitcn von Hanslick noch auf dem
Totenbette als Verirrung denunziert wurde. Die alte
und neue Richtung hat man auf die Schlagworte: Musik
als Form, Musik als Ausdruck vereidigt. Es kommt
nicht darauf an, ob sie alles sagen; jeder weiß, was
gemeint ist. Der greise Kritiker der Wiener „Neuen
Freien Presse" versicherte allen, die es hören wollten und
besonders denen, die es nicht hören wollten, die sich vor
sich selbst verbeugende Arabeske sei das einzige. Die
in den Rahmen des Viertaktes gebannte, in sich selbst
zurückkehrende Melodie, ihre Wiederholung und Ablösung
durch eine zweite, ihre Umkehrung und Lagenverschiebung —
das und sonst nichts sei Musik. Dem gegenüber trat
Wagner — und zwar nicht nur der spätere — mit
einer Musik auf, die sich nicht an die schöngeschwungene
und in sich selbst zurückkehrende Linie band, die nicht
die strenge Symmetrie des Aufbaus und die strammen
Cäsuren des Viertaktes als supreina lex anerkannte, die
vielmehr eher dem Wellenspiel des Meeres, seinem
mächtigen Heranrauschen und plötzlichen Sichüberstürzen,
seiner silbernen Helle und momentanen Verfinsterung
glich. Eine scheinbare Regellosigkeit, eine Absage an all
die festen Stützen, an die sich bis dahin die Ranken der
Melodie mehr oder weniger ängstlich geklammert hatten,
aber dafür auch ein wirklicher, machtvoller Ausdruck des
flutenreichen Lebens, eine kühne Gestaltung höchster
Emphase und tiefster Verkümmerung, in jener so wahr-
haftigen Unregelmäßigkeit, wie sie dem Leben selber
eignet, die sich erst in der großen Schlußsynthese als
formales Gebilde offenbart. Wagners Musik als Aus-
druck geht darauf aus, die stärkeren und schwächeren
Regungen der menschlichen Brust, den Aufschwung des
sursum coicla und den Sturz al Iiml>c> darzustellen.
Seine musikalischen Phrasen sind oft eine Steigerung
vom Leisen zum Mächtigsten; oben angelangt, bleiben sie
auf der Höhe, eine Rückkehr giebt es nicht, höchstens
einen Sturz. Oder aber seine Tonbilder sind ein regel-
loses Aufblitzen momentaner Lichter, ein sprunghaftes
Explodieren, ohne Symmetrie, aber in toto doch ein
wildbelebtes einheitliches Motiv. Oder aber seine Noten
geben ein einziges, einheitliches Stimmungsbild wieder,
einen schönen in sich selbst ausruhenden Schein, der
nicht nach seinem Gegensatz verlangt — ich erinnere nur
an das Lohengrin-Vorspiel, dessen ätherische Einseitigkeit
Hanslicks größter Kummer war. Da fehlt jede Struktur;
leise legt sich Tonwelle über Tonwelle, ein Märchenbild
zartester Wirklichkeit hervorzaubernd. Doch genug, der
Leser weiß, was ich meine.
Doch wozu all das musikalische Geschwätz? Weil
sich hier in der That eine Parallele zu unserm heutigen