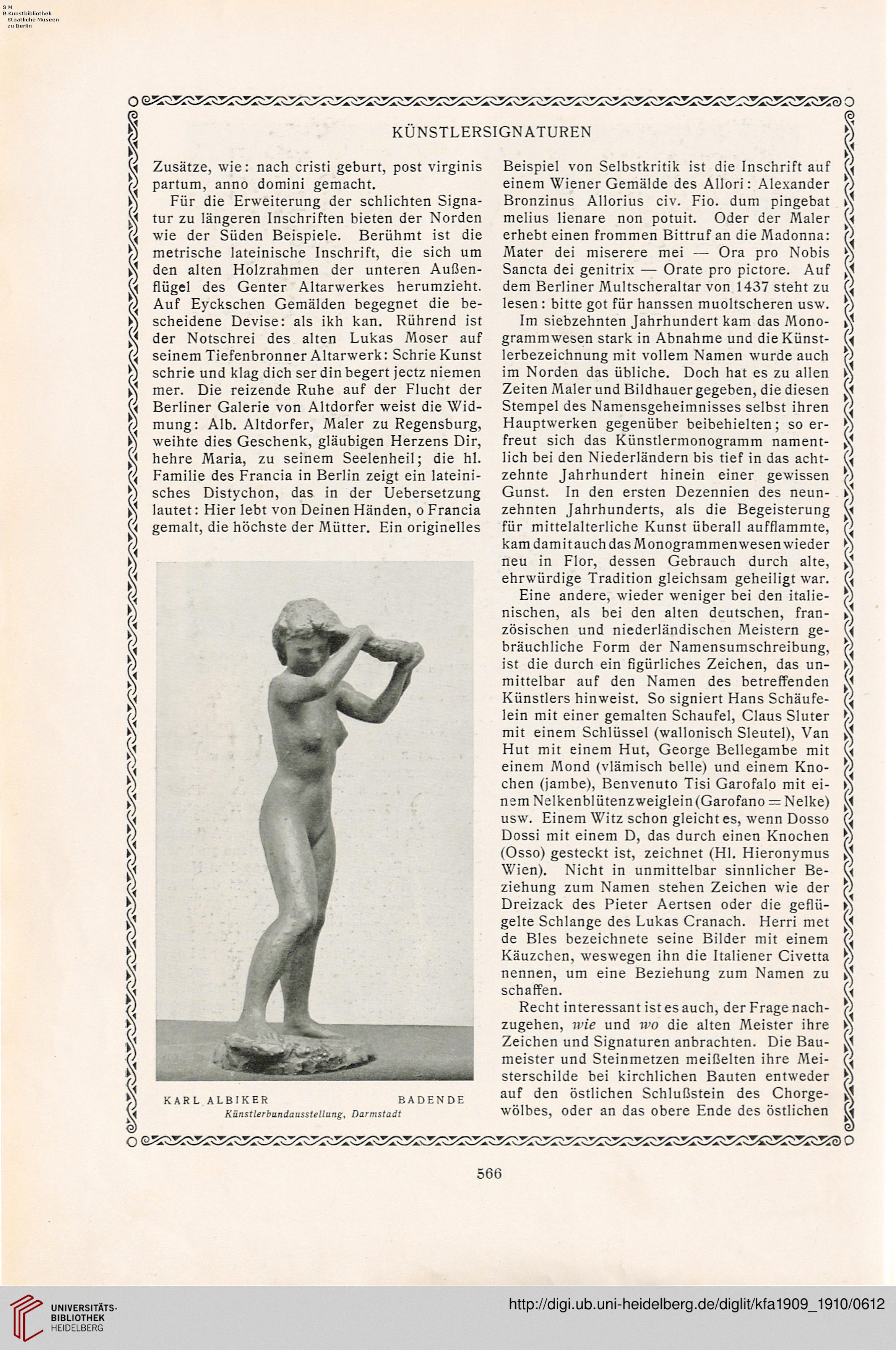KÜNSTLERSIGNATUREN
Zusätze, wie: nach cristi geburt, post virginis
partum, anno domini gemacht.
Für die Erweiterung der schlichten Signa-
tur zu längeren Inschriften bieten der Norden
wie der Süden Beispiele. Berühmt ist die
metrische lateinische Inschrift, die sich um
den alten Holzrahmen der unteren Außen-
flügel des Genter Altarwerkes herumzieht.
Auf Eyckschen Gemälden begegnet die be-
scheidene Devise: als ikh kan. Rührend ist
der Notschrei des alten Lukas Moser auf
seinem Tiefenbronner Altarwerk: Schrie Kunst
schrie und klag dich ser din begert jectz niemen
mer. Die reizende Ruhe auf der Flucht der
Berliner Galerie von Altdorfer weist die Wid-
mung: Alb. Altdorfer, Maler zu Regensburg,
weihte dies Geschenk, gläubigen Herzens Dir,
hehre Maria, zu seinem Seelenheil; die hl.
Familie des Francia in Berlin zeigt ein lateini-
sches Distychon, das in der Uebersetzung
lautet: Hier lebt von Deinen Händen, o Francia
gemalt, die höchste der Mütter. Ein originelles
KARL ALBIKER BADENDE
Känstlerbandausstellung, Darmstadt
Beispiel von Selbstkritik ist die Inschrift auf
einem Wiener Gemälde des Allori: Alexander
Bronzinus Allorius civ. Fio. dum pingebat
melius lienare non potuit. Oder der Maler
erhebt einen frommen Bittruf an die Madonna:
Mater dei miserere mei — Ora pro Nobis
Sancta dei genitrix — Orate pro pictore. Auf
dem Berliner Multscheraltar von 1437 steht zu
lesen : bitte got für hanssen muoltscheren usw.
Im siebzehnten Jahrhundert kam das Mono-
grammwesen stark in Abnahme und die Künst-
lerbezeichnung mit vollem Namen wurde auch
im Norden das übliche. Doch hat es zu allen
Zeiten Malerund Bildhauer gegeben, die diesen
Stempel des Namensgeheimnisses selbst ihren
Hauptwerken gegenüber beibehielten; so er-
freut sich das Künstlermonogramm nament-
lich bei den Niederländern bis tief in das acht-
zehnte Jahrhundert hinein einer gewissen
Gunst. In den ersten Dezennien des neun-
zehnten Jahrhunderts, als die Begeisterung
für mittelalterliche Kunst überall aufflammte,
kam damit auch das Monogrammen wesen wieder
neu in Flor, dessen Gebrauch durch alte,
ehrwürdige Tradition gleichsam geheiligt war.
Eine andere, wieder weniger bei den italie-
nischen, als bei den alten deutschen, fran-
zösischen und niederländischen Meistern ge-
bräuchliche Form der Namensumschreibung,
ist die durch ein figürliches Zeichen, das un-
mittelbar auf den Namen des betreffenden
Künstlers hinweist. So signiert Hans Schäufe-
lein mit einer gemalten Schaufel, Claus Sluter
mit einem Schlüssel (wallonisch Sleutel), Van
Hut mit einem Hut, George Bellegambe mit
einem Mond (vlämisch belle) und einem Kno-
chen (jambe), Benvenuto Tisi Garofalo mit ei-
nem Nelkenblütenzweiglein (Garofano = Nelke)
usw. Einem Witz schon gleicht es, wenn Dosso
Dossi mit einem D, das durch einen Knochen
(Osso) gesteckt ist, zeichnet (Hl. Hieronymus
Wien). Nicht in unmittelbar sinnlicher Be-
ziehung zum Namen stehen Zeichen wie der
Dreizack des Pieter Aertsen oder die geflü-
gelte Schlange des Lukas Cranach. Herri met
de Bles bezeichnete seine Bilder mit einem
Käuzchen, weswegen ihn die Italiener Civetta
nennen, um eine Beziehung zum Namen zu
schaffen.
Recht interessant ist es auch, der Frage nach-
zugehen, wie und wo die alten Meister ihre
Zeichen und Signaturen anbrachten. Die Bau-
meister und Steinmetzen meißelten ihre Mei-
sterschilde bei kirchlichen Bauten entweder
auf den östlichen Schlußstein des Chorge-
wölbes, oder an das obere Ende des östlichen
566
Zusätze, wie: nach cristi geburt, post virginis
partum, anno domini gemacht.
Für die Erweiterung der schlichten Signa-
tur zu längeren Inschriften bieten der Norden
wie der Süden Beispiele. Berühmt ist die
metrische lateinische Inschrift, die sich um
den alten Holzrahmen der unteren Außen-
flügel des Genter Altarwerkes herumzieht.
Auf Eyckschen Gemälden begegnet die be-
scheidene Devise: als ikh kan. Rührend ist
der Notschrei des alten Lukas Moser auf
seinem Tiefenbronner Altarwerk: Schrie Kunst
schrie und klag dich ser din begert jectz niemen
mer. Die reizende Ruhe auf der Flucht der
Berliner Galerie von Altdorfer weist die Wid-
mung: Alb. Altdorfer, Maler zu Regensburg,
weihte dies Geschenk, gläubigen Herzens Dir,
hehre Maria, zu seinem Seelenheil; die hl.
Familie des Francia in Berlin zeigt ein lateini-
sches Distychon, das in der Uebersetzung
lautet: Hier lebt von Deinen Händen, o Francia
gemalt, die höchste der Mütter. Ein originelles
KARL ALBIKER BADENDE
Känstlerbandausstellung, Darmstadt
Beispiel von Selbstkritik ist die Inschrift auf
einem Wiener Gemälde des Allori: Alexander
Bronzinus Allorius civ. Fio. dum pingebat
melius lienare non potuit. Oder der Maler
erhebt einen frommen Bittruf an die Madonna:
Mater dei miserere mei — Ora pro Nobis
Sancta dei genitrix — Orate pro pictore. Auf
dem Berliner Multscheraltar von 1437 steht zu
lesen : bitte got für hanssen muoltscheren usw.
Im siebzehnten Jahrhundert kam das Mono-
grammwesen stark in Abnahme und die Künst-
lerbezeichnung mit vollem Namen wurde auch
im Norden das übliche. Doch hat es zu allen
Zeiten Malerund Bildhauer gegeben, die diesen
Stempel des Namensgeheimnisses selbst ihren
Hauptwerken gegenüber beibehielten; so er-
freut sich das Künstlermonogramm nament-
lich bei den Niederländern bis tief in das acht-
zehnte Jahrhundert hinein einer gewissen
Gunst. In den ersten Dezennien des neun-
zehnten Jahrhunderts, als die Begeisterung
für mittelalterliche Kunst überall aufflammte,
kam damit auch das Monogrammen wesen wieder
neu in Flor, dessen Gebrauch durch alte,
ehrwürdige Tradition gleichsam geheiligt war.
Eine andere, wieder weniger bei den italie-
nischen, als bei den alten deutschen, fran-
zösischen und niederländischen Meistern ge-
bräuchliche Form der Namensumschreibung,
ist die durch ein figürliches Zeichen, das un-
mittelbar auf den Namen des betreffenden
Künstlers hinweist. So signiert Hans Schäufe-
lein mit einer gemalten Schaufel, Claus Sluter
mit einem Schlüssel (wallonisch Sleutel), Van
Hut mit einem Hut, George Bellegambe mit
einem Mond (vlämisch belle) und einem Kno-
chen (jambe), Benvenuto Tisi Garofalo mit ei-
nem Nelkenblütenzweiglein (Garofano = Nelke)
usw. Einem Witz schon gleicht es, wenn Dosso
Dossi mit einem D, das durch einen Knochen
(Osso) gesteckt ist, zeichnet (Hl. Hieronymus
Wien). Nicht in unmittelbar sinnlicher Be-
ziehung zum Namen stehen Zeichen wie der
Dreizack des Pieter Aertsen oder die geflü-
gelte Schlange des Lukas Cranach. Herri met
de Bles bezeichnete seine Bilder mit einem
Käuzchen, weswegen ihn die Italiener Civetta
nennen, um eine Beziehung zum Namen zu
schaffen.
Recht interessant ist es auch, der Frage nach-
zugehen, wie und wo die alten Meister ihre
Zeichen und Signaturen anbrachten. Die Bau-
meister und Steinmetzen meißelten ihre Mei-
sterschilde bei kirchlichen Bauten entweder
auf den östlichen Schlußstein des Chorge-
wölbes, oder an das obere Ende des östlichen
566