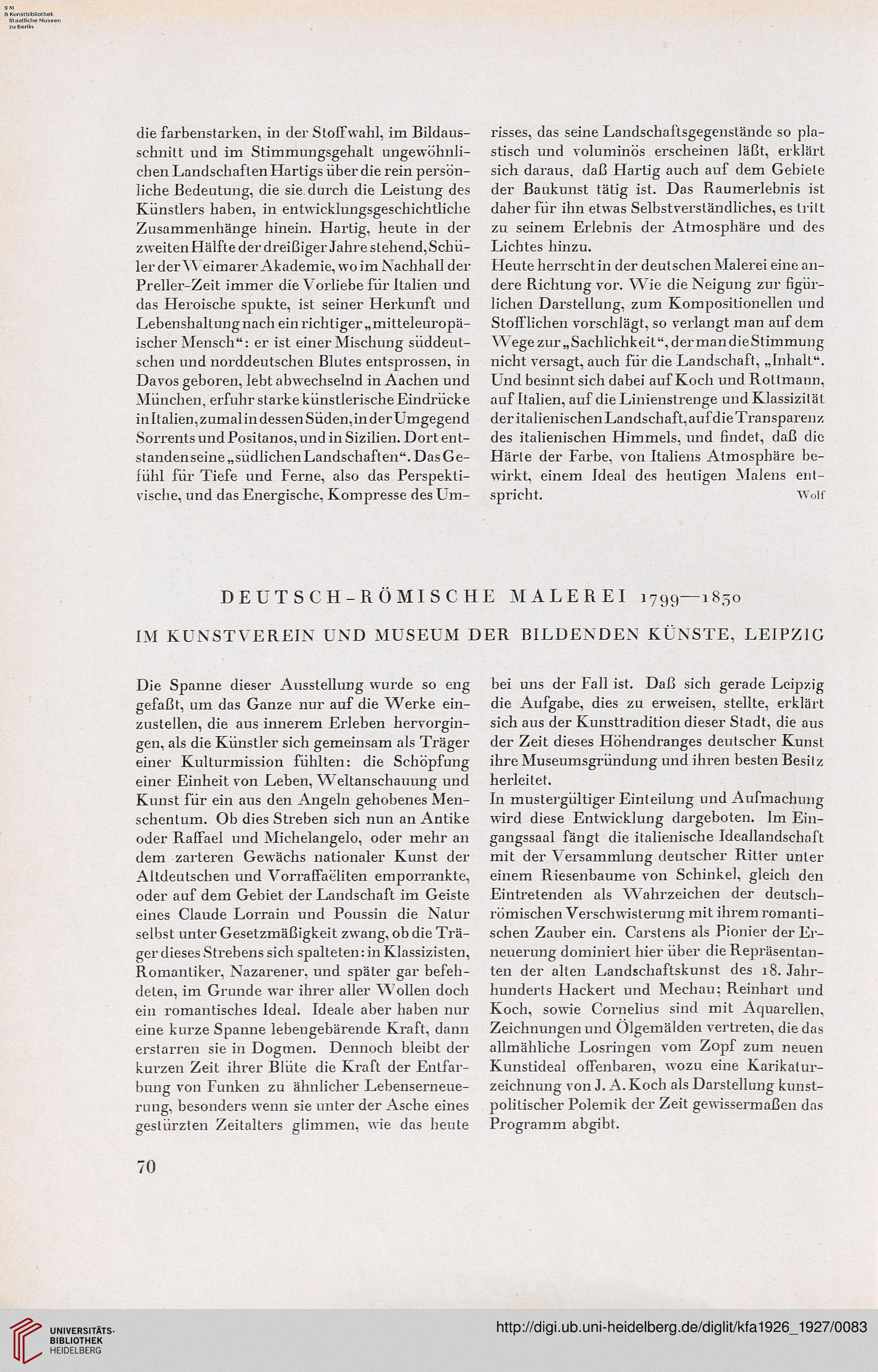die farbenstarken, in der Stoff wähl, im Bildaus-
schnitt und im Stimmungsgehalt ungewöhnli-
chen Landschaften Hartigs über die rein persön-
liche Bedeutung, die sie durch die Leistung des
Künstlers haben, in entwicklungsgeschichtliche
Zusammenhänge hinein. Hartig, heute in der
zweiten Hälfte der dreißiger Jahre stehend, Schü-
ler der\\ eimarer Akademie, wo im N achhall der
Preller-Zeit immer die Vorliebe Für Italien und
das Heroische spukte, ist seiner Herkunft und
Lebenshaltung nach ein richtiger „mitteleuropä-
ischer Mensch": er ist einer Mischung süddeut-
schen und norddeutschen Blutes entsprossen, in
Davos geboren, lebt abwechselnd in Aachen und
München, erfuhr starke künstlerische Eindrücke
in Italien, zumal in dessen Süden,in der Umgegend
Sorrents und Fositanos, und in Sizilien. Dort en t-
standenseine „südlichen Landschaften". Das Ge-
fühl für Tiefe und Ferne, also das Perspekti-
vische, und das Energische, Kompresse des Um-
risses, das seine Landschaftsgegenständc so pla-
stisch und voluminös erscheinen läßt, erklärt
sich daraus, daß Hartig auch auf dem Gebiete
der Baukunst tätig ist. Das Raumerlebnis ist
daher für ihn etwas Selbstverständliches, es tritt
zu seinem Erlebnis der Atmosphäre und des
Lichtes hinzu.
Heute herrscht in der deutschen Malerei eine an-
dere Richtung vor. Wie die Neigung zur figür-
lichen Darstellung, zum Kompositionellen und
Stofflichen vorschlägt, so verlangt man auf dem
Y\ ege zur „Sachlichkeit", der man die Stimmung
nicht versagt, auch für die Landschaft, „Inhalt".
Und besinnt sich dabei auf Koch und Rottmann,
auf Italien, auf die Linienstrenge und Klassizität
deritalienischenLandschaft, auf die Transparenz
des italienischen Himmels, und findet, daß die
Härte der Farbe, von Italiens Atmosphäre be-
wirkt, einem Ideal des heuligen Malens ent-
spricht. 'Wolf
DEUTSCH-RÖMISCHE MALEREI 1799—1850
IM KUNSTVEREIN UND MUSEUM DER BILDENDEN KÜNSTE, LEIPZIG
Die Spanne dieser Ausstellung wurde so eng
gefaßt, um das Ganze nur auf die Werke ein-
zustellen, die aus innerem Erleben hervorgin-
gen, als die Künstler sich gemeinsam als Träger
einer Kulturmission fühlten: die Schöpfung
einer Einheit von Leben, Weltanschauung und
Kunst für ein aus den Angeln gehobenes Men-
schentum. Ob dies Streben sich nun an Antike
oder Raffael und Michelangelo, oder mehr an
dem zarteren Gewächs nationaler Kunst der
Altdeutschen und Vorraffaeliten emporrankte,
oder auf dem Gebiet der Landschaft im Geiste
eines Claude Lorrain und Poussin die Natur
selbst unter Gesetzmäßigkeit zwang, ob die Trä-
ger dieses Strebens sich spalteten: in Klassizisten,
Romantiker, Nazarener. und später gar befeh-
deten, im Grunde war ihrer aller W ollen doch
ein romantisches Ideal. Ideale aber haben nur
eine kurze Spanne lebengebärende Kraft, dann
erstarren sie in Dogmen. Dennoch bleibt der
kurzen Zeit ihrer Blüte die Kraft der Entfär-
bung von Funken zu ähnlicher Lebenserneue-
rung, besonders wenn sie unter der Asche eines
gestürzten Zeitalters glimmen, wie das heute
bei uns der Fall ist. Daß sich gerade Leipzig
die Aufgabe, dies zu erweisen, stellte, erklärt
sich aus der Kunsttradition dieser Stadt, die aus
der Zeit dieses Höhendranges deutscher Kunst
ihre Museumsgründung und ihren besten Besitz
herleitet.
In mustergültiger Einteilung und Aufmachung
wird diese Entwicklung dargeboten. Im Ein-
gangssaal fängt die italienische Ideallandscbaft
mit der Versammlung deutscher Ritter unter
einem Riesenbaume von Schinkel, gleich den
Eintretenden als Wahrzeichen der deutsch-
römischen Verschwisterung mit ihrem romanti-
schen Zauber ein. Carstens als Pionier der Er-
neuerung dominiert hier über die Repräsentan-
ten der alten Landschaftskunst des 18. Jahr-
hunderts Hackert und Mechau; Reinhart und
Koch, sowie Cornelius sind mit Aquarellen,
Zeichnungen und Ölgemälden vertreten, die das
allmähliche Losringen vom Zopf zum neuen
Kunstideal offenbaren, wozu eine Karikatur-
zeichnung von J.A.Koch als Darstellung kunst-
politischer Polemik der Zeit gewissermaßen das
Programm abgibt.
70
schnitt und im Stimmungsgehalt ungewöhnli-
chen Landschaften Hartigs über die rein persön-
liche Bedeutung, die sie durch die Leistung des
Künstlers haben, in entwicklungsgeschichtliche
Zusammenhänge hinein. Hartig, heute in der
zweiten Hälfte der dreißiger Jahre stehend, Schü-
ler der\\ eimarer Akademie, wo im N achhall der
Preller-Zeit immer die Vorliebe Für Italien und
das Heroische spukte, ist seiner Herkunft und
Lebenshaltung nach ein richtiger „mitteleuropä-
ischer Mensch": er ist einer Mischung süddeut-
schen und norddeutschen Blutes entsprossen, in
Davos geboren, lebt abwechselnd in Aachen und
München, erfuhr starke künstlerische Eindrücke
in Italien, zumal in dessen Süden,in der Umgegend
Sorrents und Fositanos, und in Sizilien. Dort en t-
standenseine „südlichen Landschaften". Das Ge-
fühl für Tiefe und Ferne, also das Perspekti-
vische, und das Energische, Kompresse des Um-
risses, das seine Landschaftsgegenständc so pla-
stisch und voluminös erscheinen läßt, erklärt
sich daraus, daß Hartig auch auf dem Gebiete
der Baukunst tätig ist. Das Raumerlebnis ist
daher für ihn etwas Selbstverständliches, es tritt
zu seinem Erlebnis der Atmosphäre und des
Lichtes hinzu.
Heute herrscht in der deutschen Malerei eine an-
dere Richtung vor. Wie die Neigung zur figür-
lichen Darstellung, zum Kompositionellen und
Stofflichen vorschlägt, so verlangt man auf dem
Y\ ege zur „Sachlichkeit", der man die Stimmung
nicht versagt, auch für die Landschaft, „Inhalt".
Und besinnt sich dabei auf Koch und Rottmann,
auf Italien, auf die Linienstrenge und Klassizität
deritalienischenLandschaft, auf die Transparenz
des italienischen Himmels, und findet, daß die
Härte der Farbe, von Italiens Atmosphäre be-
wirkt, einem Ideal des heuligen Malens ent-
spricht. 'Wolf
DEUTSCH-RÖMISCHE MALEREI 1799—1850
IM KUNSTVEREIN UND MUSEUM DER BILDENDEN KÜNSTE, LEIPZIG
Die Spanne dieser Ausstellung wurde so eng
gefaßt, um das Ganze nur auf die Werke ein-
zustellen, die aus innerem Erleben hervorgin-
gen, als die Künstler sich gemeinsam als Träger
einer Kulturmission fühlten: die Schöpfung
einer Einheit von Leben, Weltanschauung und
Kunst für ein aus den Angeln gehobenes Men-
schentum. Ob dies Streben sich nun an Antike
oder Raffael und Michelangelo, oder mehr an
dem zarteren Gewächs nationaler Kunst der
Altdeutschen und Vorraffaeliten emporrankte,
oder auf dem Gebiet der Landschaft im Geiste
eines Claude Lorrain und Poussin die Natur
selbst unter Gesetzmäßigkeit zwang, ob die Trä-
ger dieses Strebens sich spalteten: in Klassizisten,
Romantiker, Nazarener. und später gar befeh-
deten, im Grunde war ihrer aller W ollen doch
ein romantisches Ideal. Ideale aber haben nur
eine kurze Spanne lebengebärende Kraft, dann
erstarren sie in Dogmen. Dennoch bleibt der
kurzen Zeit ihrer Blüte die Kraft der Entfär-
bung von Funken zu ähnlicher Lebenserneue-
rung, besonders wenn sie unter der Asche eines
gestürzten Zeitalters glimmen, wie das heute
bei uns der Fall ist. Daß sich gerade Leipzig
die Aufgabe, dies zu erweisen, stellte, erklärt
sich aus der Kunsttradition dieser Stadt, die aus
der Zeit dieses Höhendranges deutscher Kunst
ihre Museumsgründung und ihren besten Besitz
herleitet.
In mustergültiger Einteilung und Aufmachung
wird diese Entwicklung dargeboten. Im Ein-
gangssaal fängt die italienische Ideallandscbaft
mit der Versammlung deutscher Ritter unter
einem Riesenbaume von Schinkel, gleich den
Eintretenden als Wahrzeichen der deutsch-
römischen Verschwisterung mit ihrem romanti-
schen Zauber ein. Carstens als Pionier der Er-
neuerung dominiert hier über die Repräsentan-
ten der alten Landschaftskunst des 18. Jahr-
hunderts Hackert und Mechau; Reinhart und
Koch, sowie Cornelius sind mit Aquarellen,
Zeichnungen und Ölgemälden vertreten, die das
allmähliche Losringen vom Zopf zum neuen
Kunstideal offenbaren, wozu eine Karikatur-
zeichnung von J.A.Koch als Darstellung kunst-
politischer Polemik der Zeit gewissermaßen das
Programm abgibt.
70