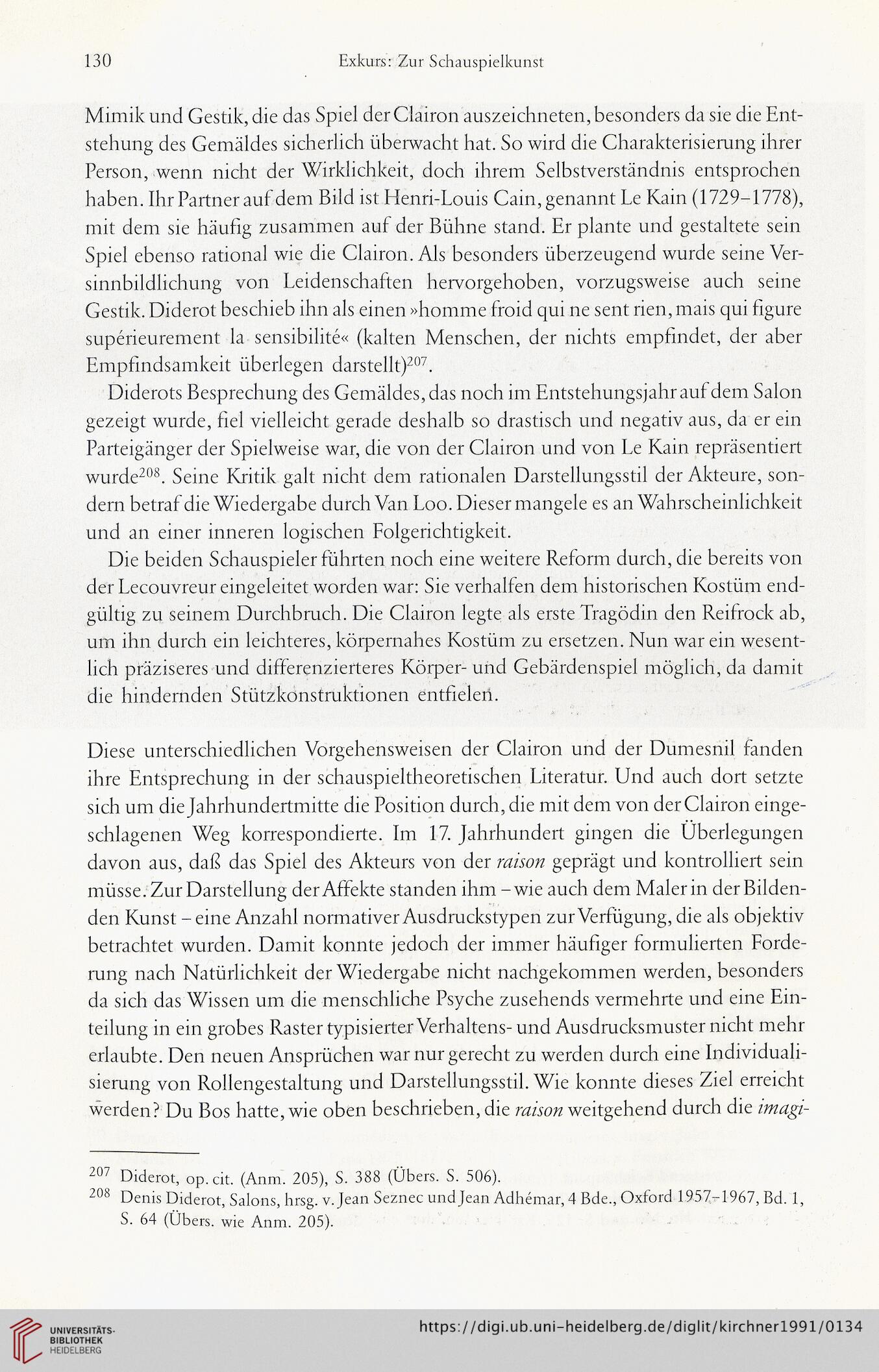130
Exkurs: Zur Schauspielkunst
Mimik und Gestik, die das Spiel der Clairon auszeichneten, besonders da sie die Ent-
stehung des Gemäldes sicherlich überwacht hat. So wird die Charakterisierung ihrer
Person, wenn nicht der Wirklichkeit, doch ihrem Selbstverständnis entsprochen
haben. Ihr Partner auf dem Bild ist Henri-Louis Cain, genannt Le Kain (1729-1778),
mit dem sie häufig zusammen auf der Bühne stand. Er plante und gestaltete sein
Spiel ebenso rational wie die Clairon. Als besonders überzeugend wurde seine Ver-
sinnbildlichung von Leidenschaften hervorgehoben, vorzugsweise auch seine
Gestik. Diderot beschieb ihn als einen »homme froid qui ne sent rien, mais qui figure
supérieurement la sensibilité« (kalten Menschen, der nichts empfindet, der aber
Empfindsamkeit überlegen darstellt)207.
Diderots Besprechung des Gemäldes, das noch im Entstehungsjahrauf dem Salon
gezeigt wurde, fiel vielleicht gerade deshalb so drastisch und negativ aus, da er ein
Parteigänger der Spielweise war, die von der Clairon und von Le Kain repräsentiert
wurde208. Seine Kritik galt nicht dem rationalen Darstellungsstil der Akteure, son-
dern betraf die Wiedergabe durch Van Loo. Dieser mangele es an Wahrscheinlichkeit
und an einer inneren logischen Folgerichtigkeit.
Die beiden Schauspieler führten noch eine weitere Reform durch, die bereits von
der Lecouvreur eingeleitet worden war: Sie verhalfen dem historischen Kostüm end-
gültig zu seinem Durchbruch. Die Clairon legte als erste Tragödin den Reifrock ab,
um ihn durch ein leichteres, körpernahes Kostüm zu ersetzen. Nun war ein wesent-
lich präziseres und differenzierteres Körper- und Gebärdenspiel möglich, da damit
die hindernden Stützkonstruktionen entfielen.
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen der Clairon und der Dumesnil fanden
ihre Entsprechung in der schauspieltheoretischen Literatur. Und auch dort setzte
sich um die Jahrhundertmitte die Position durch, die mit dem von der Clairon einge-
schlagenen Weg korrespondierte. Im 17. Jahrhundert gingen die Überlegungen
davon aus, daß das Spiel des Akteurs von der raison geprägt und kontrolliert sein
müsse. Zur Darstellung der Affekte standen ihm - wie auch dem Maler in der Bilden-
den Kunst - eine Anzahl normativer Ausdruckstypen zur Verfügung, die als objektiv
betrachtet wurden. Damit konnte jedoch der immer häufiger formulierten Forde-
rung nach Natürlichkeit der Wiedergabe nicht nachgekommen werden, besonders
da sich das Wissen um die menschliche Psyche zusehends vermehrte und eine Ein-
teilung in ein grobes Raster typisierter Verhaltens- und Ausdrucksmuster nicht mehr
erlaubte. Den neuen Ansprüchen war nur gerecht zu werden durch eine Individuali-
sierung von Rollengestaltung und Darstellungsstil. Wie konnte dieses Ziel erreicht
werden? Du Bos hatte, wie oben beschrieben, die raison weitgehend durch die imagi-
207 Diderot, op. cit. (Anm. 205), S. 388 (Übers. S. 506).
208 Denis Diderot, Salons, hrsg. v. Jean Seznec undjean Adhémar, 4 Bde., Oxford 1957—1967, Bd. 1,
S. 64 (Übers, wie Anm. 205).
Exkurs: Zur Schauspielkunst
Mimik und Gestik, die das Spiel der Clairon auszeichneten, besonders da sie die Ent-
stehung des Gemäldes sicherlich überwacht hat. So wird die Charakterisierung ihrer
Person, wenn nicht der Wirklichkeit, doch ihrem Selbstverständnis entsprochen
haben. Ihr Partner auf dem Bild ist Henri-Louis Cain, genannt Le Kain (1729-1778),
mit dem sie häufig zusammen auf der Bühne stand. Er plante und gestaltete sein
Spiel ebenso rational wie die Clairon. Als besonders überzeugend wurde seine Ver-
sinnbildlichung von Leidenschaften hervorgehoben, vorzugsweise auch seine
Gestik. Diderot beschieb ihn als einen »homme froid qui ne sent rien, mais qui figure
supérieurement la sensibilité« (kalten Menschen, der nichts empfindet, der aber
Empfindsamkeit überlegen darstellt)207.
Diderots Besprechung des Gemäldes, das noch im Entstehungsjahrauf dem Salon
gezeigt wurde, fiel vielleicht gerade deshalb so drastisch und negativ aus, da er ein
Parteigänger der Spielweise war, die von der Clairon und von Le Kain repräsentiert
wurde208. Seine Kritik galt nicht dem rationalen Darstellungsstil der Akteure, son-
dern betraf die Wiedergabe durch Van Loo. Dieser mangele es an Wahrscheinlichkeit
und an einer inneren logischen Folgerichtigkeit.
Die beiden Schauspieler führten noch eine weitere Reform durch, die bereits von
der Lecouvreur eingeleitet worden war: Sie verhalfen dem historischen Kostüm end-
gültig zu seinem Durchbruch. Die Clairon legte als erste Tragödin den Reifrock ab,
um ihn durch ein leichteres, körpernahes Kostüm zu ersetzen. Nun war ein wesent-
lich präziseres und differenzierteres Körper- und Gebärdenspiel möglich, da damit
die hindernden Stützkonstruktionen entfielen.
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen der Clairon und der Dumesnil fanden
ihre Entsprechung in der schauspieltheoretischen Literatur. Und auch dort setzte
sich um die Jahrhundertmitte die Position durch, die mit dem von der Clairon einge-
schlagenen Weg korrespondierte. Im 17. Jahrhundert gingen die Überlegungen
davon aus, daß das Spiel des Akteurs von der raison geprägt und kontrolliert sein
müsse. Zur Darstellung der Affekte standen ihm - wie auch dem Maler in der Bilden-
den Kunst - eine Anzahl normativer Ausdruckstypen zur Verfügung, die als objektiv
betrachtet wurden. Damit konnte jedoch der immer häufiger formulierten Forde-
rung nach Natürlichkeit der Wiedergabe nicht nachgekommen werden, besonders
da sich das Wissen um die menschliche Psyche zusehends vermehrte und eine Ein-
teilung in ein grobes Raster typisierter Verhaltens- und Ausdrucksmuster nicht mehr
erlaubte. Den neuen Ansprüchen war nur gerecht zu werden durch eine Individuali-
sierung von Rollengestaltung und Darstellungsstil. Wie konnte dieses Ziel erreicht
werden? Du Bos hatte, wie oben beschrieben, die raison weitgehend durch die imagi-
207 Diderot, op. cit. (Anm. 205), S. 388 (Übers. S. 506).
208 Denis Diderot, Salons, hrsg. v. Jean Seznec undjean Adhémar, 4 Bde., Oxford 1957—1967, Bd. 1,
S. 64 (Übers, wie Anm. 205).