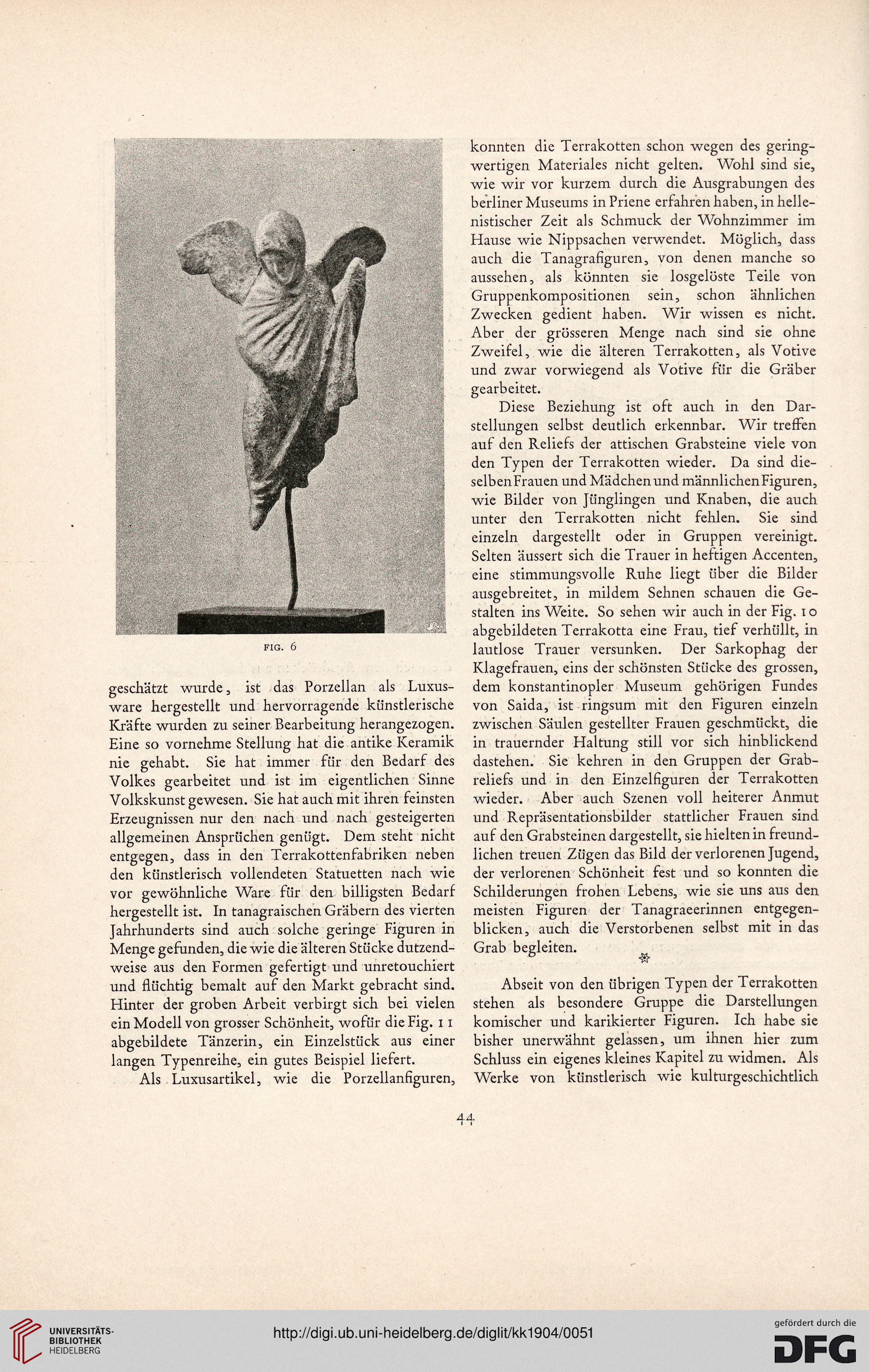FIG. 6
geschätzt wurde, ist das Porzellan als Luxus-
ware hergestellt und hervorragende künstlerische
Kräfte wurden zu seiner Bearbeitung herangezogen.
Eine so vornehme Stellung hat die antike Keramik
nie gehabt. Sie hat immer für den Bedarf des
Volkes gearbeitet und ist im eigentlichen Sinne
Volkskunst gewesen. Sie hat auch mit ihren feinsten
Erzeugnissen nur den nach und nach gesteigerten
allgemeinen Ansprüchen genügt. Dem steht nicht
entgegen, dass in den Terrakottenfabriken neben
den künstlerisch vollendeten Statuetten nach wie
vor gewöhnliche Ware für den billigsten Bedarf
hergestellt ist. In tanagraischen Gräbern des vierten
Jahrhunderts sind auch solche geringe Figuren in
Menge gefunden, die wie die älteren Stücke dutzend-
weise aus den Formen gefertigt und unretouchiert
und flüchtig bemalt auf den Markt gebracht sind.
Hinter der groben Arbeit verbirgt sich bei vielen
ein Modell von grosser Schönheit, wofür die Fig. 11
abgebildete Tänzerin, ein Einzelstück aus einer
langen Typenreihe, ein gutes Beispiel liefert.
Als Luxusartikel, wie die Porzellanfiguren,
konnten die Terrakotten schon wegen des gering-
wertigen Materiales nicht gelten. Wohl sind sie,
wie wir vor kurzem durch die Ausgrabungen des
berliner Museums in Priene erfahren haben, in helle-
nistischer Zeit als Schmuck der Wohnzimmer im
Hause wie Nippsachen verwendet. Möglich, dass
auch die Tanagrafiguren, von denen manche so
aussehen, als könnten sie losgelöste Teile von
Gruppenkompositionen sein, schon ähnlichen
Zwecken gedient haben. Wir wissen es nicht.
Aber der grösseren Menge nach sind sie ohne
Zweifel, wie die älteren Terrakotten, als Votive
und zwar vorwiegend als Votive für die Gräber
gearbeitet.
Diese Beziehung ist oft auch in den Dar-
stellungen selbst deutlich erkennbar. Wir treffen
auf den Reliefs der attischen Grabsteine viele von
den Typen der Terrakotten wieder. Da sind die-
selben Frauen und Mädchen und männlichen Figuren,
wie Bilder von Jünglingen und Knaben, die auch
unter den Terrakotten nicht fehlen. Sie sind
einzeln dargestellt oder in Gruppen vereinigt.
Selten äussert sich die Trauer in heftigen Accenten,
eine stimmungsvolle Ruhe liegt über die Bilder
ausgebreitet, in mildem Sehnen schauen die Ge-
stalten ins Weite. So sehen wir auch in der Fig. i o
abgebildeten Terrakotta eine Frau, tief verhüllt, in
lautlose Trauer versunken. Der Sarkophag der
Klagefrauen, eins der schönsten Stücke des grossen,
dem konstantinopler Museum gehörigen Fundes
von Saida, ist ringsum mit den Figuren einzeln
zwischen Säulen gestellter Frauen geschmückt, die
in trauernder Haltung still vor sich hinblickend
dastehen. Sie kehren in den Gruppen der Grab-
reliefs und in den Einzelfiguren der Terrakotten
wieder. Aber auch Szenen voll heiterer Anmut
und Repräsentationsbilder stattlicher Frauen sind
auf den Grabsteinen dargestellt, sie hielten in freund-
lichen treuen Zügen das Bild der verlorenen Jugend,
der verlorenen Schönheit fest und so konnten die
Schilderungen frohen Lebens, wie sie uns aus den
meisten Figuren der Tanagraeerinnen entgegen-
blicken, auch die Verstorbenen selbst mit in das
Grab begleiten.
Abseit von den übrigen Typen der Terrakotten
stehen als besondere Gruppe die Darstellungen
komischer und karikierter Figuren. Ich habe sie
bisher unerwähnt gelassen, um ihnen hier zum
Schluss ein eigenes kleines Kapitel zu widmen. Als
Werke von künstlerisch wie kulturgeschichtlich
44
geschätzt wurde, ist das Porzellan als Luxus-
ware hergestellt und hervorragende künstlerische
Kräfte wurden zu seiner Bearbeitung herangezogen.
Eine so vornehme Stellung hat die antike Keramik
nie gehabt. Sie hat immer für den Bedarf des
Volkes gearbeitet und ist im eigentlichen Sinne
Volkskunst gewesen. Sie hat auch mit ihren feinsten
Erzeugnissen nur den nach und nach gesteigerten
allgemeinen Ansprüchen genügt. Dem steht nicht
entgegen, dass in den Terrakottenfabriken neben
den künstlerisch vollendeten Statuetten nach wie
vor gewöhnliche Ware für den billigsten Bedarf
hergestellt ist. In tanagraischen Gräbern des vierten
Jahrhunderts sind auch solche geringe Figuren in
Menge gefunden, die wie die älteren Stücke dutzend-
weise aus den Formen gefertigt und unretouchiert
und flüchtig bemalt auf den Markt gebracht sind.
Hinter der groben Arbeit verbirgt sich bei vielen
ein Modell von grosser Schönheit, wofür die Fig. 11
abgebildete Tänzerin, ein Einzelstück aus einer
langen Typenreihe, ein gutes Beispiel liefert.
Als Luxusartikel, wie die Porzellanfiguren,
konnten die Terrakotten schon wegen des gering-
wertigen Materiales nicht gelten. Wohl sind sie,
wie wir vor kurzem durch die Ausgrabungen des
berliner Museums in Priene erfahren haben, in helle-
nistischer Zeit als Schmuck der Wohnzimmer im
Hause wie Nippsachen verwendet. Möglich, dass
auch die Tanagrafiguren, von denen manche so
aussehen, als könnten sie losgelöste Teile von
Gruppenkompositionen sein, schon ähnlichen
Zwecken gedient haben. Wir wissen es nicht.
Aber der grösseren Menge nach sind sie ohne
Zweifel, wie die älteren Terrakotten, als Votive
und zwar vorwiegend als Votive für die Gräber
gearbeitet.
Diese Beziehung ist oft auch in den Dar-
stellungen selbst deutlich erkennbar. Wir treffen
auf den Reliefs der attischen Grabsteine viele von
den Typen der Terrakotten wieder. Da sind die-
selben Frauen und Mädchen und männlichen Figuren,
wie Bilder von Jünglingen und Knaben, die auch
unter den Terrakotten nicht fehlen. Sie sind
einzeln dargestellt oder in Gruppen vereinigt.
Selten äussert sich die Trauer in heftigen Accenten,
eine stimmungsvolle Ruhe liegt über die Bilder
ausgebreitet, in mildem Sehnen schauen die Ge-
stalten ins Weite. So sehen wir auch in der Fig. i o
abgebildeten Terrakotta eine Frau, tief verhüllt, in
lautlose Trauer versunken. Der Sarkophag der
Klagefrauen, eins der schönsten Stücke des grossen,
dem konstantinopler Museum gehörigen Fundes
von Saida, ist ringsum mit den Figuren einzeln
zwischen Säulen gestellter Frauen geschmückt, die
in trauernder Haltung still vor sich hinblickend
dastehen. Sie kehren in den Gruppen der Grab-
reliefs und in den Einzelfiguren der Terrakotten
wieder. Aber auch Szenen voll heiterer Anmut
und Repräsentationsbilder stattlicher Frauen sind
auf den Grabsteinen dargestellt, sie hielten in freund-
lichen treuen Zügen das Bild der verlorenen Jugend,
der verlorenen Schönheit fest und so konnten die
Schilderungen frohen Lebens, wie sie uns aus den
meisten Figuren der Tanagraeerinnen entgegen-
blicken, auch die Verstorbenen selbst mit in das
Grab begleiten.
Abseit von den übrigen Typen der Terrakotten
stehen als besondere Gruppe die Darstellungen
komischer und karikierter Figuren. Ich habe sie
bisher unerwähnt gelassen, um ihnen hier zum
Schluss ein eigenes kleines Kapitel zu widmen. Als
Werke von künstlerisch wie kulturgeschichtlich
44