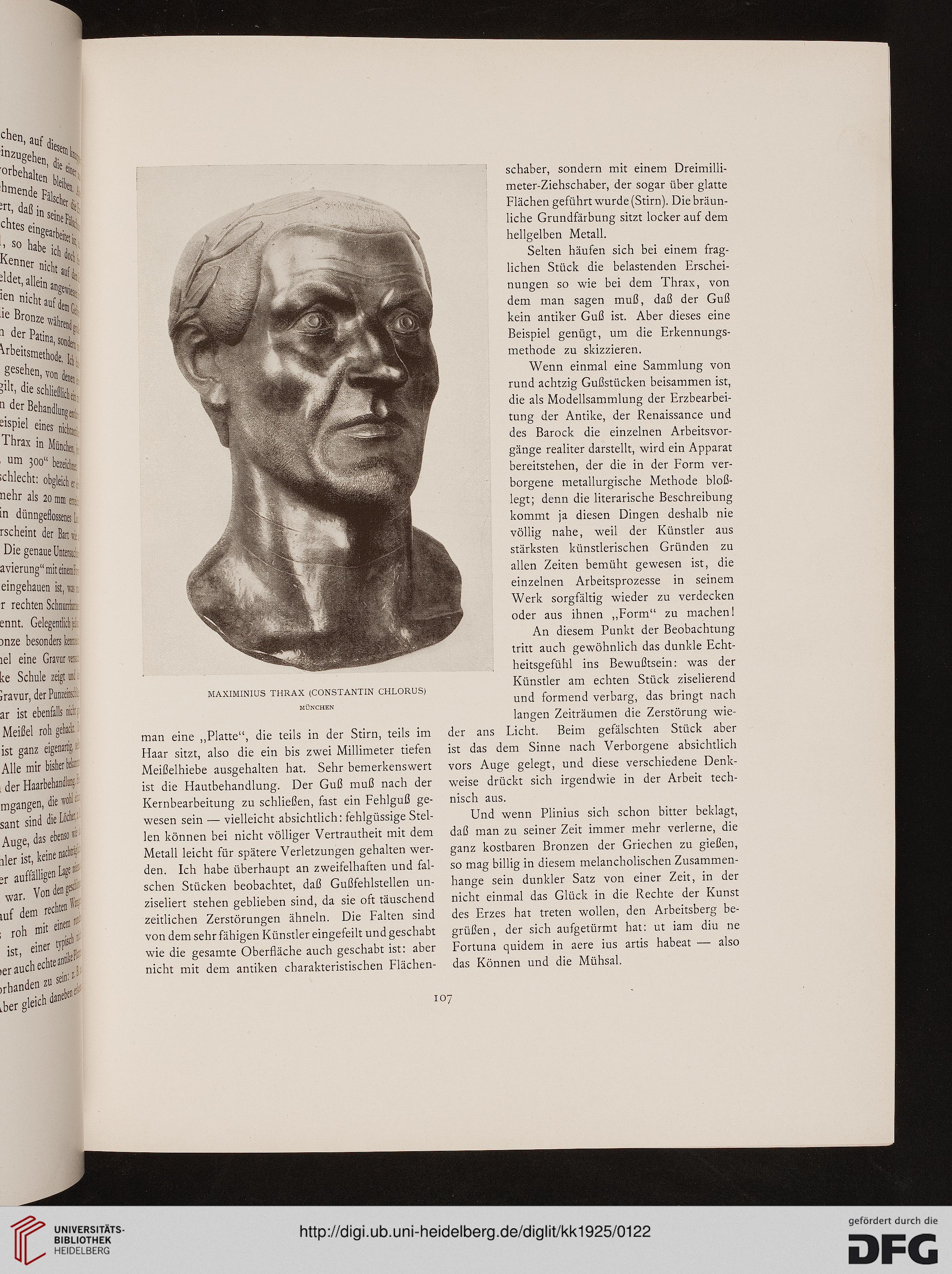Che". auf,
chtes ein
' so hab
Kenner
Kl
»^arbeitet
^h
all^^
1 der Patt* "'■
Arbeitsmethode. Ict:
gesehen, von dene^:
>*' dle «ddieBii'.
ttd£tH*
i hrax in München,
um 300" bezeichnV
ichlecht:
nehr als
t
:niri
20 mm ttj
in dünngefli
rscheint der
Die genaue Unteist
avierung"mitekmf
eingehauen ist, w
r rechten Schmink
ennt. Gelegentlichje;
jnze besonders lau
lel eine Gravur me
ke Schule zeigt Dil
Jravur, derPiinzekl
ar ist ebenfalls nicht.
Meißel roh gebet-
ist ganz
Alle mir
. der HaarbehandlM?.:
mgangen, die wollt
sant sind die Lö*
Auge, das ebenso *■
,1er ist, keine **#
,r auffälligen W
war. Vondengej
mf dem rechten ^ -
; roh mit einem*
ist, einer flj£
.raucheebte^
,ber glei*^1
MAXIMINIUS THRAX (CONSTANTIN CHLORUS)
MÜNCHEN
man eine „Platte", die teils in der Stirn, teils im
Haar sitzt, also die ein bis zwei Millimeter tiefen
Meißelhiebe ausgehalten hat. Sehr bemerkenswert
ist die Hautbehandlung. Der Guß muß nach der
Kernbearbeitung zu schließen, fast ein Fehlguß ge-
wesen sein — vielleicht absichtlich: fehlgüssige Stel-
len können bei nicht völliger Vertrautheit mit dem
Metall leicht für spätere Verletzungen gehalten wer-
den. Ich habe überhaupt an zweifelhaften und fal-
schen Stücken beobachtet, daß Gußfehlstellen un-
ziseliert stehen geblieben sind, da sie oft täuschend
zeitlichen Zerstörungen ähneln. Die Falten sind
von dem sehr fähigen Künstler eingefeilt und geschabt
wie die gesamte Oberfläche auch geschabt ist: aber
nicht mit dem antiken charakteristischen Flächen-
schaber, sondern mit einem Dreimilli-
meter-Ziehschaber, der sogar über glatte
Flächen geführt wurde (Stirn). Die bräun-
liche Grundfärbung sitzt locker auf dem
hellgelben Metall.
Selten häufen sich bei einem frag-
lichen Stück die belastenden Erschei-
nungen so wie bei dem Thrax, von
dem man sagen muß, daß der Guß
kein antiker Guß ist. Aber dieses eine
Beispiel genügt, um die Erkennungs-
methode zu skizzieren.
Wenn einmal eine Sammlung von
rund achtzig Gußstücken beisammen ist,
die als Modellsammlung der Erzbearbei-
tung der Antike, der Renaissance und
des Barock die einzelnen Arbeitsvor-
gänge realiter darstellt, wird ein Apparat
bereitstehen, der die in der Form ver-
borgene metallurgische Methode bloß-
legt; denn die literarische Beschreibung
kommt ja diesen Dingen deshalb nie
völlig nahe, weil der Künstler aus
stärksten künstlerischen Gründen zu
allen Zeiten bemüht gewesen ist, die
einzelnen Arbeitsprozesse in seinem
Werk sorgfältig wieder zu verdecken
oder aus ihnen „Form" zu machen!
An diesem Punkt der Beobachtung
tritt auch gewöhnlich das dunkle Echt-
heitsgefühl ins Bewußtsein: was der
Künstler am echten Stück ziselierend
und formend verbarg, das bringt nach
langen Zeiträumen die Zerstörung wie-
der ans Licht. Beim gefälschten Stück aber
ist das dem Sinne nach Verborgene absichtlich
vors Auge gelegt, und diese verschiedene Denk-
weise drückt sich irgendwie in der Arbeit tech-
nisch aus.
Und wenn Plinius sich schon bitter beklagt,
daß man zu seiner Zeit immer mehr verlerne, die
ganz kostbaren Bronzen der Griechen zu gießen,
so mag billig in diesem melancholischen Zusammen-
hange sein dunkler Satz von einer Zeit, in der
nicht einmal das Glück in die Rechte der Kunst
des Erzes hat treten wollen, den Arbeitsberg be-
grüßen, der sich aufgetürmt hat: ut iam diu ne
Fortuna quidem in aere ius artis habeat — also
das Können und die Mühsal.
107
chtes ein
' so hab
Kenner
Kl
»^arbeitet
^h
all^^
1 der Patt* "'■
Arbeitsmethode. Ict:
gesehen, von dene^:
>*' dle «ddieBii'.
ttd£tH*
i hrax in München,
um 300" bezeichnV
ichlecht:
nehr als
t
:niri
20 mm ttj
in dünngefli
rscheint der
Die genaue Unteist
avierung"mitekmf
eingehauen ist, w
r rechten Schmink
ennt. Gelegentlichje;
jnze besonders lau
lel eine Gravur me
ke Schule zeigt Dil
Jravur, derPiinzekl
ar ist ebenfalls nicht.
Meißel roh gebet-
ist ganz
Alle mir
. der HaarbehandlM?.:
mgangen, die wollt
sant sind die Lö*
Auge, das ebenso *■
,1er ist, keine **#
,r auffälligen W
war. Vondengej
mf dem rechten ^ -
; roh mit einem*
ist, einer flj£
.raucheebte^
,ber glei*^1
MAXIMINIUS THRAX (CONSTANTIN CHLORUS)
MÜNCHEN
man eine „Platte", die teils in der Stirn, teils im
Haar sitzt, also die ein bis zwei Millimeter tiefen
Meißelhiebe ausgehalten hat. Sehr bemerkenswert
ist die Hautbehandlung. Der Guß muß nach der
Kernbearbeitung zu schließen, fast ein Fehlguß ge-
wesen sein — vielleicht absichtlich: fehlgüssige Stel-
len können bei nicht völliger Vertrautheit mit dem
Metall leicht für spätere Verletzungen gehalten wer-
den. Ich habe überhaupt an zweifelhaften und fal-
schen Stücken beobachtet, daß Gußfehlstellen un-
ziseliert stehen geblieben sind, da sie oft täuschend
zeitlichen Zerstörungen ähneln. Die Falten sind
von dem sehr fähigen Künstler eingefeilt und geschabt
wie die gesamte Oberfläche auch geschabt ist: aber
nicht mit dem antiken charakteristischen Flächen-
schaber, sondern mit einem Dreimilli-
meter-Ziehschaber, der sogar über glatte
Flächen geführt wurde (Stirn). Die bräun-
liche Grundfärbung sitzt locker auf dem
hellgelben Metall.
Selten häufen sich bei einem frag-
lichen Stück die belastenden Erschei-
nungen so wie bei dem Thrax, von
dem man sagen muß, daß der Guß
kein antiker Guß ist. Aber dieses eine
Beispiel genügt, um die Erkennungs-
methode zu skizzieren.
Wenn einmal eine Sammlung von
rund achtzig Gußstücken beisammen ist,
die als Modellsammlung der Erzbearbei-
tung der Antike, der Renaissance und
des Barock die einzelnen Arbeitsvor-
gänge realiter darstellt, wird ein Apparat
bereitstehen, der die in der Form ver-
borgene metallurgische Methode bloß-
legt; denn die literarische Beschreibung
kommt ja diesen Dingen deshalb nie
völlig nahe, weil der Künstler aus
stärksten künstlerischen Gründen zu
allen Zeiten bemüht gewesen ist, die
einzelnen Arbeitsprozesse in seinem
Werk sorgfältig wieder zu verdecken
oder aus ihnen „Form" zu machen!
An diesem Punkt der Beobachtung
tritt auch gewöhnlich das dunkle Echt-
heitsgefühl ins Bewußtsein: was der
Künstler am echten Stück ziselierend
und formend verbarg, das bringt nach
langen Zeiträumen die Zerstörung wie-
der ans Licht. Beim gefälschten Stück aber
ist das dem Sinne nach Verborgene absichtlich
vors Auge gelegt, und diese verschiedene Denk-
weise drückt sich irgendwie in der Arbeit tech-
nisch aus.
Und wenn Plinius sich schon bitter beklagt,
daß man zu seiner Zeit immer mehr verlerne, die
ganz kostbaren Bronzen der Griechen zu gießen,
so mag billig in diesem melancholischen Zusammen-
hange sein dunkler Satz von einer Zeit, in der
nicht einmal das Glück in die Rechte der Kunst
des Erzes hat treten wollen, den Arbeitsberg be-
grüßen, der sich aufgetürmt hat: ut iam diu ne
Fortuna quidem in aere ius artis habeat — also
das Können und die Mühsal.
107