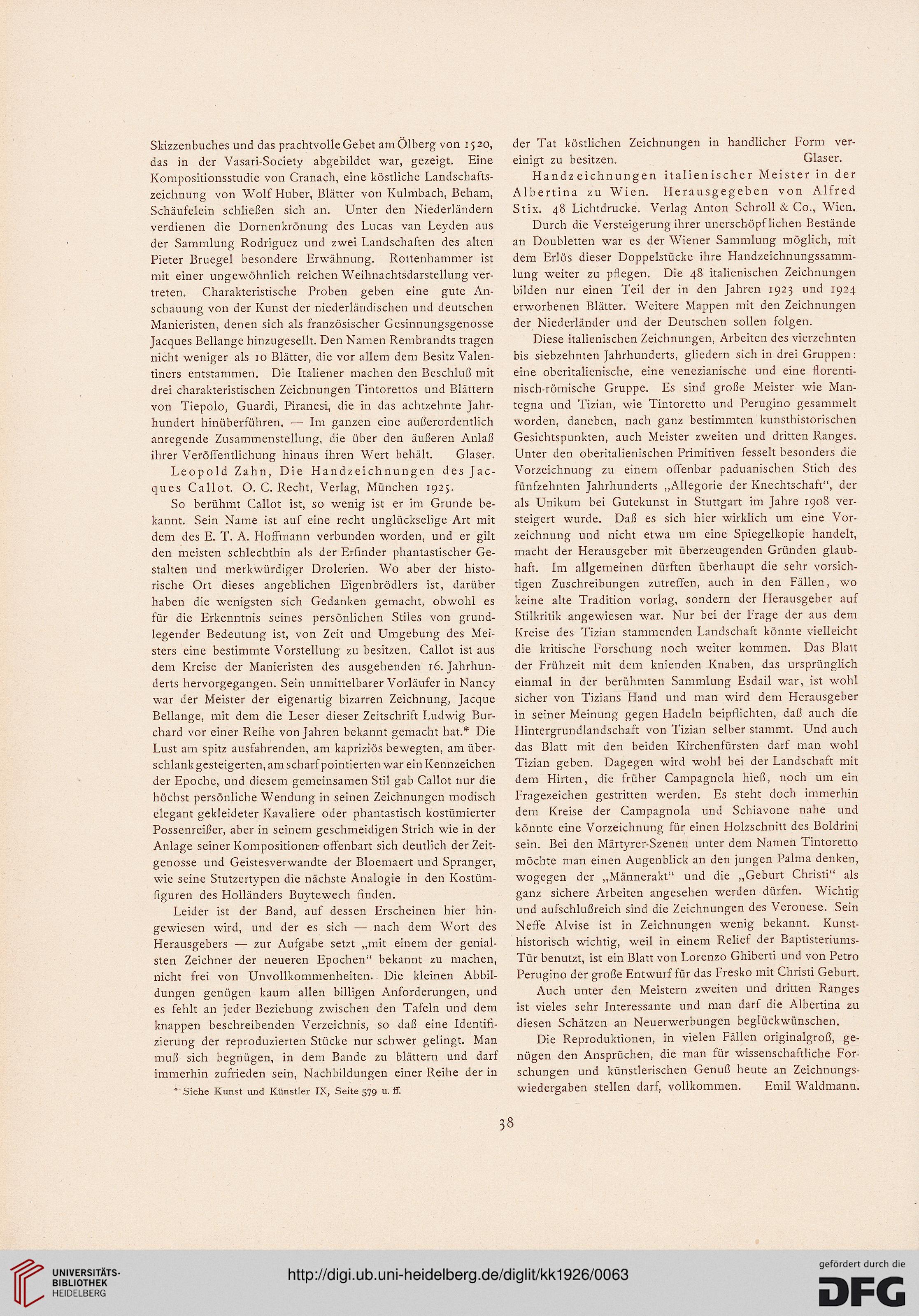Skizzenbuches und das prachtvolle Gebet am Ölberg von 15 20,
das in der Vasari-Society abgebildet war, gezeigt. Eine
Kompositionsstudie von Cranach, eine köstliche Landschafts-
zeichnung von Wolf Huber, Blätter von Kulmbach, Beham,
Schäufelein schließen sich an. Unter den Niederländern
verdienen die Dornenkrönung des Lucas van Leyden aus
der Sammlung Rodriguez und zwei Landschaften des alten
Pieter Bruegel besondere Erwähnung. Rottenhammer ist
mit einer ungewöhnlich reichen Weihnachtsdarstellung ver-
treten. Charakteristische Proben geben eine gute An-
schauung von der Kunst der niederländischen und deutschen
Manieristen, denen sich als französischer Gesinnungsgenosse
Jacques Beilange hinzugesellt. Den Namen Rembrandts tragen
nicht weniger als 10 Blätter, die vor allem dem Besitz Valen-
tiners entstammen. Die Italiener machen den Beschluß mit
drei charakteristischen Zeichnungen Tintorettos und Blättern
von Tiepolo, Guardi, Piranesi, die in das achtzehnte Jahr-
hundert hinüberführen. — Im ganzen eine außerordentlich
anregende Zusammenstellung, die über den äußeren Anlaß
ihrer Veröffentlichung hinaus ihren Wert behält. Glaser.
Leopold Zahn, Die Handzeichnungen des Jac-
ques Callot. O. C. Recht, Verlag, München 1925.
So berühmt Callot ist, so wenig ist er im Grunde be-
kannt. Sein Name ist auf eine recht unglückselige Art mit
dem des E. T. A. Hoffmann verbunden worden, und er gilt
den meisten schlechthin als der Erfinder phantastischer Ge-
stalten und merkwürdiger Drolerien. Wo aber der histo-
rische Ort dieses angeblichen Eigenbrödlers ist, darüber
haben die wenigsten sich Gedanken gemacht, obwohl es
für die Erkenntnis seines persönlichen Stiles von grund-
legender Bedeutung ist, von Zeit und Umgebung des Mei-
sters eine bestimmte Vorstellung zu besitzen. Callot ist aus
dem Kreise der Manieristen des ausgehenden 16. Jahrhun-
derts hervorgegangen. Sein unmittelbarer Vorläufer in Nancy
war der Meister der eigenartig bizarren Zeichnung, Jacque
Beilange, mit dem die Leser dieser Zeitschrift Ludwig Bur-
chard vor einer Reihe von Jahren bekannt gemacht hat.* Die
Lust am spitz ausfahrenden, am kapriziös bewegten, am über-
schlank gesteigerten, am scharf pointierten war ein Kennzeichen
der Epoche, und diesem gemeinsamen Stil gab Callot nur die
höchst persönliche Wendung in seinen Zeichnungen modisch
elegant gekleideter Kavaliere oder phantastisch kostümierter
Possenreißer, aber in seinem geschmeidigen Strich wie in der
Anlage seiner Kompositionen- offenbart sich deutlich der Zeit-
genosse und Geistesverwandte der Bloemaert und Spranger,
wie seine Stutzertypen die nächste Analogie in den Kostüm-
figuren des Holländers Buytewech finden.
Leider ist der Band, auf dessen Erscheinen hier hin-
gewiesen wird, und der es sich — nach dem Wort des
Herausgebers — zur Aufgabe setzt „mit einem der genial-
sten Zeichner der neueren Epochen" bekannt zu machen,
nicht frei von Unvollkommenheiten. Die kleinen Abbil-
dungen genügen kaum allen billigen Anforderungen, und
es fehlt an jeder Beziehung zwischen den Tafeln und dem
knappen beschreibenden Verzeichnis, so daß eine Identifi-
zierung der reproduzierten Stücke nur schwer gelingt. Man
muß sich begnügen, in dem Bande zu blättern und darf
immerhin zufrieden sein, Nachbildungen einer Reihe der in
11 Siehe Kunst und Künstler IX, Seite 579 u. ff.
der Tat köstlichen Zeichnungen in handlicher Form ver-
einigt zu besitzen. Glaser.
Handzeichnungen italienischer Meister in der
Albertina zu Wien. Herausgegeben von Alfred
St ix. 48 Lichtdrucke. Verlag Anton Schroll & Co., Wien.
Durch die Versteigerung ihrer unerschöpflichen Bestände
an Doubletten war es der Wiener Sammlung möglich, mit
dem Erlös dieser Doppelstücke ihre Handzeichnungssamm-
lung weiter zu pflegen. Die 48 italienischen Zeichnungen
bilden nur einen Teil der in den Jahren 1923 und 1924
erworbenen Blätter. Weitere Mappen mit den Zeichnungen
der Niederländer und der Deutschen sollen folgen.
Diese italienischen Zeichnungen, Arbeiten des vierzehnten
bis siebzehnten Jahrhunderts, gliedern sich in drei Gruppen:
eine oberitalienische, eine venezianische und eine florenti-
nisch-römische Gruppe. Es sind große Meister wie Man-
tegna und Tizian, wie Tintoretto und Perugino gesammelt
worden, daneben, nach ganz bestimmten kunsthistorischen
Gesichtspunkten, auch Meister zweiten und dritten Ranges.
Unter den oberitalienischen Primitiven fesselt besonders die
Vorzeichnung zu einem offenbar paduanischen Stich des
fünfzehnten Jahrhunderts „Allegorie der Knechtschaft", der
als Unikum bei Gutekunst in Stuttgart im Jahre 1908 ver-
steigert wurde. Daß es sich hier wirklich um eine Vor-
zeichnung und nicht etwa um eine Spiegelkopie handelt,
macht der Herausgeber mit überzeugenden Gründen glaub-
haft. Im allgemeinen dürften überhaupt die sehr vorsich-
tigen Zuschreibungen zutreffen, auch in den Fällen, wo
keine alte Tradition vorlag, sondern der Herausgeber auf
Stilkritik angewiesen war. Nur bei der Frage der aus dem
Kreise des Tizian stammenden Landschaft könnte vielleicht
die kritische Forschung noch weiter kommen. Das Blatt
der Frühzeit mit dem knienden Knaben, das ursprünglich
einmal in der berühmten Sammlung Esdail war, ist wohl
sicher von Tizians Hand und man wird dem Herausgeber
in seiner Meinung gegen Hadeln beipflichten, daß auch die
Hintergrundlandschaft von Tizian selber stammt. Und auch
das Blatt mit den beiden Kirchenfürsten darf man wohl
Tizian geben. Dagegen wird wohl bei der Landschaft mit
dem Hirten, die früher Campagnola hieß, noch um ein
Fragezeichen gestritten werden. Es steht doch immerhin
dem Kreise der Campagnola und Schiavone nahe und
könnte eine Vorzeichnung für einen Holzschnitt des Boldrini
sein. Bei den Märtyrer-Szenen unter dem Namen Tintoretto
möchte man einen Augenblick an den jungen Palma denken,
wogegen der „Männerakt" und die „Geburt Christi" als
ganz sichere Arbeiten angesehen werden dürfen. Wichtig
und aufschlußreich sind die Zeichnungen des Veronese. Sein
Neffe Alvise ist in Zeichnungen wenig bekannt. Kunst-
historisch wichtig, weil in einem Relief der Baptisteriums-
Tür benutzt, ist ein Blatt von Lorenzo Ghiberti und von Petro
Perugino der große Entwurf für das Fresko mit Christi Geburt.
Auch unter den Meistern zweiten und dritten Ranges
ist vieles sehr Interessante und man darf die Albertina zu
diesen Schätzen an Neuerwerbungen beglückwünschen.
Die Reproduktionen, in vielen Fällen originalgroß, ge-
nügen den Ansprüchen, die man für wissenschaftliche For-
schungen und künstlerischen Genuß heute an Zeichnungs-
wiedergaben stellen darf, vollkommen. Emil Waldmann.
38
das in der Vasari-Society abgebildet war, gezeigt. Eine
Kompositionsstudie von Cranach, eine köstliche Landschafts-
zeichnung von Wolf Huber, Blätter von Kulmbach, Beham,
Schäufelein schließen sich an. Unter den Niederländern
verdienen die Dornenkrönung des Lucas van Leyden aus
der Sammlung Rodriguez und zwei Landschaften des alten
Pieter Bruegel besondere Erwähnung. Rottenhammer ist
mit einer ungewöhnlich reichen Weihnachtsdarstellung ver-
treten. Charakteristische Proben geben eine gute An-
schauung von der Kunst der niederländischen und deutschen
Manieristen, denen sich als französischer Gesinnungsgenosse
Jacques Beilange hinzugesellt. Den Namen Rembrandts tragen
nicht weniger als 10 Blätter, die vor allem dem Besitz Valen-
tiners entstammen. Die Italiener machen den Beschluß mit
drei charakteristischen Zeichnungen Tintorettos und Blättern
von Tiepolo, Guardi, Piranesi, die in das achtzehnte Jahr-
hundert hinüberführen. — Im ganzen eine außerordentlich
anregende Zusammenstellung, die über den äußeren Anlaß
ihrer Veröffentlichung hinaus ihren Wert behält. Glaser.
Leopold Zahn, Die Handzeichnungen des Jac-
ques Callot. O. C. Recht, Verlag, München 1925.
So berühmt Callot ist, so wenig ist er im Grunde be-
kannt. Sein Name ist auf eine recht unglückselige Art mit
dem des E. T. A. Hoffmann verbunden worden, und er gilt
den meisten schlechthin als der Erfinder phantastischer Ge-
stalten und merkwürdiger Drolerien. Wo aber der histo-
rische Ort dieses angeblichen Eigenbrödlers ist, darüber
haben die wenigsten sich Gedanken gemacht, obwohl es
für die Erkenntnis seines persönlichen Stiles von grund-
legender Bedeutung ist, von Zeit und Umgebung des Mei-
sters eine bestimmte Vorstellung zu besitzen. Callot ist aus
dem Kreise der Manieristen des ausgehenden 16. Jahrhun-
derts hervorgegangen. Sein unmittelbarer Vorläufer in Nancy
war der Meister der eigenartig bizarren Zeichnung, Jacque
Beilange, mit dem die Leser dieser Zeitschrift Ludwig Bur-
chard vor einer Reihe von Jahren bekannt gemacht hat.* Die
Lust am spitz ausfahrenden, am kapriziös bewegten, am über-
schlank gesteigerten, am scharf pointierten war ein Kennzeichen
der Epoche, und diesem gemeinsamen Stil gab Callot nur die
höchst persönliche Wendung in seinen Zeichnungen modisch
elegant gekleideter Kavaliere oder phantastisch kostümierter
Possenreißer, aber in seinem geschmeidigen Strich wie in der
Anlage seiner Kompositionen- offenbart sich deutlich der Zeit-
genosse und Geistesverwandte der Bloemaert und Spranger,
wie seine Stutzertypen die nächste Analogie in den Kostüm-
figuren des Holländers Buytewech finden.
Leider ist der Band, auf dessen Erscheinen hier hin-
gewiesen wird, und der es sich — nach dem Wort des
Herausgebers — zur Aufgabe setzt „mit einem der genial-
sten Zeichner der neueren Epochen" bekannt zu machen,
nicht frei von Unvollkommenheiten. Die kleinen Abbil-
dungen genügen kaum allen billigen Anforderungen, und
es fehlt an jeder Beziehung zwischen den Tafeln und dem
knappen beschreibenden Verzeichnis, so daß eine Identifi-
zierung der reproduzierten Stücke nur schwer gelingt. Man
muß sich begnügen, in dem Bande zu blättern und darf
immerhin zufrieden sein, Nachbildungen einer Reihe der in
11 Siehe Kunst und Künstler IX, Seite 579 u. ff.
der Tat köstlichen Zeichnungen in handlicher Form ver-
einigt zu besitzen. Glaser.
Handzeichnungen italienischer Meister in der
Albertina zu Wien. Herausgegeben von Alfred
St ix. 48 Lichtdrucke. Verlag Anton Schroll & Co., Wien.
Durch die Versteigerung ihrer unerschöpflichen Bestände
an Doubletten war es der Wiener Sammlung möglich, mit
dem Erlös dieser Doppelstücke ihre Handzeichnungssamm-
lung weiter zu pflegen. Die 48 italienischen Zeichnungen
bilden nur einen Teil der in den Jahren 1923 und 1924
erworbenen Blätter. Weitere Mappen mit den Zeichnungen
der Niederländer und der Deutschen sollen folgen.
Diese italienischen Zeichnungen, Arbeiten des vierzehnten
bis siebzehnten Jahrhunderts, gliedern sich in drei Gruppen:
eine oberitalienische, eine venezianische und eine florenti-
nisch-römische Gruppe. Es sind große Meister wie Man-
tegna und Tizian, wie Tintoretto und Perugino gesammelt
worden, daneben, nach ganz bestimmten kunsthistorischen
Gesichtspunkten, auch Meister zweiten und dritten Ranges.
Unter den oberitalienischen Primitiven fesselt besonders die
Vorzeichnung zu einem offenbar paduanischen Stich des
fünfzehnten Jahrhunderts „Allegorie der Knechtschaft", der
als Unikum bei Gutekunst in Stuttgart im Jahre 1908 ver-
steigert wurde. Daß es sich hier wirklich um eine Vor-
zeichnung und nicht etwa um eine Spiegelkopie handelt,
macht der Herausgeber mit überzeugenden Gründen glaub-
haft. Im allgemeinen dürften überhaupt die sehr vorsich-
tigen Zuschreibungen zutreffen, auch in den Fällen, wo
keine alte Tradition vorlag, sondern der Herausgeber auf
Stilkritik angewiesen war. Nur bei der Frage der aus dem
Kreise des Tizian stammenden Landschaft könnte vielleicht
die kritische Forschung noch weiter kommen. Das Blatt
der Frühzeit mit dem knienden Knaben, das ursprünglich
einmal in der berühmten Sammlung Esdail war, ist wohl
sicher von Tizians Hand und man wird dem Herausgeber
in seiner Meinung gegen Hadeln beipflichten, daß auch die
Hintergrundlandschaft von Tizian selber stammt. Und auch
das Blatt mit den beiden Kirchenfürsten darf man wohl
Tizian geben. Dagegen wird wohl bei der Landschaft mit
dem Hirten, die früher Campagnola hieß, noch um ein
Fragezeichen gestritten werden. Es steht doch immerhin
dem Kreise der Campagnola und Schiavone nahe und
könnte eine Vorzeichnung für einen Holzschnitt des Boldrini
sein. Bei den Märtyrer-Szenen unter dem Namen Tintoretto
möchte man einen Augenblick an den jungen Palma denken,
wogegen der „Männerakt" und die „Geburt Christi" als
ganz sichere Arbeiten angesehen werden dürfen. Wichtig
und aufschlußreich sind die Zeichnungen des Veronese. Sein
Neffe Alvise ist in Zeichnungen wenig bekannt. Kunst-
historisch wichtig, weil in einem Relief der Baptisteriums-
Tür benutzt, ist ein Blatt von Lorenzo Ghiberti und von Petro
Perugino der große Entwurf für das Fresko mit Christi Geburt.
Auch unter den Meistern zweiten und dritten Ranges
ist vieles sehr Interessante und man darf die Albertina zu
diesen Schätzen an Neuerwerbungen beglückwünschen.
Die Reproduktionen, in vielen Fällen originalgroß, ge-
nügen den Ansprüchen, die man für wissenschaftliche For-
schungen und künstlerischen Genuß heute an Zeichnungs-
wiedergaben stellen darf, vollkommen. Emil Waldmann.
38