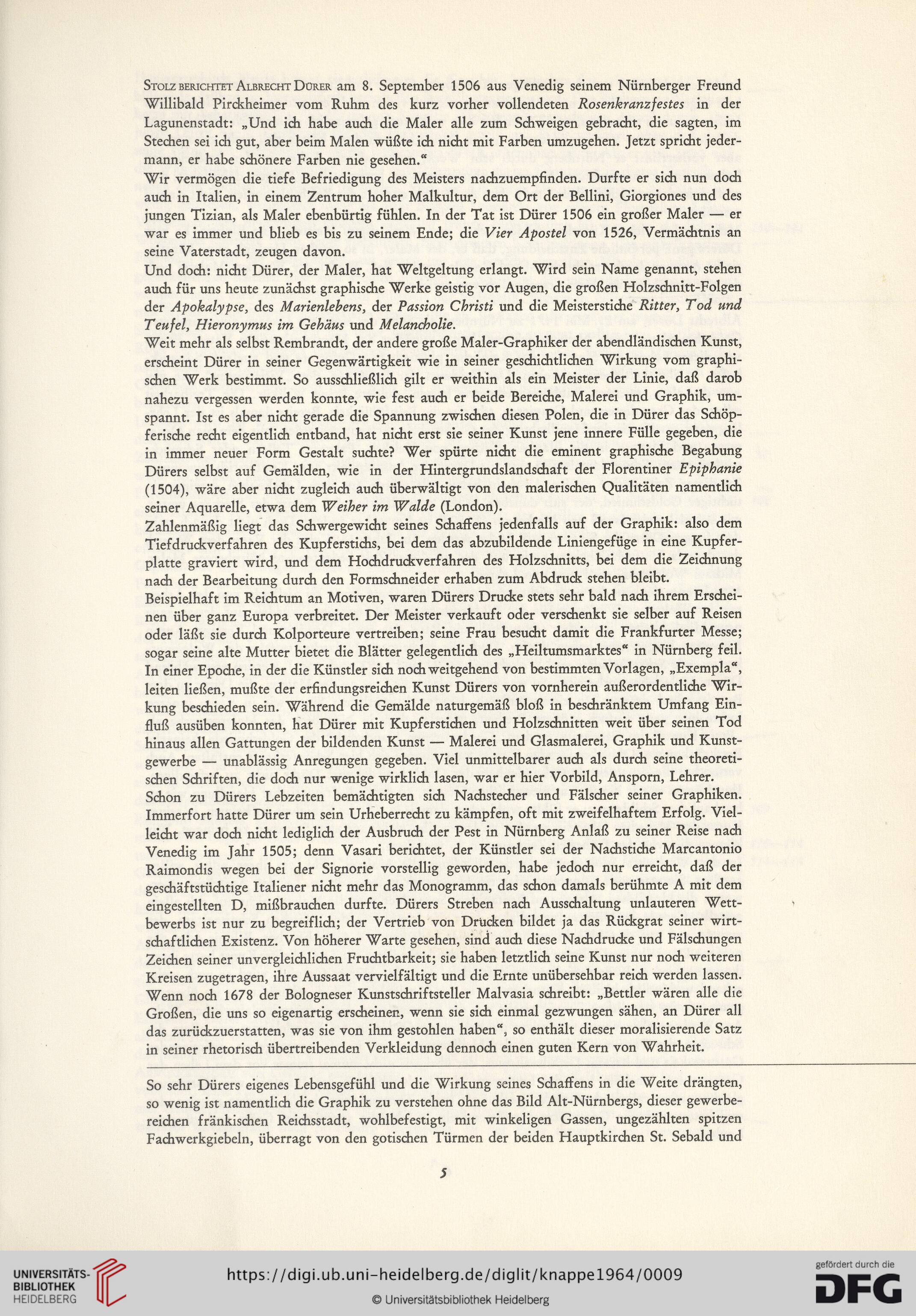Stolz berichtet Albrecht Dürer am 8. September 1506 aus Venedig seinem Nürnberger Freund
Willibald Pirckheimer vom Ruhm des kurz vorher vollendeten Rosenkranzfestes in der
Lagunenstadt: „Und ich. habe auch die Maler alle zum Schweigen gebracht, die sagten, im
Stechen sei ich gut, aber beim Malen wüßte ich nicht mit Farben umzugehen. Jetzt spricht jeder-
mann, er habe schönere Farben nie gesehen.“
Wir vermögen die tiefe Befriedigung des Meisters nachzuempfinden. Durfte er sich nun doch
auch in Italien, in einem Zentrum hoher Malkultur, dem Ort der Bellini, Giorgiones und des
jungen Tizian, als Maler ebenbürtig fühlen. In der Tat ist Dürer 1506 ein großer Maler — er
war es immer und blieb es bis zu seinem Ende; die Vier Apostel von 1526, Vermächtnis an
seine Vaterstadt, zeugen davon.
Und doch: nicht Dürer, der Maler, hat Weltgeltung erlangt. Wird sein Name genannt, stehen
auch für uns heute zunächst graphische Werke geistig vor Augen, die großen Holzschnitt-Folgen
der Apokalypse, des Marienlebens, der Passion Christi und die Meisterstiche Ritter, Tod und
Teufel, Hieronymus im Gehaus und Melancholie.
Weit mehr als selbst Rembrandt, der andere große Maler-Graphiker der abendländischen Kunst,
erscheint Dürer in seiner Gegenwärtigkeit wie in seiner geschichtlichen Wirkung vom graphi-
schen Werk bestimmt. So ausschließlich gilt er weithin als ein Meister der Linie, daß darob
nahezu vergessen werden konnte, wie fest auch er beide Bereiche, Malerei und Graphik, um-
spannt. Ist es aber nicht gerade die Spannung zwischen diesen Polen, die in Dürer das Schöp-
ferische recht eigentlich entband, hat nicht erst sie seiner Kunst jene innere Fülle gegeben, die
in immer neuer Form Gestalt suchte? Wer spürte nicht die eminent graphische Begabung
Dürers selbst auf Gemälden, wie in der Hintergrundslandschaft der Florentiner Epiphanie
(1504), wäre aber nicht zugleich auch überwältigt von den malerischen Qualitäten namentlich
seiner Aquarelle, etwa dem Weiher im Walde (London).
Zahlenmäßig liegt das Schwergewicht seines Schaffens jedenfalls auf der Graphik: also dem
Tiefdruckverfahren des Kupferstichs, bei dem das abzubildende Liniengefüge in eine Kupfer-
platte graviert wird, und dem Hochdruckverfahren des Holzschnitts, bei dem die Zeichnung
nach der Bearbeitung durch den Formschneider erhaben zum Abdruck stehen bleibt.
Beispielhaft im Reichtum an Motiven, waren Dürers Drucke stets sehr bald nach ihrem Erschei-
nen über ganz Europa verbreitet. Der Meister verkauft oder verschenkt sie selber auf Reisen
oder läßt sie durch Kolporteure vertreiben; seine Frau besucht damit die Frankfurter Messe;
sogar seine alte Mutter bietet die Blätter gelegentlich des „Heiltumsmarktes“ in Nürnberg feil.
In einer Epoche, in der die Künstler sich noch weitgehend von bestimmten Vorlagen, „Exempla“,
leiten ließen, mußte der erfindungsreichen Kunst Dürers von vornherein außerordentliche Wir-
kung beschieden sein. Während die Gemälde naturgemäß bloß in beschränktem Umfang Ein-
fluß ausüben konnten, hat Dürer mit Kupferstichen und Holzschnitten weit über seinen Tod
hinaus allen Gattungen der bildenden Kunst — Malerei und Glasmalerei, Graphik und Kunst-
gewerbe — unablässig Anregungen gegeben. Viel unmittelbarer auch als durch seine theoreti-
schen Schriften, die doch nur wenige wirklich lasen, war er hier Vorbild, Ansporn, Lehrer.
Schon zu Dürers Lebzeiten bemächtigten sich Nachstecher und Fälscher seiner Graphiken.
Immerfort hatte Dürer um sein Urheberrecht zu kämpfen, oft mit zweifelhaftem Erfolg. Viel-
leicht war doch nicht lediglich der Ausbruch der Pest in Nürnberg Anlaß zu seiner Reise nach
Venedig im Jahr 1505; denn Vasari berichtet, der Künstler sei der Nachstiche Marcantonio
Raimondis wegen bei der Signorie vorstellig geworden, habe jedoch nur erreicht, daß der
geschäftstüchtige Italiener nicht mehr das Monogramm, das schon damals berühmte A mit dem
eingestellten D, mißbrauchen durfte. Dürers Streben nach Ausschaltung unlauteren Wett-
bewerbs ist nur zu begreiflich; der Vertrieb von Drucken bildet ja das Rückgrat seiner wirt-
schaftlichen Existenz. Von höherer Warte gesehen, sind auch diese Nachdrucke und Fälschungen
Zeichen seiner unvergleichlichen Fruchtbarkeit; sie haben letztlich seine Kunst nur noch weiteren
Kreisen zugetragen, ihre Aussaat vervielfältigt und die Ernte unübersehbar reich werden lassen.
Wenn noch 1678 der Bologneser Kunstschriftsteller Malvasia schreibt: „Bettler wären alle die
Großen, die uns so eigenartig erscheinen, wenn sie sich einmal gezwungen sähen, an Dürer all
das zurückzuerstatten, was sie von ihm gestohlen haben“, so enthält dieser moralisierende Satz
in seiner rhetorisch übertreibenden Verkleidung dennoch einen guten Kern von Wahrheit.
So sehr Dürers eigenes Lebensgefühl und die Wirkung seines Schaffens in die Weite drängten,
so wenig ist namentlich die Graphik zu verstehen ohne das Bild Alt-Nürnbergs, dieser gewerbe-
reichen fränkischen Reichsstadt, wohlbefestigt, mit winkeligen Gassen, ungezählten spitzen
Fachwerkgiebeln, überragt von den gotischen Türmen der beiden Hauptkirchen St. Sebald und
5
Willibald Pirckheimer vom Ruhm des kurz vorher vollendeten Rosenkranzfestes in der
Lagunenstadt: „Und ich. habe auch die Maler alle zum Schweigen gebracht, die sagten, im
Stechen sei ich gut, aber beim Malen wüßte ich nicht mit Farben umzugehen. Jetzt spricht jeder-
mann, er habe schönere Farben nie gesehen.“
Wir vermögen die tiefe Befriedigung des Meisters nachzuempfinden. Durfte er sich nun doch
auch in Italien, in einem Zentrum hoher Malkultur, dem Ort der Bellini, Giorgiones und des
jungen Tizian, als Maler ebenbürtig fühlen. In der Tat ist Dürer 1506 ein großer Maler — er
war es immer und blieb es bis zu seinem Ende; die Vier Apostel von 1526, Vermächtnis an
seine Vaterstadt, zeugen davon.
Und doch: nicht Dürer, der Maler, hat Weltgeltung erlangt. Wird sein Name genannt, stehen
auch für uns heute zunächst graphische Werke geistig vor Augen, die großen Holzschnitt-Folgen
der Apokalypse, des Marienlebens, der Passion Christi und die Meisterstiche Ritter, Tod und
Teufel, Hieronymus im Gehaus und Melancholie.
Weit mehr als selbst Rembrandt, der andere große Maler-Graphiker der abendländischen Kunst,
erscheint Dürer in seiner Gegenwärtigkeit wie in seiner geschichtlichen Wirkung vom graphi-
schen Werk bestimmt. So ausschließlich gilt er weithin als ein Meister der Linie, daß darob
nahezu vergessen werden konnte, wie fest auch er beide Bereiche, Malerei und Graphik, um-
spannt. Ist es aber nicht gerade die Spannung zwischen diesen Polen, die in Dürer das Schöp-
ferische recht eigentlich entband, hat nicht erst sie seiner Kunst jene innere Fülle gegeben, die
in immer neuer Form Gestalt suchte? Wer spürte nicht die eminent graphische Begabung
Dürers selbst auf Gemälden, wie in der Hintergrundslandschaft der Florentiner Epiphanie
(1504), wäre aber nicht zugleich auch überwältigt von den malerischen Qualitäten namentlich
seiner Aquarelle, etwa dem Weiher im Walde (London).
Zahlenmäßig liegt das Schwergewicht seines Schaffens jedenfalls auf der Graphik: also dem
Tiefdruckverfahren des Kupferstichs, bei dem das abzubildende Liniengefüge in eine Kupfer-
platte graviert wird, und dem Hochdruckverfahren des Holzschnitts, bei dem die Zeichnung
nach der Bearbeitung durch den Formschneider erhaben zum Abdruck stehen bleibt.
Beispielhaft im Reichtum an Motiven, waren Dürers Drucke stets sehr bald nach ihrem Erschei-
nen über ganz Europa verbreitet. Der Meister verkauft oder verschenkt sie selber auf Reisen
oder läßt sie durch Kolporteure vertreiben; seine Frau besucht damit die Frankfurter Messe;
sogar seine alte Mutter bietet die Blätter gelegentlich des „Heiltumsmarktes“ in Nürnberg feil.
In einer Epoche, in der die Künstler sich noch weitgehend von bestimmten Vorlagen, „Exempla“,
leiten ließen, mußte der erfindungsreichen Kunst Dürers von vornherein außerordentliche Wir-
kung beschieden sein. Während die Gemälde naturgemäß bloß in beschränktem Umfang Ein-
fluß ausüben konnten, hat Dürer mit Kupferstichen und Holzschnitten weit über seinen Tod
hinaus allen Gattungen der bildenden Kunst — Malerei und Glasmalerei, Graphik und Kunst-
gewerbe — unablässig Anregungen gegeben. Viel unmittelbarer auch als durch seine theoreti-
schen Schriften, die doch nur wenige wirklich lasen, war er hier Vorbild, Ansporn, Lehrer.
Schon zu Dürers Lebzeiten bemächtigten sich Nachstecher und Fälscher seiner Graphiken.
Immerfort hatte Dürer um sein Urheberrecht zu kämpfen, oft mit zweifelhaftem Erfolg. Viel-
leicht war doch nicht lediglich der Ausbruch der Pest in Nürnberg Anlaß zu seiner Reise nach
Venedig im Jahr 1505; denn Vasari berichtet, der Künstler sei der Nachstiche Marcantonio
Raimondis wegen bei der Signorie vorstellig geworden, habe jedoch nur erreicht, daß der
geschäftstüchtige Italiener nicht mehr das Monogramm, das schon damals berühmte A mit dem
eingestellten D, mißbrauchen durfte. Dürers Streben nach Ausschaltung unlauteren Wett-
bewerbs ist nur zu begreiflich; der Vertrieb von Drucken bildet ja das Rückgrat seiner wirt-
schaftlichen Existenz. Von höherer Warte gesehen, sind auch diese Nachdrucke und Fälschungen
Zeichen seiner unvergleichlichen Fruchtbarkeit; sie haben letztlich seine Kunst nur noch weiteren
Kreisen zugetragen, ihre Aussaat vervielfältigt und die Ernte unübersehbar reich werden lassen.
Wenn noch 1678 der Bologneser Kunstschriftsteller Malvasia schreibt: „Bettler wären alle die
Großen, die uns so eigenartig erscheinen, wenn sie sich einmal gezwungen sähen, an Dürer all
das zurückzuerstatten, was sie von ihm gestohlen haben“, so enthält dieser moralisierende Satz
in seiner rhetorisch übertreibenden Verkleidung dennoch einen guten Kern von Wahrheit.
So sehr Dürers eigenes Lebensgefühl und die Wirkung seines Schaffens in die Weite drängten,
so wenig ist namentlich die Graphik zu verstehen ohne das Bild Alt-Nürnbergs, dieser gewerbe-
reichen fränkischen Reichsstadt, wohlbefestigt, mit winkeligen Gassen, ungezählten spitzen
Fachwerkgiebeln, überragt von den gotischen Türmen der beiden Hauptkirchen St. Sebald und
5