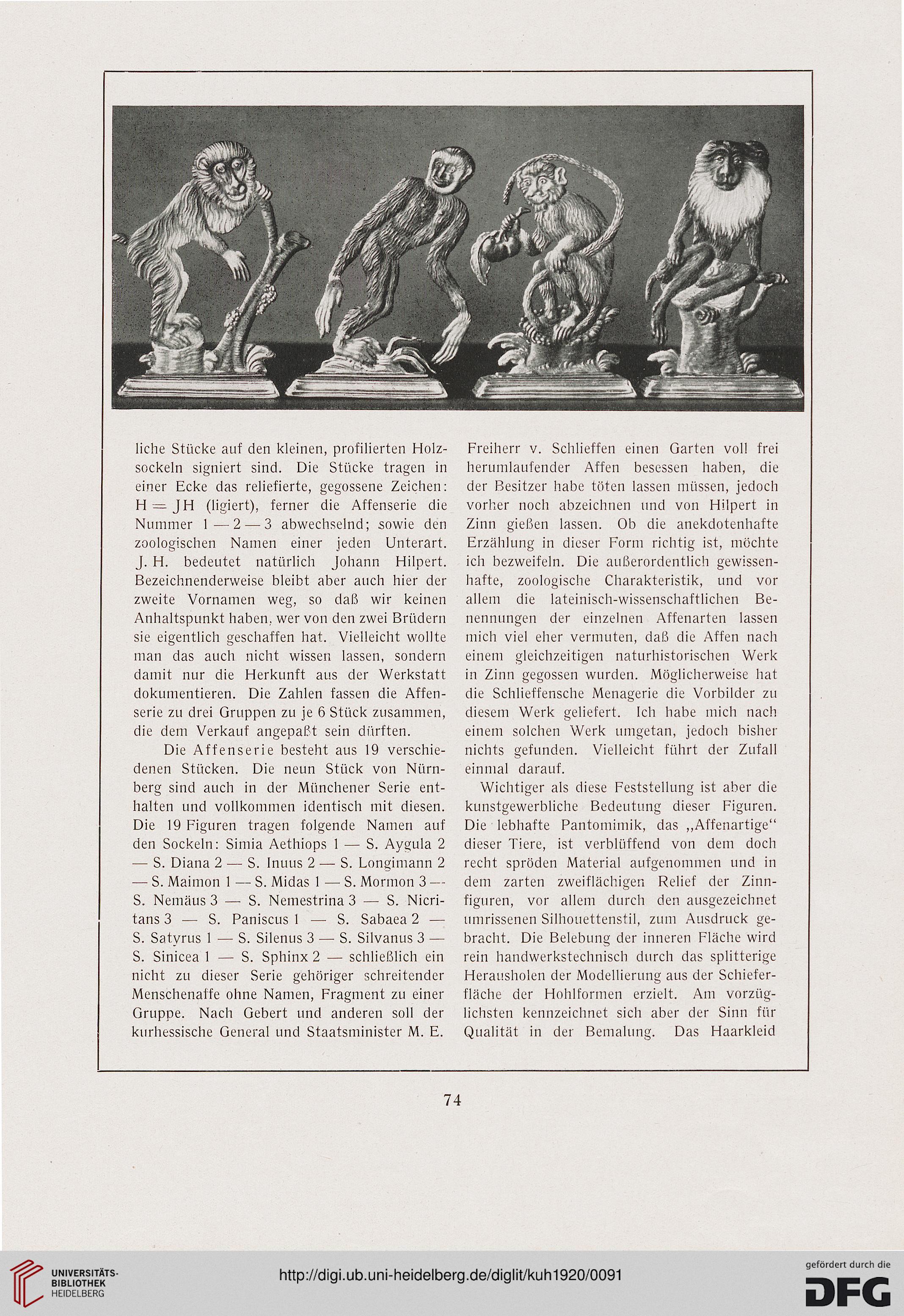liehe Stücke auf den kleinen, profilierten Holz-
sockeln signiert sind. Die Stücke tragen in
einer Ecke das reliefierte, gegossene Zeichen:
H = JH (ligiert), ferner die Affenserie die
Nummer 1—2 — 3 abwechselnd; sowie den
zoologischen Namen einer jeden Unterart.
J. H. bedeutet natürlich Johann Hilpert.
Bezeichnenderweise bleibt aber auch hier der
zweite Vornamen weg, so daß wir keinen
Anhaltspunkt haben, wer von den zwei Brüdern
sie eigentlich geschaffen hat. Vielleicht wollte
man das auch nicht wissen lassen, sondern
damit nur die Herkunft aus der Werkstatt
dokumentieren. Die Zahlen fassen die Affen-
serie zu drei Gruppen zu je 6 Stück zusammen,
die dem Verkauf angepaßt sein dürften.
Die Affenserie besteht aus 19 verschie-
denen Stücken. Die neun Stück von Nürn-
berg sind auch in der Münchener Serie ent-
halten und vollkommen identisch mit diesen.
Die 19 Figuren tragen folgende Namen auf
den Sockeln: Shnia Aethiops 1 — S. Aygula 2
— S. Diana 2 — S. Inuus 2 — S. Longimann 2
— S. Maimon 1 — S. Midas 1 — S. Mormon 3 —
S. Nemäus 3 — S. Nemestrina 3 — S. Nicri-
tans 3 — S. Paniscus 1 — S. Sabaea 2 —
S. Satyrus 1 — S. Silenus 3 — S. Silvanus 3 —
S. Sinicea 1 — S. Sphinx 2 — schließlich ein
nicht zu dieser Serie gehöriger schreitender
Menschenaffe ohne Namen, Fragment zu einer
Gruppe. Nach Gebert und anderen soll der
kurhessische General und Staatsminister M. E.
Freiherr v. Schlieffen einen Garten voll frei
herumlaufender Affen besessen haben, die
der Besitzer habe töten lassen müssen, jedoch
vorher noch abzeichnen und von Hilpert in
Zinn gießen lassen. Ob die anekdotenhafte
Erzählung in dieser Form richtig ist, möchte
ich bezweifeln. Die außerordentlich gewissen-
hafte, zoologische Charakteristik, und vor
allem die lateinisch-wissenschaftlichen Be-
nennungen der einzelnen Affenarten lassen
mich viel eher vermuten, daß die Affen nach
einem gleichzeitigen naturhistorischen Werk
in Zinn gegossen wurden. Möglicherweise hat
die Schlieffensche Menagerie die Vorbilder zu
diesem Werk geliefert. Ich habe mich nach
einem solchen Werk umgetan, jedoch bisher
nichts gefunden. Vielleicht führt der Zufall
einmal darauf.
Wichtiger als diese Feststellung ist aber die
kunstgewerbliche Bedeutung dieser Figuren.
Die lebhafte Pantomimik, das „Affenartige"
dieser Tiere, ist verblüffend von dem doch
recht spröden Material aufgenommen und in
dem zarten zweiflächigen Relief der Zinn-
figuren, vor allem durch den ausgezeichnet
umrissenen Silhouettenstil, zum Ausdruck ge-
bracht. Die Belebung der inneren Fläche wird
rein handwerkstechnisch durch das splitterige
Herausholen der Modellierung aus der Schiefer-
fläche der Hohlformen erzielt. Am vorzüg-
lichsten kennzeichnet sich aber der Sinn für
Qualität in der Bemalung. Das Haarkleid
74
sockeln signiert sind. Die Stücke tragen in
einer Ecke das reliefierte, gegossene Zeichen:
H = JH (ligiert), ferner die Affenserie die
Nummer 1—2 — 3 abwechselnd; sowie den
zoologischen Namen einer jeden Unterart.
J. H. bedeutet natürlich Johann Hilpert.
Bezeichnenderweise bleibt aber auch hier der
zweite Vornamen weg, so daß wir keinen
Anhaltspunkt haben, wer von den zwei Brüdern
sie eigentlich geschaffen hat. Vielleicht wollte
man das auch nicht wissen lassen, sondern
damit nur die Herkunft aus der Werkstatt
dokumentieren. Die Zahlen fassen die Affen-
serie zu drei Gruppen zu je 6 Stück zusammen,
die dem Verkauf angepaßt sein dürften.
Die Affenserie besteht aus 19 verschie-
denen Stücken. Die neun Stück von Nürn-
berg sind auch in der Münchener Serie ent-
halten und vollkommen identisch mit diesen.
Die 19 Figuren tragen folgende Namen auf
den Sockeln: Shnia Aethiops 1 — S. Aygula 2
— S. Diana 2 — S. Inuus 2 — S. Longimann 2
— S. Maimon 1 — S. Midas 1 — S. Mormon 3 —
S. Nemäus 3 — S. Nemestrina 3 — S. Nicri-
tans 3 — S. Paniscus 1 — S. Sabaea 2 —
S. Satyrus 1 — S. Silenus 3 — S. Silvanus 3 —
S. Sinicea 1 — S. Sphinx 2 — schließlich ein
nicht zu dieser Serie gehöriger schreitender
Menschenaffe ohne Namen, Fragment zu einer
Gruppe. Nach Gebert und anderen soll der
kurhessische General und Staatsminister M. E.
Freiherr v. Schlieffen einen Garten voll frei
herumlaufender Affen besessen haben, die
der Besitzer habe töten lassen müssen, jedoch
vorher noch abzeichnen und von Hilpert in
Zinn gießen lassen. Ob die anekdotenhafte
Erzählung in dieser Form richtig ist, möchte
ich bezweifeln. Die außerordentlich gewissen-
hafte, zoologische Charakteristik, und vor
allem die lateinisch-wissenschaftlichen Be-
nennungen der einzelnen Affenarten lassen
mich viel eher vermuten, daß die Affen nach
einem gleichzeitigen naturhistorischen Werk
in Zinn gegossen wurden. Möglicherweise hat
die Schlieffensche Menagerie die Vorbilder zu
diesem Werk geliefert. Ich habe mich nach
einem solchen Werk umgetan, jedoch bisher
nichts gefunden. Vielleicht führt der Zufall
einmal darauf.
Wichtiger als diese Feststellung ist aber die
kunstgewerbliche Bedeutung dieser Figuren.
Die lebhafte Pantomimik, das „Affenartige"
dieser Tiere, ist verblüffend von dem doch
recht spröden Material aufgenommen und in
dem zarten zweiflächigen Relief der Zinn-
figuren, vor allem durch den ausgezeichnet
umrissenen Silhouettenstil, zum Ausdruck ge-
bracht. Die Belebung der inneren Fläche wird
rein handwerkstechnisch durch das splitterige
Herausholen der Modellierung aus der Schiefer-
fläche der Hohlformen erzielt. Am vorzüg-
lichsten kennzeichnet sich aber der Sinn für
Qualität in der Bemalung. Das Haarkleid
74