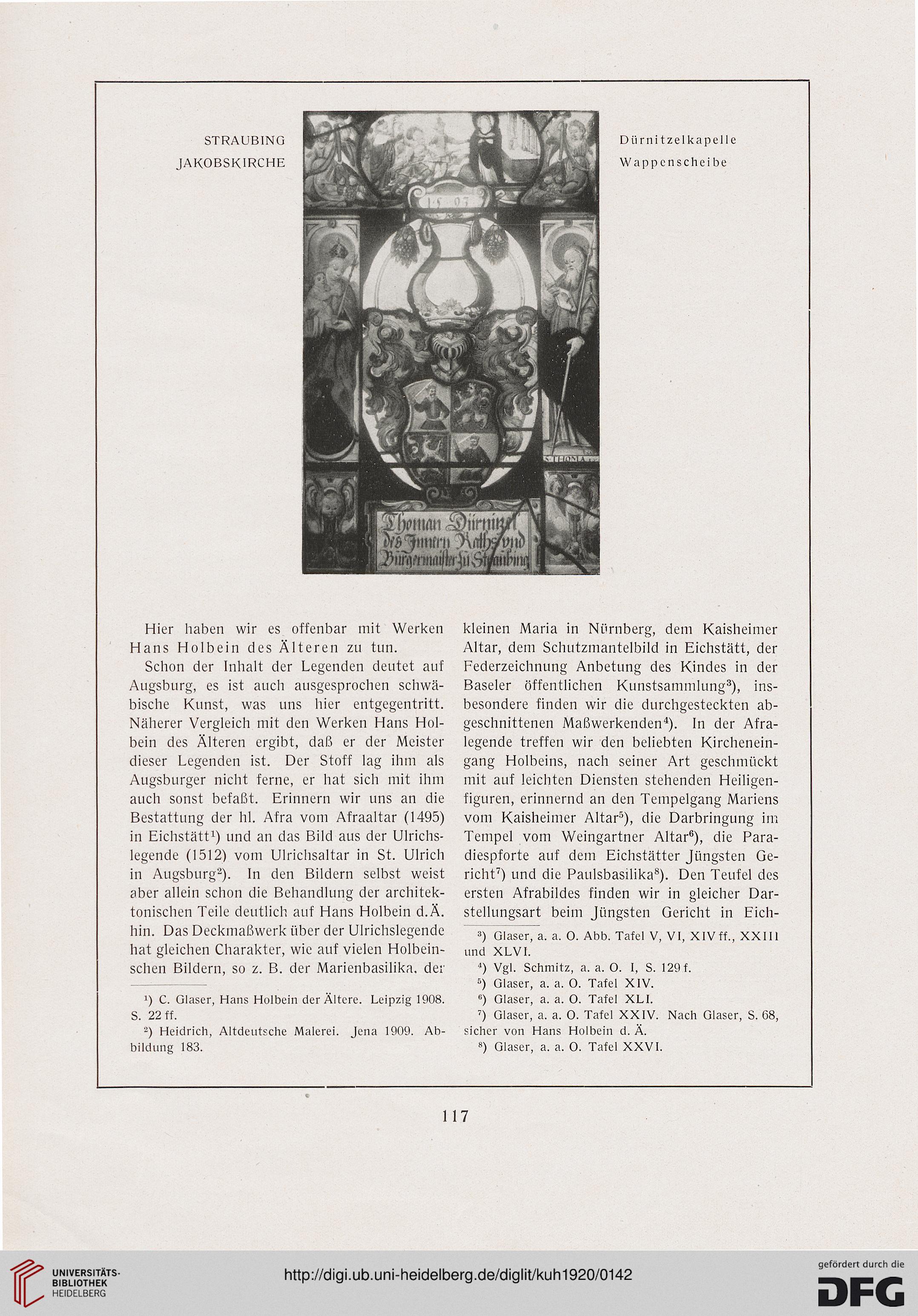STRAUBING
JAKOBSKIRCHE
Diirnitzelkapelle
Wappenscheibe
Hier haben wir es offenbar mit Werken
Hans Holbein des Älteren zu tun.
Schon der Inhalt der Legenden deutet auf
Augsburg, es ist auch ausgesprochen schwä-
bische Kunst, was uns hier entgegentritt.
Näherer Vergleich mit den Werken Hans Hol-
bein des Älteren ergibt, daß er der Meister
dieser Legenden ist. Der Stoff lag ihm als
Augsburger nicht ferne, er hat sich mit ihm
auch sonst befaßt. Erinnern wir uns an die
Bestattung der hl. Afra vom Afraaltar (1495)
in Eichstätt1) und an das Bild aus der Ulrichs-
legende (1512) vom Ulrichsaltar in St. Ulrich
in Augsburg2). In den Bildern selbst weist
aber allein schon die Behandlung der architek-
tonischen Teile deutlich auf Hans Holbein d.Ä.
hin. Das Deckmaßwerk über der Ulrichslegende
hat gleichen Charakter, wie auf vielen Holbein-
schen Bildern, so z. B. der Marienbasilika, der
*) C. Glaser, Hans Holbein der Ältere. Leipzig 1908.
S. 22 ff.
2) Heidrich, Altdeutsche Malerei. Jena 1909. Ab-
bildung 183.
kleinen Maria in Nürnberg, dem Kaisheimer
Altar, dem Schutzmantelbild in Eichstätt, der
Federzeichnung Anbetung des Kindes in der
Baseler öffentlichen Kunstsammlung3), ins-
besondere finden wir die durchgesteckten ab-
geschnittenen Maßwerkenden4). In der Afra-
legende treffen wir den beliebten Kirchenein-
gang Holbeins, nach seiner Art geschmückt
mit auf leichten Diensten stehenden Heiligen-
figuren, erinnernd an den Tempelgang Mariens
vom Kaisheimer Altar5), die Darbringung im
Tempel vom Weingartner Altar6), die Para-
diespforte auf dem Eichstätter Jüngsten Ge-
richt7) und die Paulsbasilika8). Den Teufel des
ersten Afrabildes finden wir in gleicher Dar-
stellungsart beim Jüngsten Gericht in Eich-
3) Glaser, a. a. O. Abb. Tafel V, VI, XIVff., XXIII
und XLVI.
J) Vgl. Schmitz, a. a. O. I, S. 129 f.
5) Glaser, a. a. O. Tafel XIV.
6) Glaser, a. a. O. Tafel XLI.
7) Glaser, a. a. O. Tafel XXIV. Nach Glaser, S. 68,
picher von Hans Holbein d. Ä.
8) Glaser, a. a. O. Tafel XXVI.
117
JAKOBSKIRCHE
Diirnitzelkapelle
Wappenscheibe
Hier haben wir es offenbar mit Werken
Hans Holbein des Älteren zu tun.
Schon der Inhalt der Legenden deutet auf
Augsburg, es ist auch ausgesprochen schwä-
bische Kunst, was uns hier entgegentritt.
Näherer Vergleich mit den Werken Hans Hol-
bein des Älteren ergibt, daß er der Meister
dieser Legenden ist. Der Stoff lag ihm als
Augsburger nicht ferne, er hat sich mit ihm
auch sonst befaßt. Erinnern wir uns an die
Bestattung der hl. Afra vom Afraaltar (1495)
in Eichstätt1) und an das Bild aus der Ulrichs-
legende (1512) vom Ulrichsaltar in St. Ulrich
in Augsburg2). In den Bildern selbst weist
aber allein schon die Behandlung der architek-
tonischen Teile deutlich auf Hans Holbein d.Ä.
hin. Das Deckmaßwerk über der Ulrichslegende
hat gleichen Charakter, wie auf vielen Holbein-
schen Bildern, so z. B. der Marienbasilika, der
*) C. Glaser, Hans Holbein der Ältere. Leipzig 1908.
S. 22 ff.
2) Heidrich, Altdeutsche Malerei. Jena 1909. Ab-
bildung 183.
kleinen Maria in Nürnberg, dem Kaisheimer
Altar, dem Schutzmantelbild in Eichstätt, der
Federzeichnung Anbetung des Kindes in der
Baseler öffentlichen Kunstsammlung3), ins-
besondere finden wir die durchgesteckten ab-
geschnittenen Maßwerkenden4). In der Afra-
legende treffen wir den beliebten Kirchenein-
gang Holbeins, nach seiner Art geschmückt
mit auf leichten Diensten stehenden Heiligen-
figuren, erinnernd an den Tempelgang Mariens
vom Kaisheimer Altar5), die Darbringung im
Tempel vom Weingartner Altar6), die Para-
diespforte auf dem Eichstätter Jüngsten Ge-
richt7) und die Paulsbasilika8). Den Teufel des
ersten Afrabildes finden wir in gleicher Dar-
stellungsart beim Jüngsten Gericht in Eich-
3) Glaser, a. a. O. Abb. Tafel V, VI, XIVff., XXIII
und XLVI.
J) Vgl. Schmitz, a. a. O. I, S. 129 f.
5) Glaser, a. a. O. Tafel XIV.
6) Glaser, a. a. O. Tafel XLI.
7) Glaser, a. a. O. Tafel XXIV. Nach Glaser, S. 68,
picher von Hans Holbein d. Ä.
8) Glaser, a. a. O. Tafel XXVI.
117