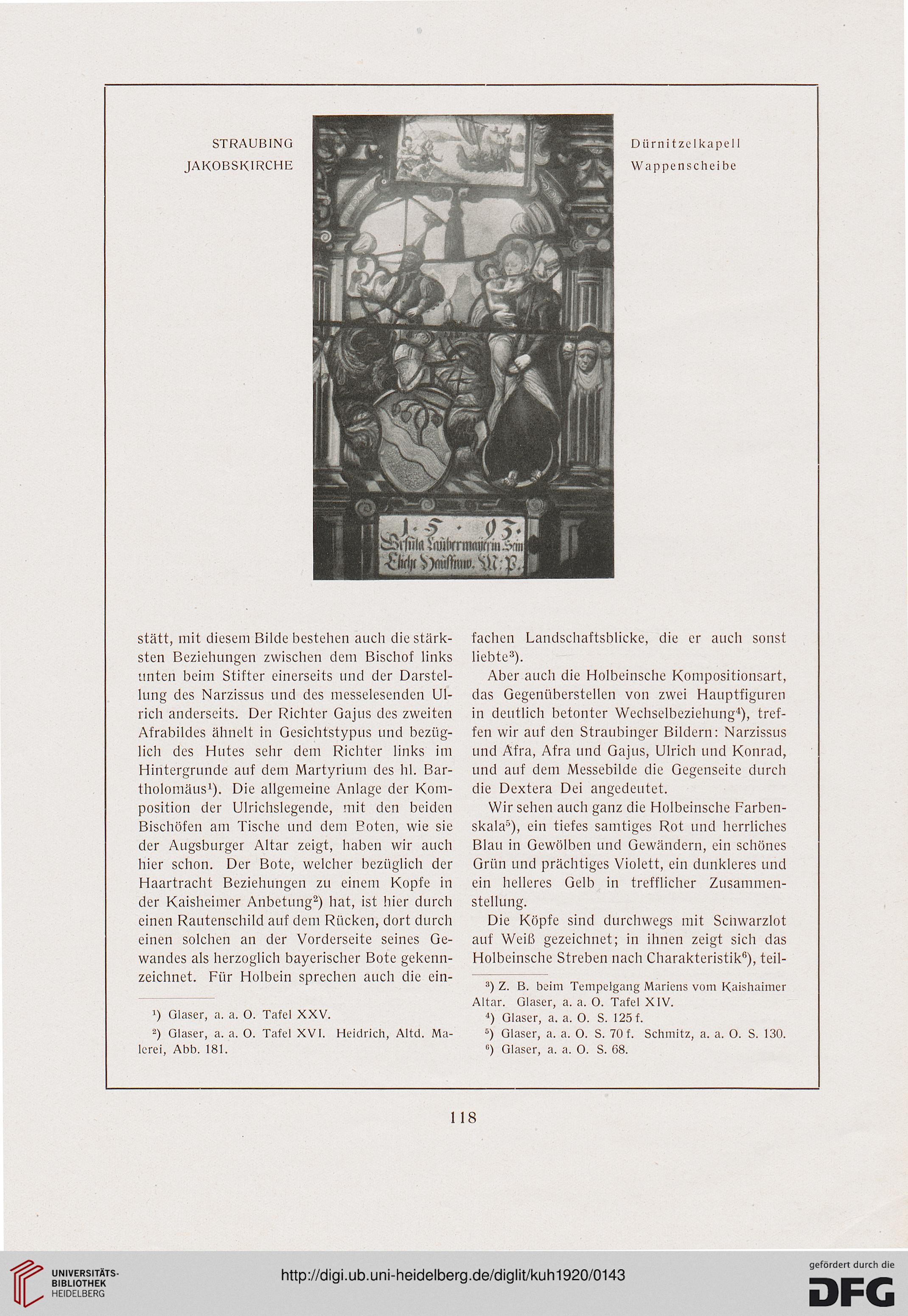STRAUBING
JAKOBSKIRCHE
Diirnitzclkapell
Wappenscheibe
statt, mit diesem Bilde bestehen auch die stärk-
sten Beziehungen zwischen dem Bischof links
unten beim Stifter einerseits und der Darstel-
lung des Narzissus und des messelesenden Ul-
rich anderseits. Der Richter Gajus des zweiten
Afrabildes ähnelt in Gesichtstypus und bezüg-
lich des Hutes sehr dem Richter links im
Hintergrunde auf dem Martyrium des hl. Bar-
tholomäus1). Die allgemeine Anlage der Kom-
position der Ulrichslegende, mit den beiden
Bischöfen am Tische und dem Boten, wie sie
der Augsburger Altar zeigt, haben wir auch
hier schon. Der Bote, welcher bezüglich der
Haartracht Beziehungen zu einem Kopfe in
der Kaisheimer Anbetung2) hat, ist hier durch
einen Rautenschild auf dem Rücken, dort durch
einen solchen an der Vorderseite seines Ge-
wandes als herzoglich bayerischer Bote gekenn-
zeichnet. Für Holbein sprechen auch die ein-
') Glaser, a. a. O. Tafel XXV.
2) Glaser, a. a. O. Tafel XVI. Heidrich, Altd. Ma-
lerei, Abb. 181.
fachen Landschaftsblicke, die er auch sonst
liebte3).
Aber auch die Holbeinsche Kompositionsart,
das Gegenüberstellen von zwei Hauptfiguren
in deutlich betonter Wechselbeziehung4), tref-
fen wir auf den Straubinger Bildern: Narzissus
und Afra, Afra und Gajus, Ulrich und Konrad,
und auf dem Messebilde die Gegenseite durch
die Dextera Dei angedeutet.
Wir sehen auch ganz die Holbeinsche Farben-
skala5), ein tiefes samtiges Rot und herrliches
Blau in Gewölben und Gewändern, ein schönes
Grün und prächtiges Violett, ein dunkleres und
ein helleres Gelb in trefflicher Zusammen-
stellung.
Die Köpfe sind durchwegs mit Schwarzlot
auf Weiß gezeichnet; in ihnen zeigt sich das
Holbeinsche Streben nach Charakteristik6), teil-
3) Z. B. beim Tempelgang Mariens vom Kaishaimer
Altar. Glaser, a. a. O. Tafel XIV.
4) Glaser, a. a. O. S. 125 f.
5) Glaser, a. a. O. S. 70 f. Schmitz, a. a. O. S. 130.
°) Glaser, a. a. 0. S. 68.
118
JAKOBSKIRCHE
Diirnitzclkapell
Wappenscheibe
statt, mit diesem Bilde bestehen auch die stärk-
sten Beziehungen zwischen dem Bischof links
unten beim Stifter einerseits und der Darstel-
lung des Narzissus und des messelesenden Ul-
rich anderseits. Der Richter Gajus des zweiten
Afrabildes ähnelt in Gesichtstypus und bezüg-
lich des Hutes sehr dem Richter links im
Hintergrunde auf dem Martyrium des hl. Bar-
tholomäus1). Die allgemeine Anlage der Kom-
position der Ulrichslegende, mit den beiden
Bischöfen am Tische und dem Boten, wie sie
der Augsburger Altar zeigt, haben wir auch
hier schon. Der Bote, welcher bezüglich der
Haartracht Beziehungen zu einem Kopfe in
der Kaisheimer Anbetung2) hat, ist hier durch
einen Rautenschild auf dem Rücken, dort durch
einen solchen an der Vorderseite seines Ge-
wandes als herzoglich bayerischer Bote gekenn-
zeichnet. Für Holbein sprechen auch die ein-
') Glaser, a. a. O. Tafel XXV.
2) Glaser, a. a. O. Tafel XVI. Heidrich, Altd. Ma-
lerei, Abb. 181.
fachen Landschaftsblicke, die er auch sonst
liebte3).
Aber auch die Holbeinsche Kompositionsart,
das Gegenüberstellen von zwei Hauptfiguren
in deutlich betonter Wechselbeziehung4), tref-
fen wir auf den Straubinger Bildern: Narzissus
und Afra, Afra und Gajus, Ulrich und Konrad,
und auf dem Messebilde die Gegenseite durch
die Dextera Dei angedeutet.
Wir sehen auch ganz die Holbeinsche Farben-
skala5), ein tiefes samtiges Rot und herrliches
Blau in Gewölben und Gewändern, ein schönes
Grün und prächtiges Violett, ein dunkleres und
ein helleres Gelb in trefflicher Zusammen-
stellung.
Die Köpfe sind durchwegs mit Schwarzlot
auf Weiß gezeichnet; in ihnen zeigt sich das
Holbeinsche Streben nach Charakteristik6), teil-
3) Z. B. beim Tempelgang Mariens vom Kaishaimer
Altar. Glaser, a. a. O. Tafel XIV.
4) Glaser, a. a. O. S. 125 f.
5) Glaser, a. a. O. S. 70 f. Schmitz, a. a. O. S. 130.
°) Glaser, a. a. 0. S. 68.
118