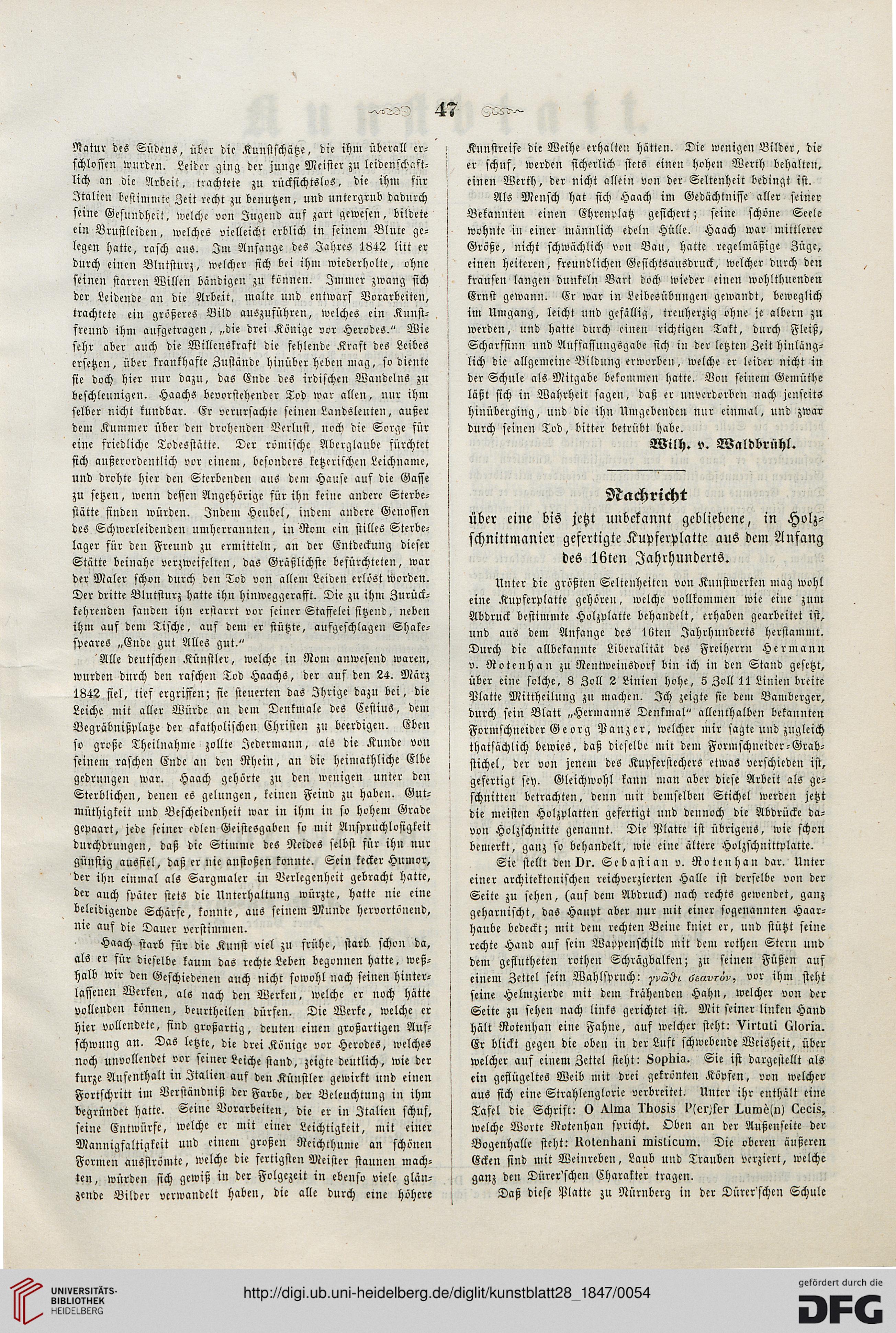47
Natur des Südens, über die Kunstschätze, die ihm überall er- >
schlossen wurden. Leider ging der junge Meister zu leidenschaft- j
Itd) an die Arbeit, trachtete zu rücksichtslos, die ihm für
Italien bestimmte Zeit recht zu benutzen, und untergrub dadurch
seine Gesundheit, welche von Jugend auf zart gewesen, bildete
ein Vrustleiden, welches vielleicht erblich in seinem Blute ge-
legen hatte, rasch aus. Im Anfänge des Jahres 1842 litt er
durch einen Blntsturz, welcher sich bei ihm wiederholte, ohne
seinen starren Willen bändigen zu können. Immer zwang sich
der Leidende an die Arbeit, malte und entwarf Vorarbeiten,
trachtete ein größeres Bild auszuführen, welches ein Kunst-
freund ihm aufgetragen, „die drei Könige vor Hervdes." Wie
sehr aber auch die Willenskraft die fehlende Kraft des Leibes
ersetzen, über krankhafte Zustände hinüber heben mag, so diente
sie doch hier nur dazu, das Ende des irdischen Waudelns zu
beschleunigen. Haachs bevorstehender Tod war allen, nur ihm
selber nicht kündbar. Er verursachte seinen Landsleuten, außer
dem Kummer über den drohenden Verlust, noch die Sorge für
eine friedliche Todesstätte. Der römische Aberglaube fürchtet
sich außerordentlich vor einem, besonders ketzerischen Leichname,
und drohte hier den Sterbenden ans dem Hause auf die Gaffe
zu setzen, wenn dessen Angehörige für ihn keine andere Sterbe-
siätte finden würden. Indem Henbel, indem andere Genossen
des Schwerleidenden umherranutcn, in Rom ein stilles Sterbe-
lager für den Freund zu ermitteln, an der Entdeckung dieser
Stätte beinahe verzweifelten, das Gräßlichste befürchteten, war
der Maler schon durch den Tod von allem Leiden erlöst worden.
Der dritte Blutsturz hatte ihn hinweggcrafft. Die zu ihm Zurück-
kehrenden fanden ihn erstarrt vor seiner Stasselci sitzend, neben
ihm auf dem Tische, auf dem er stützte, aufgcschlageu Shake-
speares „Ende gut Alles gut."
'Alle deutschen Künstler, welche in Rom anwesend waren,
wurden durch den raschen Tod Haachs, der auf den 24. März
1842 fiel, tief ergriffen; sie steuerten das Ihrige dazu bei, die
Leiche mit aller Würde an dem Denkmale des Cestius, dem
Begräbnißplatze der akatholischen Christen zu beerdigen. Eben
so große Theilnahme zollte Jedermann, als die Kunde von
seinem raschen Ende an den Rhein, an die heimathliche Elbe |
gedrungen war. Haach gehörte zu den wenigen unter den !
Sterblichen, denen es gelungen, keinen Feind zu haben. Gut-
müthigkeit und Bescheidenheit war in ihm in so hohem Grade
gepaart, jede seiner edlen Geistesgabcn so mit Ansprnchlvsigkeit
durchdrungen, daß die Stimme des Neides selbst für ihn nur
günstig ausfiel, daß er nie anstoßen konnte. Sein kecker Humor,
der ihn einmal als Sargmaler in Verlegenheit gebracht hatte,
der auch später stets die Unterhaltung würzte, hatte nie eine
beleidigende Schärfe, konnte, ans seinem Munde hervortönend,
nre auf die Dauer verstimmen.
Haach starb für die Kunst viel zu frühe, starb schon da,
als er für dieselbe kaum das rechte Leben begonnen hatte, weß-
halb wir den Geschiedenen auch nicht sowohl nach seinen hinter-
lassenen Werken, als nach den Werken, welche er noch hätte
vollenden können, beurtheilen dürfen. Die Werke, welche er
hier vollendete, sind großartig, deuten einen großartigen Auf-
schwung an. Das letzte, die drei Könige vor Hervdes, welches
noch unvollendet vor seiner Leiche stand, zeigte deutlich, wie der
kurze Aufenthalt in Italien auf den Künstler gewirkt und einen
Fortschritt im Verständniß der Farbe, der Beleuchtung in ihm
begründet hatte. Seine Vorarbeiten, die er in Italien schuf,
seine Entwürfe, welche er mit einer Leichtigkeit, mit einer
Mannigfaltigkeit und cincni großen Rcichthnme an schönen
Formen ausströmte, welche die fertigsten Meister staunen mach-
ten, würden sich gewiß in der Folgezeit in ebenso viele glän-
zende Bilder verwandelt haben, die alle durch eine höhere
Kunstreife die Weihe erhalten hätten. Die wenigen Bilder, die
er schuf, werden sicherlich stets einen hohen Werth behalten,
einen Werth, der nicht allein von der Seltenheit bedingt ist.
Als Mensch hat sich Haach in, Gedächtnisse aller seiner
Bekannten einen Ehrenplatz gesichert; seine schöne Seele
wohnte in einer männlich edel» Hülle. Haach war mittlerer
Größe, nicht schwächlich von Bau, hatte regelmäßige Züge,
einen heiteren, freundlichen Gcstchtsausdruck, welcher durch den
krausen langen dunkeln Bart doch wieder einen wohlthucnden
Ernst gewann. Er war in Leibesübungen gewandt, beweglich
im Umgang, leicht und gefällig, treuherzig ohne je albern zu
werden, und hatte durch einen richtigen Takt, durch Fleiß,
Scharfsinn und Auffassungsgabe sich in der letzten Zeit hinläng-
lich die allgemeine Bildung erworben, welche er leider nicht in
der Schule als Mitgabe bekommen hatte. Von seinem Gemüthe
läßt sich in Wahrheit sagen, daß er unverdorben nach jenseits
hinüberging, und die ihn Umgebenden nur einmal, und zwar
durch seinen Tod, bitter betrübt habe.
Wilh. v. Waldbrnhl.
Nachricht
über eine bis jetzt unbekannt gebliebene, in Hvlz-
schnittmanier gefertigte Kupferplatte aus dem Anfang
des 16ten Jahrhunderts.
Unter die größten Seltenheiten von Kunstwerken mag wohl
eine Kupferplatte gehören, welche vollkommen wie eine zum
Abdruck bestimmte Holzplatte behandelt, erhaben gearbeitet ist,
und aus dem Anfänge des löten Jahrhunderts herstammt.
Durch die allbekannte Liberalität des Freiherrn Hermann
v. Rotenhan zu Rentweinsdorf bin ich in den Stand gesetzt,
über eine solche, 8 Zoll 2 Linien hohe, 5 Zoll 11 Linien breite
Platte Mittheilung zu machen. Ich zeigte sic dem Bamberger,
durch sein Blatt „Hermanns Denkmal" allenthalben bekannten
Formschneider Georg Panzer, welcher mir sagte und zugleich
thatsächlich bewies, daß dieselbe mit dem Formschneider-Grab-
stichel, der von jenem des Kupferstechers etwas verschieden ist,
gefertigt sch. Gleichwohl kann man aber diese Arbeit als ge-
schnitten betrachten, denn mit demselben Stichel werden jetzt
die meisten Holzplatten gefertigt und dennoch die Abdrücke da-
von Holzschnitte genannt. Die Platte ist übrigens, wie schon
bemerkt, ganz so behandelt, wie eine ältere Hvlzschnittplatte.
Sic stellt den Dr. Sebastian v. Rotenhan dar. Unter
einer architektonischen reichverzierten Halle ist derselbe von der
Seite zu sehen, (auf dem Abdruck) nach rechts gewendet, ganz
geharnischt, das Haupt aber nur mit einer sogenannten Haar-
haube bedeckt; mit dem rechten Beine kniet er, und stützt seine
rechte Hand auf sei» Wappenschild mit dem rothen Stern und
dem gesiutheten rothen Schrägbalken; zn seinen Füßen auf
einem Zettel sein Wahlspruch: üeavrüv, vor ihm steht
seine Helmzicrde mit dem krähenden Hahn, welcher von der
Seite zu sehen nach links gerichtet ist. Mit seiner linken Hand
hält Rotenhan eine Fahne, auf welcher steht: Virluli Gloria.
Er blickt gegen die oben in der Luft schwebende Weisheit, über
welcher auf eiuem Zettel steht: Sophia. Sie ist dargestellt als
ein geflügeltes Weib mit drei gekrönten Köpfen, von welcher
aus sich eine Strahlenglorie verbreitet. Unter ihr enthält eine
Tafel die Schrift: 0 Alma Thosis P(cr)fcr Lurae(n) Cccis,
welche Worte Rotenhan spricht. Oben an der Außenseite der
Bogenhalle steht: llotenhani mislicum. Die oberen äußeren
Ecken sind mit Weinreben, Laub und Trauben verziert, welche
ganz den Dürersschcn Charakter tragen.
Daß diese Platte zu Nürnberg in der Dürer'schen Schule