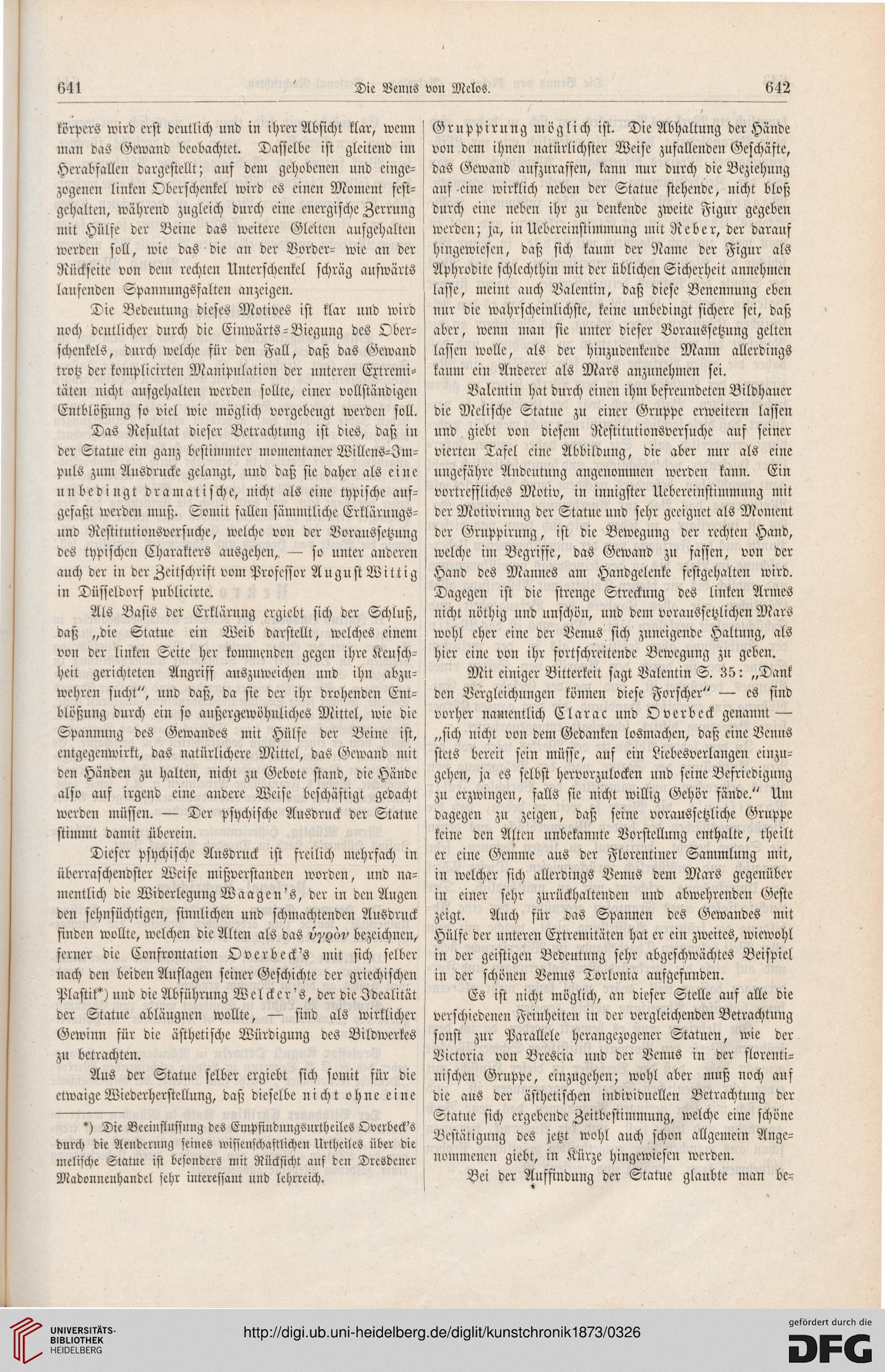641
Die Venns vou Melos.
642
körpcrs wird crst vcutlich und in ihrcr Absicht klar, wcnn
man das Gcwand beobachtct. Dasselbe ist glcitend im
Herabfallcn dargestcllt; auf dcm gehobenen und cinge-
zogencn linken Obcrschenkel wird es cincn Momcnt fest-
gchalten, während zugleich durch eine cnergischc Zcrrung
mit Hülfe der Beine das weitere Gleitcn aufgehalten
wcrdcn soll, wie das die an der Bordcr- wie an der
Rnckseite von dem rechten Unterschenkcl schräg aufwärts
laufcnden Spannungsfaltcn anzeigen.
Die Bedeutung dieses Motives ist klar und wird
noch deutlicher durch die Einwärts-Bicgung des Ober-
schenkels, durch wclchc für den Fall, daß das Gewand
trotz der komplicirten Manipulation der unteren Extremi-
täten nicht aufgehalten werden sollte, ciner vollständigen
Entblößung so viel wie möglich vorgcbeugt werden soll.
Das Resultat dicser Betrachtung ist dies, daß in
dcr Statue ein ganz bestimmtcr momentaner Willcns-Jm-
puls znm Ausdrucke gelangt, und daß sie daher als eine
unbedingt dramatischc, nicht als eine typische auf-
gefaßt werdcn muß. Somit sallen sämmtliche Erklärungs-
und Rcstitntionsversuche, wclchc von der Voranssetzung
des typischcn Charakters ausgehen,. — so unter anderen
auch der in der Zeitschrift vom Professor August Wittig
in Düsseldorf publicirtc.
Als Basis der Erklärung ergicbt sich der Schluß,
daß „die Statue ein Weib darstellt, wclches einem
von der linkcn Seitc hcr kommenden gcgcn ihre Keusch-
heit gcrichteten Angriff auszuweichcn und ihn abzn-
wehren sncht", und daß, da sie der ihr drohenden Ent-
blößung durch ein so außergewöhnliches Mittel, wie dic
Spannung des Gewandes mit Hülfc der Bcinc ist,
cntgegenwirkt, das natürlichcre Mittel, das Gcwand mit
den Händen zu halten, nicht zu Gebote stand, die Hände
also auf irgend eine andere Weise beschäftigt gedacht
werdcn müssen. — Der psychischc Ausdruck der Statue
stimmt damit überein.
Diescr psychische Ausdruck ist freilich mehrfach in
überraschendster Weise mißverstanden worden, nnd na-
mentlich die Widerlegung Waagen's, der in dcn Augen
den sehnsüchtigen, sinnlichen und schmachtenden Ausdruck
finden wollte, welchen die Alten als das bezeichnen/
ferner die Confrontation Overbeck's mit sich selber
nach den beiden Auflagcn seiner Geschichte der griechischen
Plastik*) und die Abführnng Welcker' s, der dic Jdealität
der Statne abläugncn wollte, — sind als wirklicher
Gewinn für die ästhetische Würdigung des Bildwerkes
zu bctrachten.
Aus der Statue selber ergiebt sich somit für die
etwaige Wiederherstellung, daß dieselbe nicht ohne eine
') Die Beeinflussimg des Empfindungsurtheiles Overbeck's
durch die Aendernng seines wissenschastlichen Urtheiles über die
melische Slatue ist besonders mit Rücksicht auf den Dresdener
Madonnenhandel sehr interessant und lehrreich,
Grnppirung möglich ist. Die Abhaltung der Hände
von dcm ihncn natürlichster Weisc zufallcnden Geschäfte,
das Gewand aufzuraffcn, kann nur dnrch die Bcziehung
anf.cine wirklich neben dcr Statue stchende, nicht bloß
durch eine neben ihr zu denkende zweite Figur gegeben
werden; ja, in Uebereinstimmung mit Reber, der darauf
hingewiesen, daß sich kaum der Name der Figur als
Aphrodite schlechthin mit der üblichen Sichcrheit annehmcn
lasse, meint auch Valentin, daß diese Benennung eben
nur die wahrscheinlichste, keine unbedingt sichere sei, daß
aber, wenn man sie unter dieser Voraussetzung gelten
lassen wolle, als der hinzudenkende Mann allerdings
kaum ein Anderer als Mars anzunehmen sei.
Valcntin hat durch cincn ihm befreundetcn Bildhaner
die Melische Statue zu einer Gruppe erweitern lassen
und giebt von diesem Restitutionsversuche auf seiner
vierten Tafel eine Abbildung, dic aber nur als eine
ungefähre Andcutuug angcnommeu werden kaun. Ein
vortreffliches Motiv, in innigster Uebereinstimmung mit
dcr Motivirung der Statue und sehr gccignct als Momcnt
der Gruppirung, ist die Bewegung der rechten Hand,
welche im Begriffe, das Gewand zu fassen, von der
Hand des Mannes am Handgelenke festgehalten wird.
Dagegen ist die strenge Streckung des linken Armes
nicht nöthig und unschön, und dem voraussetzlichen Mars
wohl chcr eine der Vcnus sich zuneigende Haltung, als
hier eine von ihr fortschreitende Bewegung zu geben.
Mit einiger Bitterkeit sagt Valentin S. 35: „Dank
den Vergleichungen könncn diese Forschcr" — es sind
vorher namentlich Clarac und Overbeck genannt —
„sich nicht von dem Gcdanken losmachen, daß eine Vcuus
stets bereit sein müsse, auf ein Liebesverlangen einzu-
gehen, ja es sclbst hervorzulocken und seine Befriedigung
zu erzwingen, falls sie nicht willig Gehör fände." Um
dagegen zu zeigen, daß seine voraussctzliche Gruppe
keine den Alten unbekannte Vorstellung enthalte, theilt
er eine Gemme aus der Florentiner Sammlung mit,
in welcher sich allerdings Venus dem Mars gegenüber
in einer sehr zurückhaltenden und abwehrendcn Geste
zcigt. Auch für das Spannen dcs Gewandes nnt
Hülfe der unteren Extremitätcn hat er ein zwcites, wiewohl
in der geistigcn Bedcutung sehr abgeschwächtes Beispiel
in der schönen Venus Torlonia aufgcfunden.
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf alle die
verschiedenen Feinheiten in der vergleichenden Betrachtung
sonst zur Parallele herangczogener Statuen, wie der
Victoria von Brescia und der Venus in der florenti-
nischen Gruppe, einzugehen; wohl aber muß noch auf
die aus der ästhetischen individuellen Betrachtung der
Statue sich crgebendc Zeitbestimmung, welchc eine schöne
Bestätigung des jetzt wohl auch schon allgemein Ange-
nommenen giebt, in Kürze hingewiesen wcrden.
Bei der Auffindung dcr Statue glaubte man be-
Die Venns vou Melos.
642
körpcrs wird crst vcutlich und in ihrcr Absicht klar, wcnn
man das Gcwand beobachtct. Dasselbe ist glcitend im
Herabfallcn dargestcllt; auf dcm gehobenen und cinge-
zogencn linken Obcrschenkel wird es cincn Momcnt fest-
gchalten, während zugleich durch eine cnergischc Zcrrung
mit Hülfe der Beine das weitere Gleitcn aufgehalten
wcrdcn soll, wie das die an der Bordcr- wie an der
Rnckseite von dem rechten Unterschenkcl schräg aufwärts
laufcnden Spannungsfaltcn anzeigen.
Die Bedeutung dieses Motives ist klar und wird
noch deutlicher durch die Einwärts-Bicgung des Ober-
schenkels, durch wclchc für den Fall, daß das Gewand
trotz der komplicirten Manipulation der unteren Extremi-
täten nicht aufgehalten werden sollte, ciner vollständigen
Entblößung so viel wie möglich vorgcbeugt werden soll.
Das Resultat dicser Betrachtung ist dies, daß in
dcr Statue ein ganz bestimmtcr momentaner Willcns-Jm-
puls znm Ausdrucke gelangt, und daß sie daher als eine
unbedingt dramatischc, nicht als eine typische auf-
gefaßt werdcn muß. Somit sallen sämmtliche Erklärungs-
und Rcstitntionsversuche, wclchc von der Voranssetzung
des typischcn Charakters ausgehen,. — so unter anderen
auch der in der Zeitschrift vom Professor August Wittig
in Düsseldorf publicirtc.
Als Basis der Erklärung ergicbt sich der Schluß,
daß „die Statue ein Weib darstellt, wclches einem
von der linkcn Seitc hcr kommenden gcgcn ihre Keusch-
heit gcrichteten Angriff auszuweichcn und ihn abzn-
wehren sncht", und daß, da sie der ihr drohenden Ent-
blößung durch ein so außergewöhnliches Mittel, wie dic
Spannung des Gewandes mit Hülfc der Bcinc ist,
cntgegenwirkt, das natürlichcre Mittel, das Gcwand mit
den Händen zu halten, nicht zu Gebote stand, die Hände
also auf irgend eine andere Weise beschäftigt gedacht
werdcn müssen. — Der psychischc Ausdruck der Statue
stimmt damit überein.
Diescr psychische Ausdruck ist freilich mehrfach in
überraschendster Weise mißverstanden worden, nnd na-
mentlich die Widerlegung Waagen's, der in dcn Augen
den sehnsüchtigen, sinnlichen und schmachtenden Ausdruck
finden wollte, welchen die Alten als das bezeichnen/
ferner die Confrontation Overbeck's mit sich selber
nach den beiden Auflagcn seiner Geschichte der griechischen
Plastik*) und die Abführnng Welcker' s, der dic Jdealität
der Statne abläugncn wollte, — sind als wirklicher
Gewinn für die ästhetische Würdigung des Bildwerkes
zu bctrachten.
Aus der Statue selber ergiebt sich somit für die
etwaige Wiederherstellung, daß dieselbe nicht ohne eine
') Die Beeinflussimg des Empfindungsurtheiles Overbeck's
durch die Aendernng seines wissenschastlichen Urtheiles über die
melische Slatue ist besonders mit Rücksicht auf den Dresdener
Madonnenhandel sehr interessant und lehrreich,
Grnppirung möglich ist. Die Abhaltung der Hände
von dcm ihncn natürlichster Weisc zufallcnden Geschäfte,
das Gewand aufzuraffcn, kann nur dnrch die Bcziehung
anf.cine wirklich neben dcr Statue stchende, nicht bloß
durch eine neben ihr zu denkende zweite Figur gegeben
werden; ja, in Uebereinstimmung mit Reber, der darauf
hingewiesen, daß sich kaum der Name der Figur als
Aphrodite schlechthin mit der üblichen Sichcrheit annehmcn
lasse, meint auch Valentin, daß diese Benennung eben
nur die wahrscheinlichste, keine unbedingt sichere sei, daß
aber, wenn man sie unter dieser Voraussetzung gelten
lassen wolle, als der hinzudenkende Mann allerdings
kaum ein Anderer als Mars anzunehmen sei.
Valcntin hat durch cincn ihm befreundetcn Bildhaner
die Melische Statue zu einer Gruppe erweitern lassen
und giebt von diesem Restitutionsversuche auf seiner
vierten Tafel eine Abbildung, dic aber nur als eine
ungefähre Andcutuug angcnommeu werden kaun. Ein
vortreffliches Motiv, in innigster Uebereinstimmung mit
dcr Motivirung der Statue und sehr gccignct als Momcnt
der Gruppirung, ist die Bewegung der rechten Hand,
welche im Begriffe, das Gewand zu fassen, von der
Hand des Mannes am Handgelenke festgehalten wird.
Dagegen ist die strenge Streckung des linken Armes
nicht nöthig und unschön, und dem voraussetzlichen Mars
wohl chcr eine der Vcnus sich zuneigende Haltung, als
hier eine von ihr fortschreitende Bewegung zu geben.
Mit einiger Bitterkeit sagt Valentin S. 35: „Dank
den Vergleichungen könncn diese Forschcr" — es sind
vorher namentlich Clarac und Overbeck genannt —
„sich nicht von dem Gcdanken losmachen, daß eine Vcuus
stets bereit sein müsse, auf ein Liebesverlangen einzu-
gehen, ja es sclbst hervorzulocken und seine Befriedigung
zu erzwingen, falls sie nicht willig Gehör fände." Um
dagegen zu zeigen, daß seine voraussctzliche Gruppe
keine den Alten unbekannte Vorstellung enthalte, theilt
er eine Gemme aus der Florentiner Sammlung mit,
in welcher sich allerdings Venus dem Mars gegenüber
in einer sehr zurückhaltenden und abwehrendcn Geste
zcigt. Auch für das Spannen dcs Gewandes nnt
Hülfe der unteren Extremitätcn hat er ein zwcites, wiewohl
in der geistigcn Bedcutung sehr abgeschwächtes Beispiel
in der schönen Venus Torlonia aufgcfunden.
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf alle die
verschiedenen Feinheiten in der vergleichenden Betrachtung
sonst zur Parallele herangczogener Statuen, wie der
Victoria von Brescia und der Venus in der florenti-
nischen Gruppe, einzugehen; wohl aber muß noch auf
die aus der ästhetischen individuellen Betrachtung der
Statue sich crgebendc Zeitbestimmung, welchc eine schöne
Bestätigung des jetzt wohl auch schon allgemein Ange-
nommenen giebt, in Kürze hingewiesen wcrden.
Bei der Auffindung dcr Statue glaubte man be-