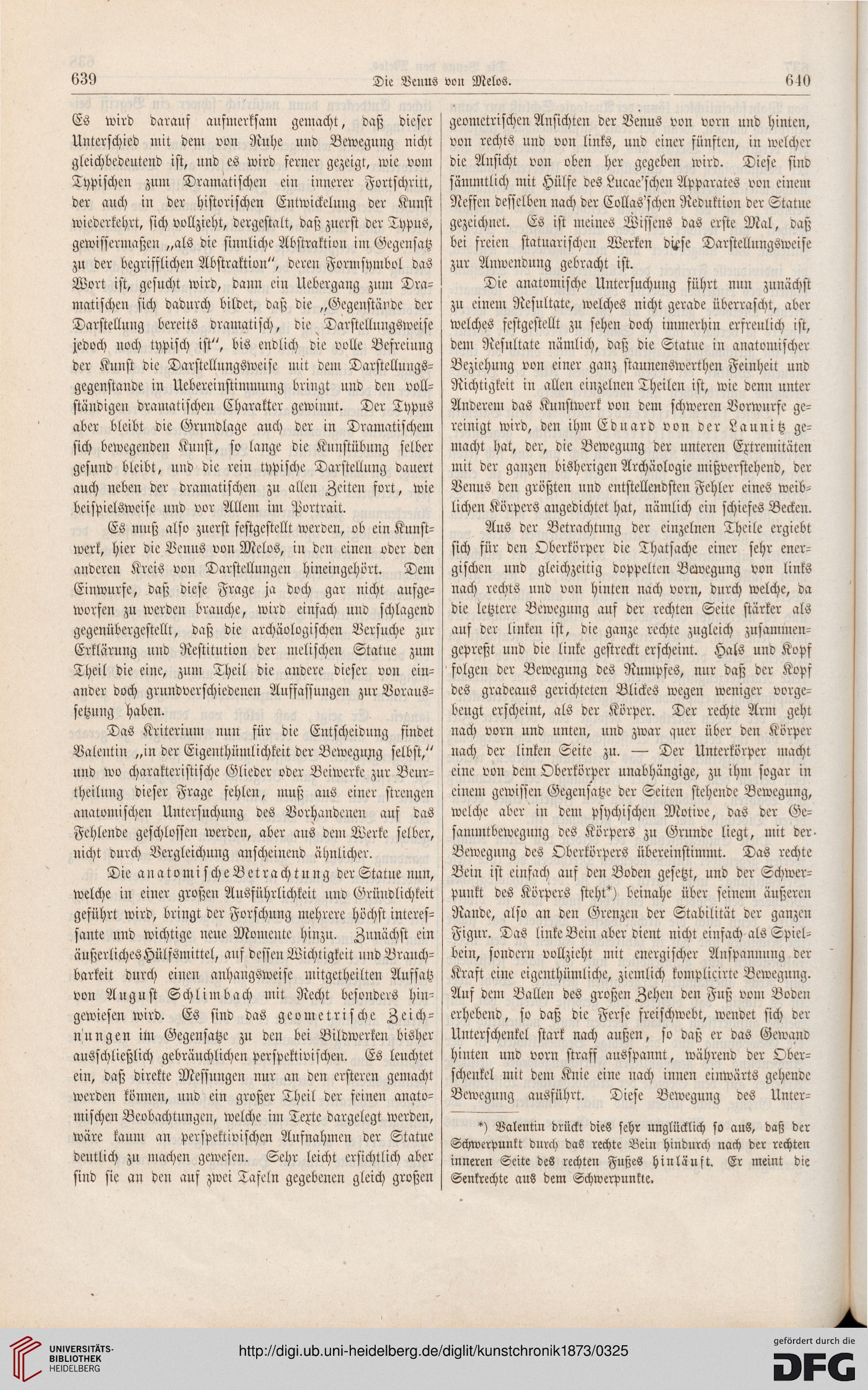639
Die Veuus vou Melos.
6l0
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß dieser
Unterschied mit dem von Ruhe und Bewegung nicht
gleichbedeutend ist, und es wird ferner gezeigt, wie vom
Typischcn zum Dramatischen ein innerer Fortschritt,
der auch in der historischen Entwickelung der Kunst
wiederkehrt, sich vollzieht, dergestalt, daß zuerst der Typus,
gewissermaßen „als die sinnliche Abstraktion im Gegensatz
zu der begrifslichen Abstraktion", deren Formsymbol das
Wort ist, gesucht wird, dann cin Uebergang zum Dra-
matischen sich dadurch bildct, daß die „Gegenstände der
Darstellung bereits dramatisch, die Darstellungsweise
jedoch uoch typisch ist", bis endlich die volle Befreiung
der Kunst die Darstellungsweise mit dem Darstellungs-
gegenstande in Uebereinstimmung bringt und dcn voll-
ständigen dramatischen Charakter gewinnt. Der Typus
aber bleibt dic Grundlage auch der in Dramatischem
sich bewegenden Kunst, so lange die Kunstübung selber
gesund bleibt, und die rein typische Darstellung dauert
auch neben der dramatischeu zu allen Zeiten fort, wie
beispielswcise und vor Allem im Portrait.
Es muß also zuerst festgestcllt werden, ob eiu Kunst-
werk, hier dic Venus von Melos, iu den einen oder den
auderen Kreis von Darstellungcn hineingehvrt. Dem
Einwurfe, daß dicse Frage ja doch gar nicht aufge-
worfen zu werden brauche, wirb einfach und schlagend
gegenübergestellt, daß die archäologischen Versuche zur
Erklärung und Restitution der melischen Statue zum
Theil die eine, zum Theil die andere dieser von ein-
ander doch gruudverschicdenen Auffassungen zur Voraus-
setzung habcn.
Das Kriterium nun für die Entscheidung findet
Valentin „in der Eigenthümlichkeit der Bewegung selbst,"
und wo charakteristische Glieder oder Bciwerke zur Beur-
theilung dieser Fragc fehlen, muß aus einer strengen
anatomischen Untersuchung des Vorhandencn auf das
Fehlende geschlossen werdeu, aber aus dem Werke selber,
nicht durch Bergleichung anscheiuend ähnlicher.
Die anatomischeBetrachtung derStatue nun,
welche in einer großen Ausführlichkeit und Grüudlichkeit
geführt wird, bringt der Forschung mehrere höchst interes-
sante und wichtige neue Momeute hinzu. Zunächst ein
äußerlichesHülssmittel, auf dessen Wichtigkeit und Brauch-
barkeit durch einen anhangsweise mitgetheilten Aufsatz
von August Schlimbach mit Nccht besonders hiu-
gewiesen wird. Es sind das gcometrische Zeich-
n'ungen im Gegensatze zu dcn bei Bildwerken bisher
ausschließlich gebräuchlichen perspcktivischen. Es leuchtet
ein, daß direkte Messungen nur an den ersteren gemacht
werden könuen, nnd ein großer Thcil der feinen anato-
mischen Beobachtungen, welche im Texte dargelegt werden,
wäre kaum an perspektivischen Aufnahmen der Statue
deutlich zu machen gewesen. Sehr leicht ersichtlich aber
sind sie an den auf zwei Taseln gegebenen gleich großen
geometrischen Ansichten der Venus von vorn und hinten,
von rechts und von links, und einer fünften, in welcher
die Ansicht von oben her gegeben wird. Diese sind
sämmtlich mit Hülfe des Lucae'schen Apparates von einem
Neffen desselben nach der Collas'schen Reduktion der Statue
gezeichnet. Es ist meines Wissens das erste Mal, daß
bei freicn statuarischen Werken dj^se Darstelluugsweise
zur Anwendung gebracht ist.
Die anatomische Untersuchung führt nun zunächst
zu einem Resultgte, welches nicht gerade überrascht, aber
welches festgestellt zu sehen doch immerhin erfreulich ist,
dem Resultate nämlich, daß die Statue in anatomischer
Beziehung von einer ganz staunenswerthen Feinheit und
Richtigkeit in allen cinzelnen Theilen ist, wie denn uuter
Anderem das Kunstwerk von dem schwereu Vorwurfe ge-
reinigt wird, den ihm Eduard von der Launitz ge-
macht hat, der, die Bewegung der unteren Extremitäten
mit der ganzen bisherigen Archäologie mißverstehend, der
Venus den größten nnd entstellendsten Fehler eines weib-
lichen Körpers angedichtet hat, nämlich cin schiefes Becken.
Aus der Betrachtung der einzelnen Theile ergiebt
sich für den Oberkörper die Thatsache einer sehr ener-
giscken und gleichzeitig doppelten Bewegung von links
nach rechts und von hinten näch vorn, durch welche, da
die letztere Bewegung auf der rechten Scite stärker als
auf der linken ist, die ganze rechte zugleich zusammen-
gepreßt und die linke gestreckt erscheint. Hals und Kopf
folgen der Bewegung des Rumpfes, nur daß der Kopf
des gradeaus gerichteten Blickes wegen weniger vorge-
bcugt erscheint, als dcr Körper. Der rechte Arm geht
nach vorn und unten, und zwar quer übcr den Körper
nach der linken Seite zu. — Der Unterkörper macht
eine von dem Oberkörper unabhängige, zu ihm sogar in
einem gewissen Gegensatze der Seitcn stehende Bcwegung,
welche aber in dem psychischen Motive, das der Ge-
sammtbewegung des Körpers zu Grunde liegt, mit der
Bewegung des Oberkörpers übereinstimmt. Das rechte
Bein ist einfach auf den Boden gesetzt, und der Schwer-
puukt des Körpers steht*) beinahe Lber seiuem äußercn
Rande, also an Len Grenzen der Stabilität der ganzen
Figur. Das linke Bein aber dient nicht einfach als Spiel-
bein, sondcrn vollzieht mit energischer Anspannung der
Kraft cine eigcnthümliche, ziemlich komplieirte Bewegung.
Auf dem Ballen des großen Zehen den Fuß vom Boden
erhebcnd, so daß die Ferse freischwebt, wendet sich der
Unterschenkel stark nach außen, so daß er das Gewand
hinten und vorn straff ausspannt, während der Ober-
schenkel mit dem Knie eine nach innen einwärts gehende
Bewegung ausführt. Diese Bewegung des Unter-
*) Valeutin drückt dies schr unglücklich so aus, daß der
Schrverpunkt durch das rechte Bein hindurch nach der rechten
inneren Seite des rechlen Fußes hinläuft. Er meint die
Senkrechte aus dem Schwerpunkte.
Die Veuus vou Melos.
6l0
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß dieser
Unterschied mit dem von Ruhe und Bewegung nicht
gleichbedeutend ist, und es wird ferner gezeigt, wie vom
Typischcn zum Dramatischen ein innerer Fortschritt,
der auch in der historischen Entwickelung der Kunst
wiederkehrt, sich vollzieht, dergestalt, daß zuerst der Typus,
gewissermaßen „als die sinnliche Abstraktion im Gegensatz
zu der begrifslichen Abstraktion", deren Formsymbol das
Wort ist, gesucht wird, dann cin Uebergang zum Dra-
matischen sich dadurch bildct, daß die „Gegenstände der
Darstellung bereits dramatisch, die Darstellungsweise
jedoch uoch typisch ist", bis endlich die volle Befreiung
der Kunst die Darstellungsweise mit dem Darstellungs-
gegenstande in Uebereinstimmung bringt und dcn voll-
ständigen dramatischen Charakter gewinnt. Der Typus
aber bleibt dic Grundlage auch der in Dramatischem
sich bewegenden Kunst, so lange die Kunstübung selber
gesund bleibt, und die rein typische Darstellung dauert
auch neben der dramatischeu zu allen Zeiten fort, wie
beispielswcise und vor Allem im Portrait.
Es muß also zuerst festgestcllt werden, ob eiu Kunst-
werk, hier dic Venus von Melos, iu den einen oder den
auderen Kreis von Darstellungcn hineingehvrt. Dem
Einwurfe, daß dicse Frage ja doch gar nicht aufge-
worfen zu werden brauche, wirb einfach und schlagend
gegenübergestellt, daß die archäologischen Versuche zur
Erklärung und Restitution der melischen Statue zum
Theil die eine, zum Theil die andere dieser von ein-
ander doch gruudverschicdenen Auffassungen zur Voraus-
setzung habcn.
Das Kriterium nun für die Entscheidung findet
Valentin „in der Eigenthümlichkeit der Bewegung selbst,"
und wo charakteristische Glieder oder Bciwerke zur Beur-
theilung dieser Fragc fehlen, muß aus einer strengen
anatomischen Untersuchung des Vorhandencn auf das
Fehlende geschlossen werdeu, aber aus dem Werke selber,
nicht durch Bergleichung anscheiuend ähnlicher.
Die anatomischeBetrachtung derStatue nun,
welche in einer großen Ausführlichkeit und Grüudlichkeit
geführt wird, bringt der Forschung mehrere höchst interes-
sante und wichtige neue Momeute hinzu. Zunächst ein
äußerlichesHülssmittel, auf dessen Wichtigkeit und Brauch-
barkeit durch einen anhangsweise mitgetheilten Aufsatz
von August Schlimbach mit Nccht besonders hiu-
gewiesen wird. Es sind das gcometrische Zeich-
n'ungen im Gegensatze zu dcn bei Bildwerken bisher
ausschließlich gebräuchlichen perspcktivischen. Es leuchtet
ein, daß direkte Messungen nur an den ersteren gemacht
werden könuen, nnd ein großer Thcil der feinen anato-
mischen Beobachtungen, welche im Texte dargelegt werden,
wäre kaum an perspektivischen Aufnahmen der Statue
deutlich zu machen gewesen. Sehr leicht ersichtlich aber
sind sie an den auf zwei Taseln gegebenen gleich großen
geometrischen Ansichten der Venus von vorn und hinten,
von rechts und von links, und einer fünften, in welcher
die Ansicht von oben her gegeben wird. Diese sind
sämmtlich mit Hülfe des Lucae'schen Apparates von einem
Neffen desselben nach der Collas'schen Reduktion der Statue
gezeichnet. Es ist meines Wissens das erste Mal, daß
bei freicn statuarischen Werken dj^se Darstelluugsweise
zur Anwendung gebracht ist.
Die anatomische Untersuchung führt nun zunächst
zu einem Resultgte, welches nicht gerade überrascht, aber
welches festgestellt zu sehen doch immerhin erfreulich ist,
dem Resultate nämlich, daß die Statue in anatomischer
Beziehung von einer ganz staunenswerthen Feinheit und
Richtigkeit in allen cinzelnen Theilen ist, wie denn uuter
Anderem das Kunstwerk von dem schwereu Vorwurfe ge-
reinigt wird, den ihm Eduard von der Launitz ge-
macht hat, der, die Bewegung der unteren Extremitäten
mit der ganzen bisherigen Archäologie mißverstehend, der
Venus den größten nnd entstellendsten Fehler eines weib-
lichen Körpers angedichtet hat, nämlich cin schiefes Becken.
Aus der Betrachtung der einzelnen Theile ergiebt
sich für den Oberkörper die Thatsache einer sehr ener-
giscken und gleichzeitig doppelten Bewegung von links
nach rechts und von hinten näch vorn, durch welche, da
die letztere Bewegung auf der rechten Scite stärker als
auf der linken ist, die ganze rechte zugleich zusammen-
gepreßt und die linke gestreckt erscheint. Hals und Kopf
folgen der Bewegung des Rumpfes, nur daß der Kopf
des gradeaus gerichteten Blickes wegen weniger vorge-
bcugt erscheint, als dcr Körper. Der rechte Arm geht
nach vorn und unten, und zwar quer übcr den Körper
nach der linken Seite zu. — Der Unterkörper macht
eine von dem Oberkörper unabhängige, zu ihm sogar in
einem gewissen Gegensatze der Seitcn stehende Bcwegung,
welche aber in dem psychischen Motive, das der Ge-
sammtbewegung des Körpers zu Grunde liegt, mit der
Bewegung des Oberkörpers übereinstimmt. Das rechte
Bein ist einfach auf den Boden gesetzt, und der Schwer-
puukt des Körpers steht*) beinahe Lber seiuem äußercn
Rande, also an Len Grenzen der Stabilität der ganzen
Figur. Das linke Bein aber dient nicht einfach als Spiel-
bein, sondcrn vollzieht mit energischer Anspannung der
Kraft cine eigcnthümliche, ziemlich komplieirte Bewegung.
Auf dem Ballen des großen Zehen den Fuß vom Boden
erhebcnd, so daß die Ferse freischwebt, wendet sich der
Unterschenkel stark nach außen, so daß er das Gewand
hinten und vorn straff ausspannt, während der Ober-
schenkel mit dem Knie eine nach innen einwärts gehende
Bewegung ausführt. Diese Bewegung des Unter-
*) Valeutin drückt dies schr unglücklich so aus, daß der
Schrverpunkt durch das rechte Bein hindurch nach der rechten
inneren Seite des rechlen Fußes hinläuft. Er meint die
Senkrechte aus dem Schwerpunkte.