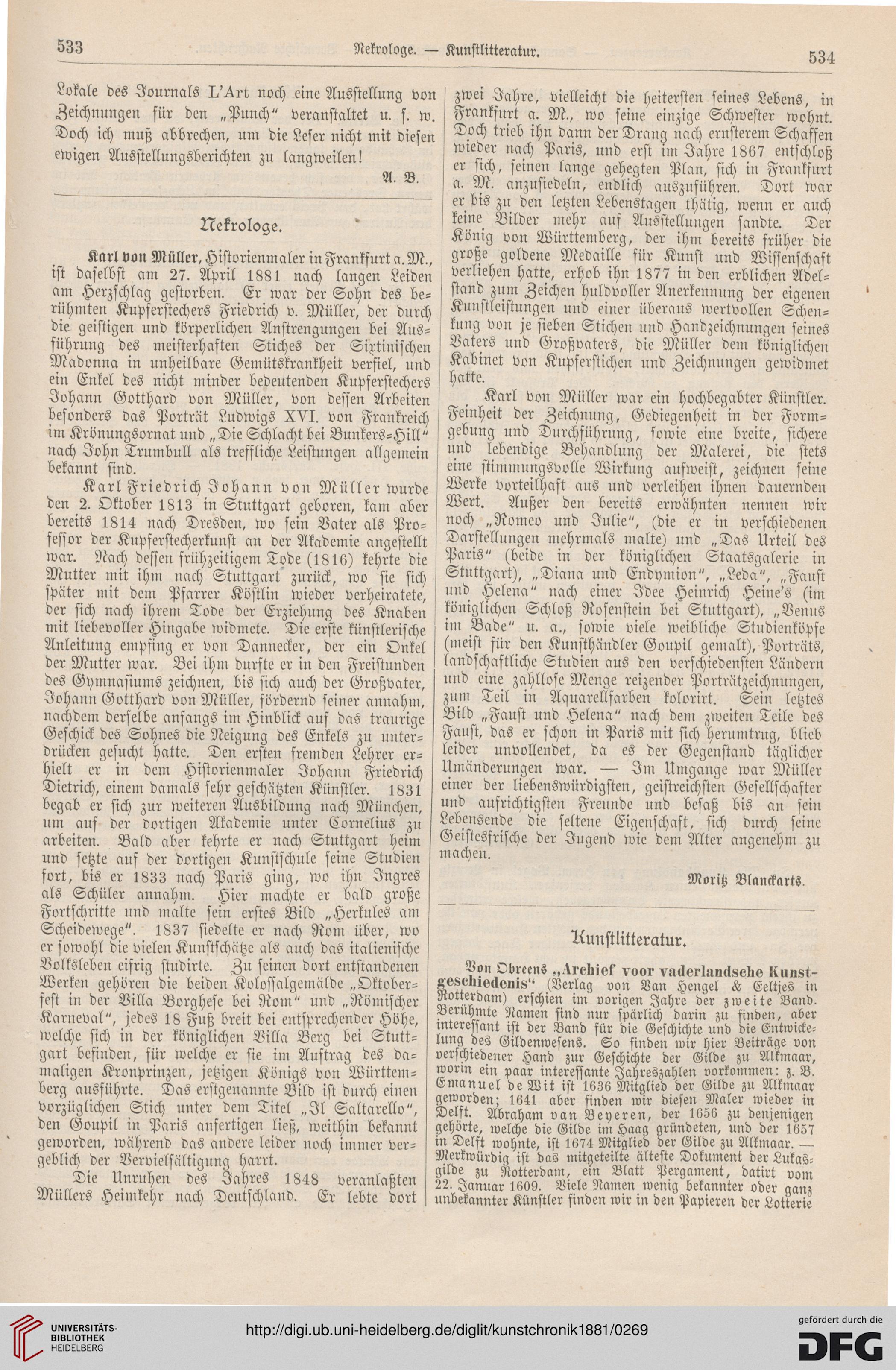533
Nekrologe. — Kunstlitteratur.
534
Lokale des Journals 1,'^rt noch eine Ausstellung von
Zeichnungen für den „Punch" veranstaltet u. s. w.
Doch ich muß abbrechen, um die Leser nicht mit diesen
ewigen Ausstellungsberichten zu langweilen!
A. B.
Nekrologe.
Karl von Müller, Historienmaler in Frankfurt a. M.,
ist daselbst am 27. April 1881 nach langen Leiden
am Herzschlag gestorben. Er war der Sohn des be-
rühmten Kupferstechers Friedrich v. Müller, der durch
die geistigen und körperlichen Austrengungen bei Aus-
sührung des meisterhaften Stiches der Sixtinischen
Madonna in unheilbare Gemütskrankheit verfiel, und
ein Enkel des nicht minder bedeutenden Kupferstechers
Johann Gotthard von Müller, von dessen Arbeiten
besonders das Porträt Ludwigs XVI. von Frankreich
im Krönungsornat und „Die Schlacht bei Bunkers-Hill"
nach Äohn Trumbull als treffliche Leistungen allgemein
bekannt sind.
Karl Friedrich Johann von Müller wurde
den 2. Oktober 1813 in Stuttgart geboren, kam aber
bereits 1814 nach Dresden, wo sein Vater als Pro-
fessor der Kupferstecherkunst an der Akademie angestellt
war. Nach dessen frllhzeitigem Tode (1816) kehrte die
Mutter mit ihm nach Stuttgart zurück, wo sie sich
später mit dem Pfarrer Köstlin wieder verheiratete,
der sich nach ihrem Tode der Erziehung des Knaben
mit liebevoller Hingabe widmete. Die erste künstlerische
Anleitung empfing er von Dannecker, der cin Onkel
der Mutter war. Bei ihm durfte cr in den Freistunden
des Gymnasiums zeichnen, bis sich auch der Großvater,
Äohann Gotthard von Müller, fördernd seiner annahm,
nachdem derselbe anfangs im Hinblick auf das traurige
Geschick des Sohnes die Neigung des Enkels zu unter-
drücken gesucht hatte. Dcn ersten fremden Lehrer er-
hielt er in dem Historienmaler Johann Friedrich
Dietrich, einem damals sehr geschätzten Künstler. 1831
begab er sich zur weiteren Ausbildung uach München,
um auf der dortigen Akademie unter Cornelius zu
arbeiten. Bald aber kehrte er nach Stuttgart heim
und setzte auf der dortigen Kunstschule seine Studien
fort, bis er 1833 nach Paris ging, wo ihn Jngres
als Schüler annahm. Hier machte er bald große
Fortschritte und malte sein erstes Bild „Herkules am
Scheidewege". 1837 siedelte er nach Rom über, wo
er sowohl die vielen Kunstschätze als auch das italienische
Volkslebcn eifrig studirte. Zu seinen dort entstandencn
Werken gehören die beiden Kolossalgemälde „Oktober-
fest in der Villa Borghese bei Rom" und „Römischer
Karneval", jedes 18 Fuß breit bei entsprechender Höhe,
welche sich in dcr königlichen Villa Berg bei Stutt-
gart befinden, sür welche er ste im Auftrag des da-
maligen Kronprinzen, jetzigen Königs von Württem-
berg ausführte. Das erstgenannte Bild ist durch einen
vorzüglichen Stich unter dem Titcl „Jl Saltarello",
den Goupil in Paris anfertigen ließ, weithin bekannt
geworden, während das andere leider nvch immer ver-
geblich der Vervielfältigung harrt.
Die Unruhen des Jahres 1848 veranlaßten
Müllers Heimkehr nach Dcutschland. Er lebte dort
j zwei Jahre, vielleicht die heitersten seiues Lebens, in
j Frankfurt a. M., wo seine einzige Schwester wohnt.
Doch trieb ihn dann dcr Drang nach ernstcrem Schaffen
j wieder nach Paris, und erst im Jahre 1867 entschloß
er sich, seinen lange gehegten Plan, sich in Frankfurt
I a. M. anzusiedeln, endlich auszuführen. Dort war
er bis zu den letzten Lebcnstagen thätig, wenn er anch
keine Bilder mehr auf Ausstellungen sandte. Der
j König von Württemberg, der ihm bereits srüher die
große goldene Medaille für Kunst und Wiffenschaft
verliehen hatte, erhob ihn 1877 in den erblichen Adel-
j stand zum Zeichen huldvoller Anerkennung der eigenen
j Kunstleistungen und einer überaus wertvollen Schen-
I kung von je sieben Stichen und Handzeichnungen seines
Baters und Großvaters, die Müller dem königlichen
Kabinct von Kupferstichcn und Zeichnungen gewidmet
hatte.
Karl von Müller war cin hochbegabter Kiinstler.
j Feinheit der Zeichnung, Gediegenheit in der Form-
gebung und Durchführung, sowie eine breite, sichere
und lebendige Behandlung der Malerei, die stets
eine stimmungsvolle Wirkung aufweist, zeichnen seine
Werke vorteilhaft aus und verleihen ihnen dauernden
Wert. Außer den bereits erwähnten nennen wir
noch „Ronieo und Julie", (die er in verschiedenen
Darstellungen mehrmals malte) und „Das Urteil des
Paris" (beide in der königlichen Staatsgalerie in
Stuttgart), „Diana und Endymion", „Leda", „Faust
und Helena" nach einer Jdee Heinrich Heine's (im
königlichen Schloß Rvsenstein bei Stuttgart), „Venus
im Bade" u. a., sowie viele weibliche Studienköpfe
(meist für den Kunsthändler Goupil gemalt), Porträts,
landschaftliche Studien aus den verschiedensten Ländcrn
und eine zahllose Menge reizeuder Porträtzeichnungen,
zum Teil in Aquarellfarben kolorirt. Sein letztes
Bild „Faust und Helena" nach dem zweiten Teile des
Faust, das er schon in Paris mit sich herumtrug, blieb
leider unvollendet, da es der Gegenstand täglichcr
Umänderungen war. — Jm Umgange war Müller
einer der liebenswürdigsten, geistreichsten Gesellschafter
und aufrichtigsten Freunde und besaß bis an sein
Lebensende die seltene Eigenschaft, sich durch seine
Gcistcsfrische dcr Jugend wie dem Alter angenehm zu
machen.
Morij; Blanckarts.
Aunstlitteratur.
Bon Obrcens .. Ireliiel voor vullerlnnil^elie liunst-
L08eliiockvni8" (Verlag von Van Hengel L Eeltjes in
Rotterdam) erschien im vorigen Jahre der zweite Band.
Berühmte Namen sind nur spärlich darin zu finden, aber
interessant ist der Band für die Geschichte und die Entwicke-
lung des Gildenivesens. So finden ivir hier Beiträge von
verschiedener Hand zur Geschichts der Gilde zu Alkmaar,
worin ein paar interessante Jahreszahlen vorkommen: z. B.
Emanuel de Wit ist 1636 Mitglied der Gilde zu Alkmaar
geworden; 1641 absr finden wir diesen Maler wieder in
Delft. Abraham van Beyeren, der 1656 zu denjenigen
gehörte, wslche die Gilde iin Haaq gründeten, und der 1657
in Delft wohnte, ist 1674 Mitglied der Gilde zu Alkmaar. —
Merkwürdig ist das mitgeteilte älteste Dokument der Lukas-
gilde zu Rotterdam, ein Blatt Pergament, datirt vom
22. Januar 1609. Viele Namen wenig bekannter oder ganz
unbekannter Künstler finden wir in den Papieren der Lotterie
Nekrologe. — Kunstlitteratur.
534
Lokale des Journals 1,'^rt noch eine Ausstellung von
Zeichnungen für den „Punch" veranstaltet u. s. w.
Doch ich muß abbrechen, um die Leser nicht mit diesen
ewigen Ausstellungsberichten zu langweilen!
A. B.
Nekrologe.
Karl von Müller, Historienmaler in Frankfurt a. M.,
ist daselbst am 27. April 1881 nach langen Leiden
am Herzschlag gestorben. Er war der Sohn des be-
rühmten Kupferstechers Friedrich v. Müller, der durch
die geistigen und körperlichen Austrengungen bei Aus-
sührung des meisterhaften Stiches der Sixtinischen
Madonna in unheilbare Gemütskrankheit verfiel, und
ein Enkel des nicht minder bedeutenden Kupferstechers
Johann Gotthard von Müller, von dessen Arbeiten
besonders das Porträt Ludwigs XVI. von Frankreich
im Krönungsornat und „Die Schlacht bei Bunkers-Hill"
nach Äohn Trumbull als treffliche Leistungen allgemein
bekannt sind.
Karl Friedrich Johann von Müller wurde
den 2. Oktober 1813 in Stuttgart geboren, kam aber
bereits 1814 nach Dresden, wo sein Vater als Pro-
fessor der Kupferstecherkunst an der Akademie angestellt
war. Nach dessen frllhzeitigem Tode (1816) kehrte die
Mutter mit ihm nach Stuttgart zurück, wo sie sich
später mit dem Pfarrer Köstlin wieder verheiratete,
der sich nach ihrem Tode der Erziehung des Knaben
mit liebevoller Hingabe widmete. Die erste künstlerische
Anleitung empfing er von Dannecker, der cin Onkel
der Mutter war. Bei ihm durfte cr in den Freistunden
des Gymnasiums zeichnen, bis sich auch der Großvater,
Äohann Gotthard von Müller, fördernd seiner annahm,
nachdem derselbe anfangs im Hinblick auf das traurige
Geschick des Sohnes die Neigung des Enkels zu unter-
drücken gesucht hatte. Dcn ersten fremden Lehrer er-
hielt er in dem Historienmaler Johann Friedrich
Dietrich, einem damals sehr geschätzten Künstler. 1831
begab er sich zur weiteren Ausbildung uach München,
um auf der dortigen Akademie unter Cornelius zu
arbeiten. Bald aber kehrte er nach Stuttgart heim
und setzte auf der dortigen Kunstschule seine Studien
fort, bis er 1833 nach Paris ging, wo ihn Jngres
als Schüler annahm. Hier machte er bald große
Fortschritte und malte sein erstes Bild „Herkules am
Scheidewege". 1837 siedelte er nach Rom über, wo
er sowohl die vielen Kunstschätze als auch das italienische
Volkslebcn eifrig studirte. Zu seinen dort entstandencn
Werken gehören die beiden Kolossalgemälde „Oktober-
fest in der Villa Borghese bei Rom" und „Römischer
Karneval", jedes 18 Fuß breit bei entsprechender Höhe,
welche sich in dcr königlichen Villa Berg bei Stutt-
gart befinden, sür welche er ste im Auftrag des da-
maligen Kronprinzen, jetzigen Königs von Württem-
berg ausführte. Das erstgenannte Bild ist durch einen
vorzüglichen Stich unter dem Titcl „Jl Saltarello",
den Goupil in Paris anfertigen ließ, weithin bekannt
geworden, während das andere leider nvch immer ver-
geblich der Vervielfältigung harrt.
Die Unruhen des Jahres 1848 veranlaßten
Müllers Heimkehr nach Dcutschland. Er lebte dort
j zwei Jahre, vielleicht die heitersten seiues Lebens, in
j Frankfurt a. M., wo seine einzige Schwester wohnt.
Doch trieb ihn dann dcr Drang nach ernstcrem Schaffen
j wieder nach Paris, und erst im Jahre 1867 entschloß
er sich, seinen lange gehegten Plan, sich in Frankfurt
I a. M. anzusiedeln, endlich auszuführen. Dort war
er bis zu den letzten Lebcnstagen thätig, wenn er anch
keine Bilder mehr auf Ausstellungen sandte. Der
j König von Württemberg, der ihm bereits srüher die
große goldene Medaille für Kunst und Wiffenschaft
verliehen hatte, erhob ihn 1877 in den erblichen Adel-
j stand zum Zeichen huldvoller Anerkennung der eigenen
j Kunstleistungen und einer überaus wertvollen Schen-
I kung von je sieben Stichen und Handzeichnungen seines
Baters und Großvaters, die Müller dem königlichen
Kabinct von Kupferstichcn und Zeichnungen gewidmet
hatte.
Karl von Müller war cin hochbegabter Kiinstler.
j Feinheit der Zeichnung, Gediegenheit in der Form-
gebung und Durchführung, sowie eine breite, sichere
und lebendige Behandlung der Malerei, die stets
eine stimmungsvolle Wirkung aufweist, zeichnen seine
Werke vorteilhaft aus und verleihen ihnen dauernden
Wert. Außer den bereits erwähnten nennen wir
noch „Ronieo und Julie", (die er in verschiedenen
Darstellungen mehrmals malte) und „Das Urteil des
Paris" (beide in der königlichen Staatsgalerie in
Stuttgart), „Diana und Endymion", „Leda", „Faust
und Helena" nach einer Jdee Heinrich Heine's (im
königlichen Schloß Rvsenstein bei Stuttgart), „Venus
im Bade" u. a., sowie viele weibliche Studienköpfe
(meist für den Kunsthändler Goupil gemalt), Porträts,
landschaftliche Studien aus den verschiedensten Ländcrn
und eine zahllose Menge reizeuder Porträtzeichnungen,
zum Teil in Aquarellfarben kolorirt. Sein letztes
Bild „Faust und Helena" nach dem zweiten Teile des
Faust, das er schon in Paris mit sich herumtrug, blieb
leider unvollendet, da es der Gegenstand täglichcr
Umänderungen war. — Jm Umgange war Müller
einer der liebenswürdigsten, geistreichsten Gesellschafter
und aufrichtigsten Freunde und besaß bis an sein
Lebensende die seltene Eigenschaft, sich durch seine
Gcistcsfrische dcr Jugend wie dem Alter angenehm zu
machen.
Morij; Blanckarts.
Aunstlitteratur.
Bon Obrcens .. Ireliiel voor vullerlnnil^elie liunst-
L08eliiockvni8" (Verlag von Van Hengel L Eeltjes in
Rotterdam) erschien im vorigen Jahre der zweite Band.
Berühmte Namen sind nur spärlich darin zu finden, aber
interessant ist der Band für die Geschichte und die Entwicke-
lung des Gildenivesens. So finden ivir hier Beiträge von
verschiedener Hand zur Geschichts der Gilde zu Alkmaar,
worin ein paar interessante Jahreszahlen vorkommen: z. B.
Emanuel de Wit ist 1636 Mitglied der Gilde zu Alkmaar
geworden; 1641 absr finden wir diesen Maler wieder in
Delft. Abraham van Beyeren, der 1656 zu denjenigen
gehörte, wslche die Gilde iin Haaq gründeten, und der 1657
in Delft wohnte, ist 1674 Mitglied der Gilde zu Alkmaar. —
Merkwürdig ist das mitgeteilte älteste Dokument der Lukas-
gilde zu Rotterdam, ein Blatt Pergament, datirt vom
22. Januar 1609. Viele Namen wenig bekannter oder ganz
unbekannter Künstler finden wir in den Papieren der Lotterie