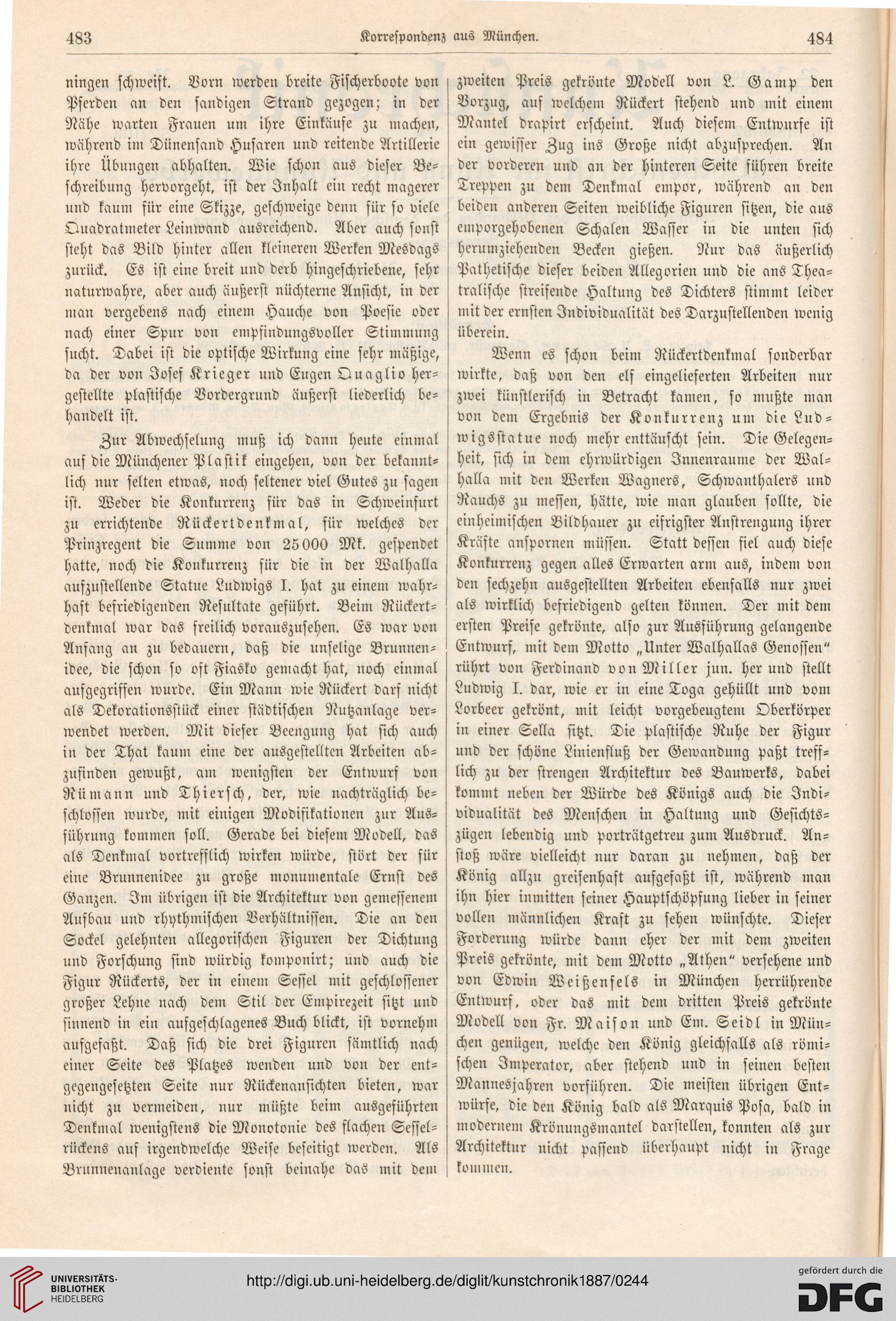483
Korrespondenz aus München.
484
mngen schweift. Vorn werden breite Fischerboote von
Pferden c»n den sandigen Strand gezogen; in der
Nähe warten Frauen um ihre Einkäufe zu machen,
während im Diinensand Husaren und reitende Artillerie
ihre Übungen abhalten. Wie schou aus dieser Be-
schreibung hervorgeht, ist der Jnhalt ein recht magerer
und kaum für eine Skizze, geschweige denn für so viele
Quadratmeter Leinwand ausreichend. Aber auch sonst
steht dns Bild hinter allen kleineren Werken MeSdags
zurück. Es ist eine breit und derb hingeschriebene, sehr
naturwahre, aber auch äußerst nüchterne Ansicht, in der
mau vergebens nach einem Hauche von Poesie oder
nach einer Spur vou empfindungsvoller Stimmung
sucht. Dabei ist die optische Wirkung eine sehr mäßige,
da der von Josef Krieger und Eugen Quaglio her-
gestellte plastische Vordergrund äußerst liederlich be-
handelt ist.
Zur Abwechselung muß ich dann heute einmal
auf die Münchener Plastik eingehen, von der bekaunt-
lich nur selteu etwas, noch seltener viel Gutes zu sagen
ist. Weder die Konkurrenz fllr das in Schweinfurt
zu errichtende Rllckertdenkmal, sllr welches der
Prinzregent die Summe von 25000 Mk. gespendet
hatte, noch die Konkurrenz fllr die in der Walhalla
aufzustellende Statue Ludwigs I. hat zu einem wahr-
haft befriedigenden Resultate geführt. Beim Riickert-
denkmal war das freilich vorauszusehen. Es war von
Anfang an zu bedauern, daß die unselige Brunnen-
idee, die schvn so oft Fiasko gemacht hat, noch einmal
aufgegriffen wurde. Ein Mann wie Rllckert darf nicht
als Dekorativnsstllck einer städtischen Nutzanlage ver-
wendet werden. Mit dieser Beenguug hnt sich auch
in der That kaum eine der ausgestelltcn Arbeiten ab-
zustnden gewußt, am wenigsten der Entwurf von
Rümaun und Thiersch, der, wie nachträglich be-
schlossen wurde, mit einigen Modifikativuen zur Aus-
fllhrung kommen soll. Gerade bei diesem Modell, das
als Denkmal vortrefflich wirken wllrde, stvrt der fiir
eine Brunnenidee zu große monumentale Ernst des
Ganzen. Jni übrigen ist die Architektur von gemessenem
Aufbau und rhythmischen Verhältnissen. Die an den
Sockel gelehnten allegorischen Figuren der Dichtung
und Forschung sind wllrdig komponirt; und auch die
Figur RUckerts, der in einem Sesiel mit geschlosiener
großer Lehne nach dem Stil der Empirezeit sitzt und
sinnend in ein aufgeschlagenes Buch blickt, ist vornehm
ausgefaßt. Daß sich die drei Figuren sämtlich nach
einer Seite des Platzes wenden und von der ent-
gegengesetzten Seite nur Rückenansichten bieten, war
nicht zu vermeiden, nur mllßte beim ausgefllhrten
Denkmal wenigstens die Monotonie des flachen Sesiel-
rtickens auf irgendwelche Wcise beseitigt werden. Als
Brunnenanlage verdiente sonst beinahe das mit dem
zweiten Preis gekrönte Modell von L. Gamp den
Vorzug, auf welchem Rllckert stehend und mit einem
Mantel drapirt erscheint. Auch diesem Entwurfe ist
ein gewisier Zug ins Große nicht abzusprechen. An
der vorderen und an der hintcren Seite führen breite
Treppen zu dem Denkmal empor, während an deu
beiden anderen Seiten weibliche Figuren sitzen, die aus
emporgehobenen Schalen Wasier in die unten sich
herumziehenden Becken gießen. Nur das äußerlich
Pathetische dieser beiden Allegorien und die ans Thea-
tralische streifende Haltung des Dichters stimmt leider
mit der ernsten Jndividualität des Darzustellenden wenig
überein.
Wenn es schon beim Rllckertdenkmal sonderbar
wirkte, daß von den elf eingelieferten Arbeiten nur
zwei kllnstlerisch in Betracht kamen, so mußte man
von dem Ergebnis der Konkurrenz um die Lud-
wigsstatue noch mehr enttäuscht sein. Die Gelegen-
heit, sich in dem ehrwürdigen Jnnenraume der Wal-
halla mit den Werken Wagners, Schwanthalers nnd
Rauchs zu messen, hätte, wie man glauben sollte, die
einheimischen Bildhauer zu eifrigster Anstrengung ihrer
Kräfte anspornen müssen. Statt dessen siel auch diese
Konkurrenz gegen alles Erwarten arm aus, indem von
den sechzehn ausgestellten Arbeitcn ebensalls nur zwei
als wirklich befriedigend gelten können. Der mit dem
ersten Preise gekrönte, also zur Aussührung gelangende
Entwurf, mit dem Motto „Unter Walhallas Genossen"
rllhrt von Ferdinand von Miller jun. her und stellt
Ludwig I. dar, wie er in eine Toga gehüllt und vom
Lorbeer gekrönt, mit leicht vorgebeugtem Oberkörper
in einer Sella sitzt. Die plastische Ruhe der Figur
und der schöne Linienfluß der Gewandung paßt treff-
lich zu der strengeu Architektur des Bauwerks, dabei
komnit neben der WUrde des Königs auch die Jndi-
vidualität des Menschen in Haltung und Gesichts-
zügen lebendig und porträtgetreu zum Ausdruck. An-
stoß wäre vielleicht nur daran zu nehmen, daß der
König allzu greisenhaft aufgefaßt ist, während nian
ihn hier inniitten seiner Hauptschöpfnng lieber in seiner
vollen männlichen Kraft zu sehen wiinschte. Dieser
Forderung wllrde dann eher der mit dem zweiten
Preis gekrönte, mit dem Motto „Athen" versehene und
von Edwin Weißenfels in Mllnchen herrlihrende
Entwurf, oder das niit dem dritten Preis gekrönte
Modell von Fr. Maison und Em. Seidl in Mlln-
chen genügen, welche den König gleichfalls als römi-
schen Jmperator, aber stehend und in seinen besten
Mannesjahren vorfiihren. Die meisten llbrigen Ent-
würfe, die den König bald als Marquis Posa, bald in
modernem Krönungsmantel darstellen, konnteu als zur
Architektur uicht passend iiberhaupt nicht in Frage
kvmmcn.
Korrespondenz aus München.
484
mngen schweift. Vorn werden breite Fischerboote von
Pferden c»n den sandigen Strand gezogen; in der
Nähe warten Frauen um ihre Einkäufe zu machen,
während im Diinensand Husaren und reitende Artillerie
ihre Übungen abhalten. Wie schou aus dieser Be-
schreibung hervorgeht, ist der Jnhalt ein recht magerer
und kaum für eine Skizze, geschweige denn für so viele
Quadratmeter Leinwand ausreichend. Aber auch sonst
steht dns Bild hinter allen kleineren Werken MeSdags
zurück. Es ist eine breit und derb hingeschriebene, sehr
naturwahre, aber auch äußerst nüchterne Ansicht, in der
mau vergebens nach einem Hauche von Poesie oder
nach einer Spur vou empfindungsvoller Stimmung
sucht. Dabei ist die optische Wirkung eine sehr mäßige,
da der von Josef Krieger und Eugen Quaglio her-
gestellte plastische Vordergrund äußerst liederlich be-
handelt ist.
Zur Abwechselung muß ich dann heute einmal
auf die Münchener Plastik eingehen, von der bekaunt-
lich nur selteu etwas, noch seltener viel Gutes zu sagen
ist. Weder die Konkurrenz fllr das in Schweinfurt
zu errichtende Rllckertdenkmal, sllr welches der
Prinzregent die Summe von 25000 Mk. gespendet
hatte, noch die Konkurrenz fllr die in der Walhalla
aufzustellende Statue Ludwigs I. hat zu einem wahr-
haft befriedigenden Resultate geführt. Beim Riickert-
denkmal war das freilich vorauszusehen. Es war von
Anfang an zu bedauern, daß die unselige Brunnen-
idee, die schvn so oft Fiasko gemacht hat, noch einmal
aufgegriffen wurde. Ein Mann wie Rllckert darf nicht
als Dekorativnsstllck einer städtischen Nutzanlage ver-
wendet werden. Mit dieser Beenguug hnt sich auch
in der That kaum eine der ausgestelltcn Arbeiten ab-
zustnden gewußt, am wenigsten der Entwurf von
Rümaun und Thiersch, der, wie nachträglich be-
schlossen wurde, mit einigen Modifikativuen zur Aus-
fllhrung kommen soll. Gerade bei diesem Modell, das
als Denkmal vortrefflich wirken wllrde, stvrt der fiir
eine Brunnenidee zu große monumentale Ernst des
Ganzen. Jni übrigen ist die Architektur von gemessenem
Aufbau und rhythmischen Verhältnissen. Die an den
Sockel gelehnten allegorischen Figuren der Dichtung
und Forschung sind wllrdig komponirt; und auch die
Figur RUckerts, der in einem Sesiel mit geschlosiener
großer Lehne nach dem Stil der Empirezeit sitzt und
sinnend in ein aufgeschlagenes Buch blickt, ist vornehm
ausgefaßt. Daß sich die drei Figuren sämtlich nach
einer Seite des Platzes wenden und von der ent-
gegengesetzten Seite nur Rückenansichten bieten, war
nicht zu vermeiden, nur mllßte beim ausgefllhrten
Denkmal wenigstens die Monotonie des flachen Sesiel-
rtickens auf irgendwelche Wcise beseitigt werden. Als
Brunnenanlage verdiente sonst beinahe das mit dem
zweiten Preis gekrönte Modell von L. Gamp den
Vorzug, auf welchem Rllckert stehend und mit einem
Mantel drapirt erscheint. Auch diesem Entwurfe ist
ein gewisier Zug ins Große nicht abzusprechen. An
der vorderen und an der hintcren Seite führen breite
Treppen zu dem Denkmal empor, während an deu
beiden anderen Seiten weibliche Figuren sitzen, die aus
emporgehobenen Schalen Wasier in die unten sich
herumziehenden Becken gießen. Nur das äußerlich
Pathetische dieser beiden Allegorien und die ans Thea-
tralische streifende Haltung des Dichters stimmt leider
mit der ernsten Jndividualität des Darzustellenden wenig
überein.
Wenn es schon beim Rllckertdenkmal sonderbar
wirkte, daß von den elf eingelieferten Arbeiten nur
zwei kllnstlerisch in Betracht kamen, so mußte man
von dem Ergebnis der Konkurrenz um die Lud-
wigsstatue noch mehr enttäuscht sein. Die Gelegen-
heit, sich in dem ehrwürdigen Jnnenraume der Wal-
halla mit den Werken Wagners, Schwanthalers nnd
Rauchs zu messen, hätte, wie man glauben sollte, die
einheimischen Bildhauer zu eifrigster Anstrengung ihrer
Kräfte anspornen müssen. Statt dessen siel auch diese
Konkurrenz gegen alles Erwarten arm aus, indem von
den sechzehn ausgestellten Arbeitcn ebensalls nur zwei
als wirklich befriedigend gelten können. Der mit dem
ersten Preise gekrönte, also zur Aussührung gelangende
Entwurf, mit dem Motto „Unter Walhallas Genossen"
rllhrt von Ferdinand von Miller jun. her und stellt
Ludwig I. dar, wie er in eine Toga gehüllt und vom
Lorbeer gekrönt, mit leicht vorgebeugtem Oberkörper
in einer Sella sitzt. Die plastische Ruhe der Figur
und der schöne Linienfluß der Gewandung paßt treff-
lich zu der strengeu Architektur des Bauwerks, dabei
komnit neben der WUrde des Königs auch die Jndi-
vidualität des Menschen in Haltung und Gesichts-
zügen lebendig und porträtgetreu zum Ausdruck. An-
stoß wäre vielleicht nur daran zu nehmen, daß der
König allzu greisenhaft aufgefaßt ist, während nian
ihn hier inniitten seiner Hauptschöpfnng lieber in seiner
vollen männlichen Kraft zu sehen wiinschte. Dieser
Forderung wllrde dann eher der mit dem zweiten
Preis gekrönte, mit dem Motto „Athen" versehene und
von Edwin Weißenfels in Mllnchen herrlihrende
Entwurf, oder das niit dem dritten Preis gekrönte
Modell von Fr. Maison und Em. Seidl in Mlln-
chen genügen, welche den König gleichfalls als römi-
schen Jmperator, aber stehend und in seinen besten
Mannesjahren vorfiihren. Die meisten llbrigen Ent-
würfe, die den König bald als Marquis Posa, bald in
modernem Krönungsmantel darstellen, konnteu als zur
Architektur uicht passend iiberhaupt nicht in Frage
kvmmcn.