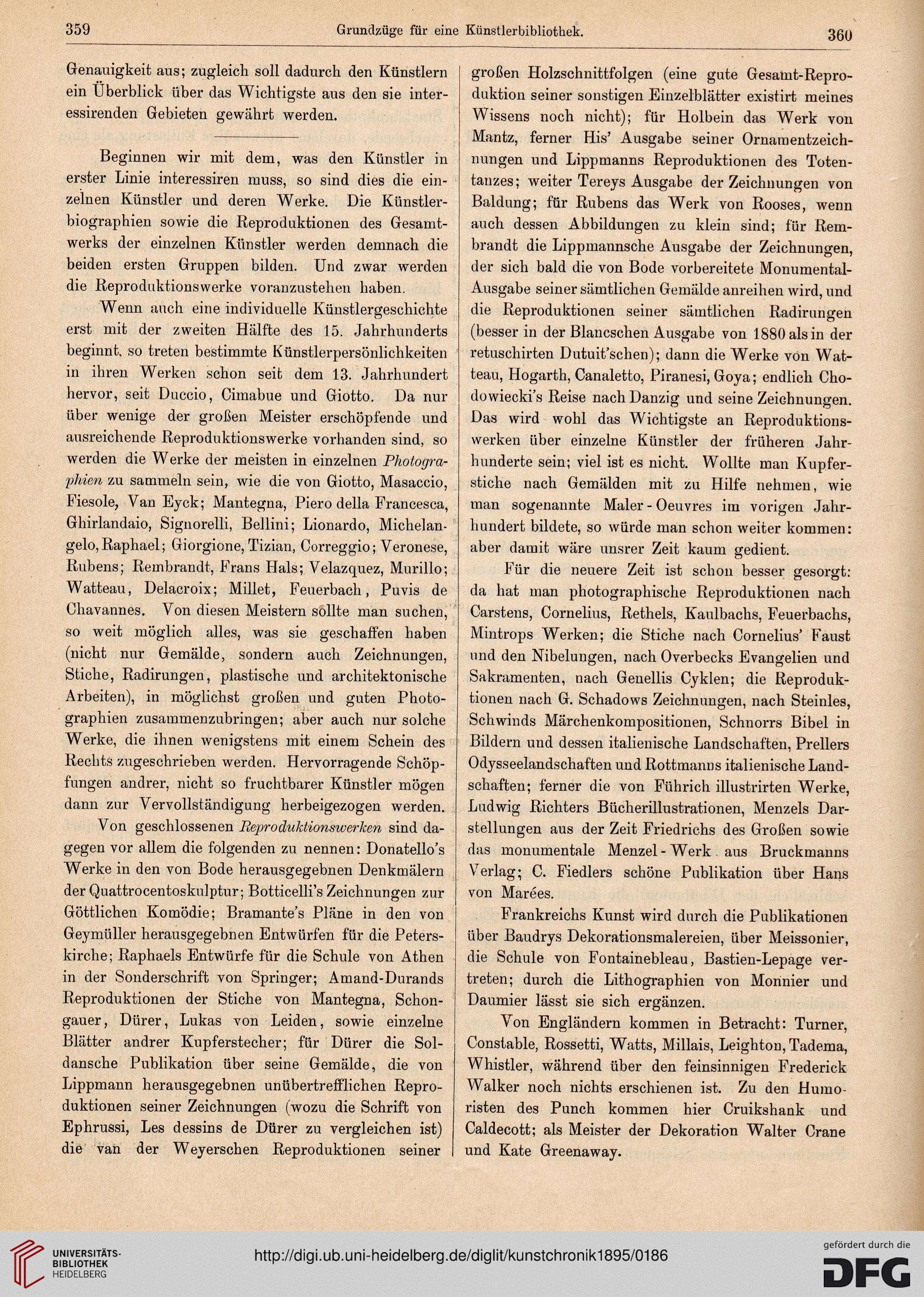359
Grundzüge für eine
Künstlerbibliothek.
360
Genauigkeit aus; zugleich soll dadurch den Künstlern
ein Uberblick über das Wichtigste aus den sie inter-
essirenden Gebieten gewährt werden.
Beginnen wir mit dem, was den Künstler in
erster Linie interessiren muss, so sind dies die ein-
zelnen Künstler und deren Werke. Die Künstler-
biographien sowie die Reproduktionen des Gesamt-
werks der einzelnen Künstler werden demnach die
beiden ersten Gruppen bilden. Und zwar werden
die Reproduktionswerke voranzustellen haben.
Wenn auch eine individuelle Künstlergeschichte
erst mit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
beginnt, so treten bestimmte Künstlerpersönlichkeiten
in ihren Werken schon seit dem 13. Jahrhundert
hervor, seit Duccio, Cimabue und Giotto. Da nur
über wenige der großen Meister erschöpfende und
ausreichende Reproduktionswerke vorhanden sind, so
werden die Werke der meisten in einzelnen Photogra-
phien zu sammeln sein, wie die von Giotto, Masaccio,
Fiesole, Van Eyck; Mantegna, Piero della Francesca,
Ghirlandaio, Signorelli, Bellini; Lionardo, Michelan-
gelo, Raphael; Giorgione, Tizian, Correggio; Veronese,
Rubens; Reinbrandt, Frans Hals; Velazquez, Murillo;
Watteau, Delacroix; Millet, Feuerbach, Puvis de
Chavannes. Von diesen Meistern sollte man suchen,
so weit möglich alles, was sie geschaffen haben
(nicht nur Gemälde, sondern auch Zeichnungen,
Stiche, Radirungen, plastische und architektonische
Arbeiten), in möglichst großen und guten Photo-
graphien zusammenzubringen; aber auch nur solche
Werke, die ihnen wenigstens mit einem Schein des
Rechts zugeschrieben werden. Hervorragende Schöp-
fungen andrer, nicht so fruchtbarer Künstler mögen
dann zur Vervollständigung herbeigezogen werden.
Von geschlossenen Reproduklionswerken sind da-
gegen vor allem die folgenden zu nennen: Donatello's
Werke in den von Bode herausgegebnen Denkmälern
der Quattrocentoskulptur; Botticelli's Zeichnungen zur
Göttlichen Komödie; Bramante's Pläne in den von
Geymüller herausgegebnen Entwürfen für die Peters-
kirche; Raphaels Entwürfe für die Schule von Athen
in der Sonderschrift von Springer; Amand-Durands
Reproduktionen der Stiche von Mantegna, Schon-
gauer, Dürer, Lukas von Leiden, sowie einzelne
Blätter andrer Kupferstecher; für Dürer die Sol-
dansche Publikation über seine Gemälde, die von
Lippmann herausgegebnen unübertrefflichen Repro-
duktionen seiner Zeichnungen (wozu die Schrift von
Ephrussi, Les dessins de Dürer zu vergleichen ist)
die van der Weyerschen Reproduktionen seiner
großen Holzschnittfolgen (eine gute Gesaint-Repro-
duktion seiner sonstigen Einzelblätter existirt meines
Wissens noch nicht); für Holbein das Werk von
Mantz, ferner His' Ausgabe seiner Ornamentzeich-
nungen und Lippmanns Reproduktionen des Toten-
tanzes; weiter Tereys Ausgabe der Zeichnungen von
Baidung; für Rubens das Werk von Rooses, wenn
auch dessen Abbildungen zu klein sind; für Rem-
brandt die Lippmannsche Ausgabe der Zeichnungen,
der sich bald die von Bode vorbereitete Monumental-
Ausgabe seiner sämtlichen Gemälde anreihen wird, und
die Reproduktionen seiner sämtlichen Radirungen
(besser in der Blancschen Ausgabe von 1880 als in der
retuschirten Dutuit'schen); dann die Werke von Wat-
teau, Hogarth, Canaletto, Piranesi, Goya; endlich Cho-
dowiecki's Reise nach Danzig und seine Zeichnungen.
Das wird wohl das Wichtigste an Reproduktions-
werken über einzelne Künstler der früheren Jahr-
hunderte sein; viel ist es nicht. Wollte man Kupfer-
stiche nach Gemälden mit zu Hilfe nehmen, wie
man sogenannte Maler - Oeuvres im vorigen Jahr-
hundert bildete, so würde man schon weiter kommen:
aber damit wäre unsrer Zeit kaum gedient.
Für die neuere Zeit ist schon besser gesorgt:
da hat man photographische Reproduktionen nach
Carstens, Cornelius, Rethels, Kaulbachs, Feuerbachs,
Mintrops Werken; die Stiche nach Cornelius' Faust
und den Nibelungen, nach Overbecks Evangelien und
Sakramenten, nach Genellis Cyklen; die Reproduk-
tionen nach G. Schadows Zeichnungen, nach Steinles,
Schwinds Märchenkompositionen, Schnorrs Bibel in
Bildern und dessen italienische Landschaften, Prellers
Odysseelandschaften und Rottmanns italienische Land-
schaften; ferner die von Führich illustrirten Werke,
Ludwig Richters Bücherillustrationen, Menzels Dar-
stellungen aus der Zeit Friedrichs des Großen sowie
das monumentale Menzel - Werk aus Bruckmanns
Verlag; C. Fiedlers schöne Publikation über Hans
von Marees.
Frankreichs Kunst wird durch die Publikationen
über Baudrys Dekorationsmalereien, über Meissonier,
die Schule von Fontainebleau, Bastien-Lepage ver-
treten; durch die Lithographien von Monnier und
Daumier lässt sie sich ergänzen.
Von Engländern kommen in Betracht: Turner,
Constable, Rossetti, Watts, Millais, Leighton, Tadema,
Whistler, während über den feinsinnigen Frederick
Walker noch nichts erschienen ist. Zu den Humo-
risten des Punch kommen hier Cruikshank und
Caldecott; als Meister der Dekoration Walter Crane
und Kate Greenaway.
Grundzüge für eine
Künstlerbibliothek.
360
Genauigkeit aus; zugleich soll dadurch den Künstlern
ein Uberblick über das Wichtigste aus den sie inter-
essirenden Gebieten gewährt werden.
Beginnen wir mit dem, was den Künstler in
erster Linie interessiren muss, so sind dies die ein-
zelnen Künstler und deren Werke. Die Künstler-
biographien sowie die Reproduktionen des Gesamt-
werks der einzelnen Künstler werden demnach die
beiden ersten Gruppen bilden. Und zwar werden
die Reproduktionswerke voranzustellen haben.
Wenn auch eine individuelle Künstlergeschichte
erst mit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
beginnt, so treten bestimmte Künstlerpersönlichkeiten
in ihren Werken schon seit dem 13. Jahrhundert
hervor, seit Duccio, Cimabue und Giotto. Da nur
über wenige der großen Meister erschöpfende und
ausreichende Reproduktionswerke vorhanden sind, so
werden die Werke der meisten in einzelnen Photogra-
phien zu sammeln sein, wie die von Giotto, Masaccio,
Fiesole, Van Eyck; Mantegna, Piero della Francesca,
Ghirlandaio, Signorelli, Bellini; Lionardo, Michelan-
gelo, Raphael; Giorgione, Tizian, Correggio; Veronese,
Rubens; Reinbrandt, Frans Hals; Velazquez, Murillo;
Watteau, Delacroix; Millet, Feuerbach, Puvis de
Chavannes. Von diesen Meistern sollte man suchen,
so weit möglich alles, was sie geschaffen haben
(nicht nur Gemälde, sondern auch Zeichnungen,
Stiche, Radirungen, plastische und architektonische
Arbeiten), in möglichst großen und guten Photo-
graphien zusammenzubringen; aber auch nur solche
Werke, die ihnen wenigstens mit einem Schein des
Rechts zugeschrieben werden. Hervorragende Schöp-
fungen andrer, nicht so fruchtbarer Künstler mögen
dann zur Vervollständigung herbeigezogen werden.
Von geschlossenen Reproduklionswerken sind da-
gegen vor allem die folgenden zu nennen: Donatello's
Werke in den von Bode herausgegebnen Denkmälern
der Quattrocentoskulptur; Botticelli's Zeichnungen zur
Göttlichen Komödie; Bramante's Pläne in den von
Geymüller herausgegebnen Entwürfen für die Peters-
kirche; Raphaels Entwürfe für die Schule von Athen
in der Sonderschrift von Springer; Amand-Durands
Reproduktionen der Stiche von Mantegna, Schon-
gauer, Dürer, Lukas von Leiden, sowie einzelne
Blätter andrer Kupferstecher; für Dürer die Sol-
dansche Publikation über seine Gemälde, die von
Lippmann herausgegebnen unübertrefflichen Repro-
duktionen seiner Zeichnungen (wozu die Schrift von
Ephrussi, Les dessins de Dürer zu vergleichen ist)
die van der Weyerschen Reproduktionen seiner
großen Holzschnittfolgen (eine gute Gesaint-Repro-
duktion seiner sonstigen Einzelblätter existirt meines
Wissens noch nicht); für Holbein das Werk von
Mantz, ferner His' Ausgabe seiner Ornamentzeich-
nungen und Lippmanns Reproduktionen des Toten-
tanzes; weiter Tereys Ausgabe der Zeichnungen von
Baidung; für Rubens das Werk von Rooses, wenn
auch dessen Abbildungen zu klein sind; für Rem-
brandt die Lippmannsche Ausgabe der Zeichnungen,
der sich bald die von Bode vorbereitete Monumental-
Ausgabe seiner sämtlichen Gemälde anreihen wird, und
die Reproduktionen seiner sämtlichen Radirungen
(besser in der Blancschen Ausgabe von 1880 als in der
retuschirten Dutuit'schen); dann die Werke von Wat-
teau, Hogarth, Canaletto, Piranesi, Goya; endlich Cho-
dowiecki's Reise nach Danzig und seine Zeichnungen.
Das wird wohl das Wichtigste an Reproduktions-
werken über einzelne Künstler der früheren Jahr-
hunderte sein; viel ist es nicht. Wollte man Kupfer-
stiche nach Gemälden mit zu Hilfe nehmen, wie
man sogenannte Maler - Oeuvres im vorigen Jahr-
hundert bildete, so würde man schon weiter kommen:
aber damit wäre unsrer Zeit kaum gedient.
Für die neuere Zeit ist schon besser gesorgt:
da hat man photographische Reproduktionen nach
Carstens, Cornelius, Rethels, Kaulbachs, Feuerbachs,
Mintrops Werken; die Stiche nach Cornelius' Faust
und den Nibelungen, nach Overbecks Evangelien und
Sakramenten, nach Genellis Cyklen; die Reproduk-
tionen nach G. Schadows Zeichnungen, nach Steinles,
Schwinds Märchenkompositionen, Schnorrs Bibel in
Bildern und dessen italienische Landschaften, Prellers
Odysseelandschaften und Rottmanns italienische Land-
schaften; ferner die von Führich illustrirten Werke,
Ludwig Richters Bücherillustrationen, Menzels Dar-
stellungen aus der Zeit Friedrichs des Großen sowie
das monumentale Menzel - Werk aus Bruckmanns
Verlag; C. Fiedlers schöne Publikation über Hans
von Marees.
Frankreichs Kunst wird durch die Publikationen
über Baudrys Dekorationsmalereien, über Meissonier,
die Schule von Fontainebleau, Bastien-Lepage ver-
treten; durch die Lithographien von Monnier und
Daumier lässt sie sich ergänzen.
Von Engländern kommen in Betracht: Turner,
Constable, Rossetti, Watts, Millais, Leighton, Tadema,
Whistler, während über den feinsinnigen Frederick
Walker noch nichts erschienen ist. Zu den Humo-
risten des Punch kommen hier Cruikshank und
Caldecott; als Meister der Dekoration Walter Crane
und Kate Greenaway.