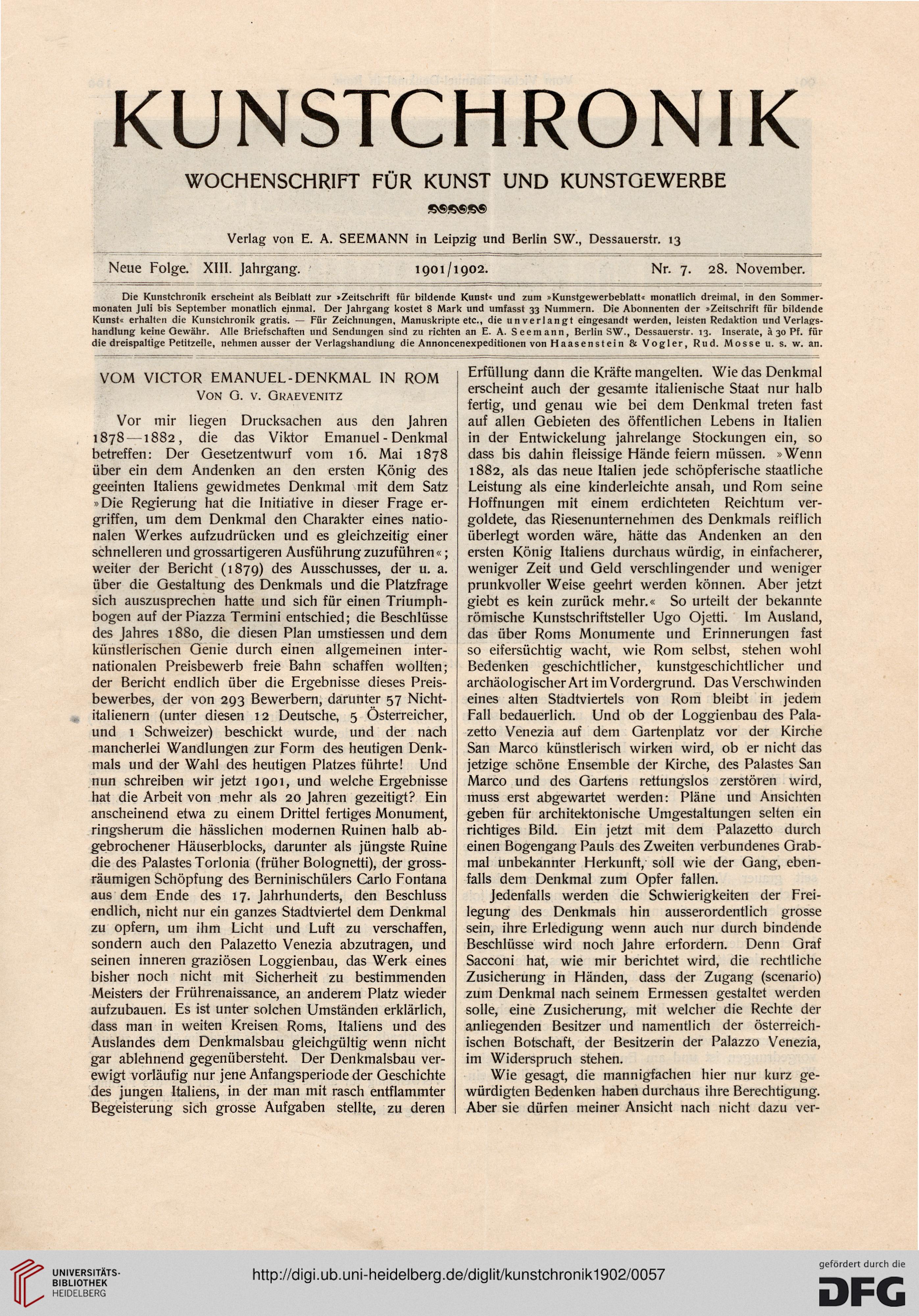KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 7. 28. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlags-
handlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von H aasen stein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
VOM VICTOR EMANUEL-DENKMAL IN ROM
Von O. v. Oraevenitz
Vor mir liegen Drucksachen aus den Jahren
1878 —1882, die das Viktor Emanuel - Denkmal
betreffen: Der Oesetzentwurf vom 16. Mai 1878
über ein dem Andenken an den ersten König des
geeinten Italiens gewidmetes Denkmal mit dem Satz
»Die Regierung hat die Initiative in dieser Frage er-
griffen, um dem Denkmal den Charakter eines natio-
nalen Werkes aufzudrücken und es gleichzeitig einer
schnelleren und grossartigeren Ausführung zuzuführen«;
weiter der Bericht (1879) des Ausschusses, der u. a.
über die Gestaltung des Denkmals und die Platzfrage
sich auszusprechen hatte und sich für einen Triumph-
bogen auf der Piazza Termini entschied; die Beschlüsse
des Jahres 1880, die diesen Plan umstiessen und dem
künstlerischen Genie durch einen allgemeinen inter-
nationalen Preisbewerb freie Bahn schaffen wollten;
der Bericht endlich über die Ergebnisse dieses Preis-
bewerbes, der von 293 Bewerbern, darunter 57 Nicht-
italienern (unter diesen 12 Deutsche, 5 Österreicher,
und 1 Schweizer) beschickt wurde, und der nach
mancherlei Wandlungen zur Form des heutigen Denk-
mals und der Wahl des heutigen Platzes führte! Und
nun schreiben wir jetzt 1901, und welche Ergebnisse
hat die Arbeit von mehr als 20 Jahren gezeitigt? Ein
anscheinend etwa zu einem Drittel fertiges Monument,
ringsherum die hässlichen modernen Ruinen halb ab-
gebrochener Häuserblocks, darunter als jüngste Ruine
die des Palastes Torlonia (früher Bolognetti), der gross-
räumigen Schöpfung des Berninischülers Carlo Fontana
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, den Beschluss
endlich, nicht nur ein ganzes Stadtviertel dem Denkmal
zu opfern, um ihm Licht und Luft zu verschaffen,
sondern auch den Palazetto Venezia abzutragen, und
seinen inneren graziösen Loggienbau, das Werk eines
bisher noch nicht mit Sicherheit zu bestimmenden
Meisters der Frührenaissance, an anderem Platz wieder
aufzubauen. Es ist unter solchen Umständen erklärlich,
dass man in weiten Kreisen Roms, Italiens und des
Auslandes dem Denkmalsbau gleichgültig wenn nicht
gar ablehnend gegenübersteht. Der Denkmalsbau ver-
ewigt vorläufig nur jene Anfangsperiode der Geschichte
des jungen Italiens, in der man mit rasch entflammter
Begeisterung sich grosse Aufgaben stellte, zu deren
Erfüllung dann die Kräfte mangelten. Wie das Denkmal
erscheint auch der gesamte italienische Staat nur halb
fertig, und genau wie bei dem Denkmal treten fast
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens in Italien
in der Entwickelung jahrelange Stockungen ein, so
dass bis dahin fleissige Hände feiern müssen. »Wenn
1882, als das neue Italien jede schöpferische staatliche
Leistung als eine kinderleichte ansah, und Rom seine
Hoffnungen mit einem erdichteten Reichtum ver-
goldete, das Riesenunternehmen des Denkmals reiflich
überlegt worden wäre, hätte das Andenken an den
ersten König Italiens durchaus würdig, in einfacherer,
weniger Zeit und Geld verschlingender und weniger
prunkvoller Weise geehrt werden können. Aber jetzt
giebt es kein zurück mehr.« So urteilt der bekannte
römische Kunstschriftsteller Ugo Ojetti. Im Ausland,
das über Roms Monumente und Erinnerungen fast
so eifersüchtig wacht, wie Rom selbst, stehen wohl
Bedenken geschichtlicher, kunstgeschichtlicher und
archäologischer Art im Vordergrund. Das Verschwinden
eines alten Stadtviertels von Rom bleibt in jedem
Fall bedauerlich. Und ob der Loggienbau des Pala-
zetto Venezia auf dem Gartenplatz vor der Kirche
San Marco künstlerisch wirken wird, ob er nicht das
jetzige schöne Ensemble der Kirche, des Palastes San
Marco und des Gartens rettungslos zerstören wird,
muss erst abgewartet werden: Pläne und Ansichten
geben für architektonische Umgestaltungen selten ein
richtiges Bild. Ein jetzt mit dem Palazetto durch
einen Bogengang Pauls des Zweiten verbundenes Grab-
mal unbekannter Herkunft, soll wie der Gang, eben-
falls dem Denkmal zum Opfer fallen.
Jedenfalls werden die Schwierigkeiten der Frei-
legung des Denkmals hin ausserordentlich grosse
sein, ihre Erledigung wenn auch nur durch bindende
Beschlüsse wird noch Jahre erfordern. Denn Graf
Sacconi hat, wie mir berichtet wird, die rechtliche
Zusicherung in Händen, dass der Zugang (scenario)
zum Denkmal nach seinem Ermessen gestaltet werden
solle, eine Zusicherung, mit welcher die Rechte der
anliegenden Besitzer und namentlich der österreich-
ischen Botschaft, der Besitzerin der Palazzo Venezia,
im Widerspruch stehen.
Wie gesagt, die mannigfachen hier nur kurz ge-
würdigten Bedenken haben durchaus ihre Berechtigung.
Aber sie dürfen meiner Ansicht nach nicht dazu ver-
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 7. 28. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlags-
handlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von H aasen stein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
VOM VICTOR EMANUEL-DENKMAL IN ROM
Von O. v. Oraevenitz
Vor mir liegen Drucksachen aus den Jahren
1878 —1882, die das Viktor Emanuel - Denkmal
betreffen: Der Oesetzentwurf vom 16. Mai 1878
über ein dem Andenken an den ersten König des
geeinten Italiens gewidmetes Denkmal mit dem Satz
»Die Regierung hat die Initiative in dieser Frage er-
griffen, um dem Denkmal den Charakter eines natio-
nalen Werkes aufzudrücken und es gleichzeitig einer
schnelleren und grossartigeren Ausführung zuzuführen«;
weiter der Bericht (1879) des Ausschusses, der u. a.
über die Gestaltung des Denkmals und die Platzfrage
sich auszusprechen hatte und sich für einen Triumph-
bogen auf der Piazza Termini entschied; die Beschlüsse
des Jahres 1880, die diesen Plan umstiessen und dem
künstlerischen Genie durch einen allgemeinen inter-
nationalen Preisbewerb freie Bahn schaffen wollten;
der Bericht endlich über die Ergebnisse dieses Preis-
bewerbes, der von 293 Bewerbern, darunter 57 Nicht-
italienern (unter diesen 12 Deutsche, 5 Österreicher,
und 1 Schweizer) beschickt wurde, und der nach
mancherlei Wandlungen zur Form des heutigen Denk-
mals und der Wahl des heutigen Platzes führte! Und
nun schreiben wir jetzt 1901, und welche Ergebnisse
hat die Arbeit von mehr als 20 Jahren gezeitigt? Ein
anscheinend etwa zu einem Drittel fertiges Monument,
ringsherum die hässlichen modernen Ruinen halb ab-
gebrochener Häuserblocks, darunter als jüngste Ruine
die des Palastes Torlonia (früher Bolognetti), der gross-
räumigen Schöpfung des Berninischülers Carlo Fontana
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, den Beschluss
endlich, nicht nur ein ganzes Stadtviertel dem Denkmal
zu opfern, um ihm Licht und Luft zu verschaffen,
sondern auch den Palazetto Venezia abzutragen, und
seinen inneren graziösen Loggienbau, das Werk eines
bisher noch nicht mit Sicherheit zu bestimmenden
Meisters der Frührenaissance, an anderem Platz wieder
aufzubauen. Es ist unter solchen Umständen erklärlich,
dass man in weiten Kreisen Roms, Italiens und des
Auslandes dem Denkmalsbau gleichgültig wenn nicht
gar ablehnend gegenübersteht. Der Denkmalsbau ver-
ewigt vorläufig nur jene Anfangsperiode der Geschichte
des jungen Italiens, in der man mit rasch entflammter
Begeisterung sich grosse Aufgaben stellte, zu deren
Erfüllung dann die Kräfte mangelten. Wie das Denkmal
erscheint auch der gesamte italienische Staat nur halb
fertig, und genau wie bei dem Denkmal treten fast
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens in Italien
in der Entwickelung jahrelange Stockungen ein, so
dass bis dahin fleissige Hände feiern müssen. »Wenn
1882, als das neue Italien jede schöpferische staatliche
Leistung als eine kinderleichte ansah, und Rom seine
Hoffnungen mit einem erdichteten Reichtum ver-
goldete, das Riesenunternehmen des Denkmals reiflich
überlegt worden wäre, hätte das Andenken an den
ersten König Italiens durchaus würdig, in einfacherer,
weniger Zeit und Geld verschlingender und weniger
prunkvoller Weise geehrt werden können. Aber jetzt
giebt es kein zurück mehr.« So urteilt der bekannte
römische Kunstschriftsteller Ugo Ojetti. Im Ausland,
das über Roms Monumente und Erinnerungen fast
so eifersüchtig wacht, wie Rom selbst, stehen wohl
Bedenken geschichtlicher, kunstgeschichtlicher und
archäologischer Art im Vordergrund. Das Verschwinden
eines alten Stadtviertels von Rom bleibt in jedem
Fall bedauerlich. Und ob der Loggienbau des Pala-
zetto Venezia auf dem Gartenplatz vor der Kirche
San Marco künstlerisch wirken wird, ob er nicht das
jetzige schöne Ensemble der Kirche, des Palastes San
Marco und des Gartens rettungslos zerstören wird,
muss erst abgewartet werden: Pläne und Ansichten
geben für architektonische Umgestaltungen selten ein
richtiges Bild. Ein jetzt mit dem Palazetto durch
einen Bogengang Pauls des Zweiten verbundenes Grab-
mal unbekannter Herkunft, soll wie der Gang, eben-
falls dem Denkmal zum Opfer fallen.
Jedenfalls werden die Schwierigkeiten der Frei-
legung des Denkmals hin ausserordentlich grosse
sein, ihre Erledigung wenn auch nur durch bindende
Beschlüsse wird noch Jahre erfordern. Denn Graf
Sacconi hat, wie mir berichtet wird, die rechtliche
Zusicherung in Händen, dass der Zugang (scenario)
zum Denkmal nach seinem Ermessen gestaltet werden
solle, eine Zusicherung, mit welcher die Rechte der
anliegenden Besitzer und namentlich der österreich-
ischen Botschaft, der Besitzerin der Palazzo Venezia,
im Widerspruch stehen.
Wie gesagt, die mannigfachen hier nur kurz ge-
würdigten Bedenken haben durchaus ihre Berechtigung.
Aber sie dürfen meiner Ansicht nach nicht dazu ver-