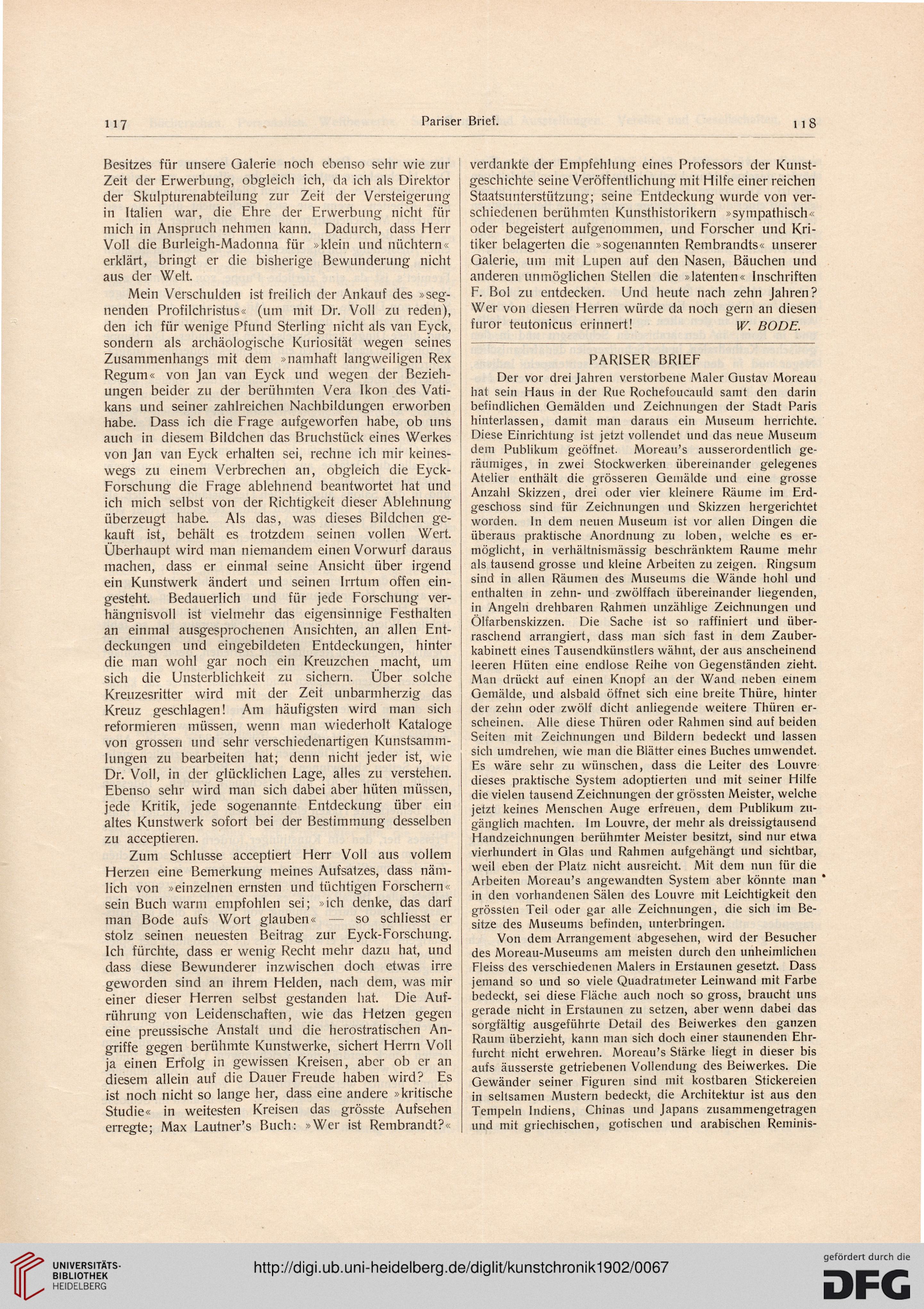117
Pariser Brief.
Besitzes für unsere Galerie noch ebenso sehr wie zur
Zeit der Erwerbung, obgleich ich, da ich als Direktor
der Skulpturenabteilung zur Zeit der Versteigerung
in Italien war, die Ehre der Erwerbung nicht für
mich in Anspruch nehmen kann. Dadurch, dass Herr
Voll die Burleigh-Madonna für »klein und nüchtern«
erklärt, bringt er die bisherige Bewunderung nicht
aus der Welt.
Mein Verschulden ist freilich der Ankauf des »seg-
nenden Profilchristus« (um mit Dr. Voll zu reden),
den ich für wenige Pfund Sterling nicht als van Eyck,
sondern als archäologische Kuriosität wegen seines
Zusammenhangs mit dem »namhaft langweiligen Rex
Regum« von Jan van Eyck und wegen der Bezieh-
ungen beider zu der berühmten Vera Ikon des Vati-
kans und seiner zahlreichen Nachbildungen erworben
habe. Dass ich die Frage aufgeworfen habe, ob uns
auch in diesem Bildchen das Bruchstück eines Werkes
von Jan van Eyck erhalten sei, rechne ich mir keines-
wegs zu einem Verbrechen an, obgleich die Eyck-
Forschung die Frage ablehnend beantwortet hat und
ich mich selbst von der Richtigkeit dieser Ablehnung
überzeugt habe. Als das, was dieses Bildchen ge-
kauft ist, behält es trotzdem seinen vollen Wert.
Überhaupt wird man niemandem einen Vorwurf daraus
machen, dass er einmal seine Ansicht über irgend
ein Kunstwerk ändert und seinen Irrtum offen ein-
gesteht. Bedauerlich und für jede Forschung ver-
hängnisvoll ist vielmehr das eigensinnige Festhalten
an einmal ausgesprochenen Ansichten, an allen Ent-
deckungen und eingebildeten Entdeckungen, hinter
die man wohl gar noch ein Kreuzchen macht, um
sich die Unsterblichkeit zu sichern. Über solche
Kreuzesritter wird mit der Zeit unbarmherzig das
Kreuz geschlagen! Am häufigsten wird man sich
reformieren müssen, wenn man wiederholt Kataloge
von grossen und sehr verschiedenartigen Kunstsamm-
lungen zu bearbeiten hat; denn nicht jeder ist, wie
Dr. Voll, in der glücklichen Lage, alles zu verstehen.
Ebenso sehr wird man sich dabei aber hüten müssen,
jede Kritik, jede sogenannte Entdeckung über ein
altes Kunstwerk sofort bei der Bestimmung desselben
zu acceptieren.
Zum Schlüsse acceptiert Herr Voll aus vollem
Herzen eine Bemerkung meines Aufsatzes, dass näm-
lich von »einzelnen ernsten und tüchtigen Forschern«
sein Buch warm empfohlen sei; »ich denke, das darf
man Bode aufs Wort glauben« so schliesst er
stolz seinen neuesten Beitrag zur Eyck-Forschung.
Ich fürchte, dass er wenig Recht mehr dazu hat, und
dass diese Bewunderer inzwischen doch etwas irre
geworden sind an ihrem Helden, nach dem, was mir
einer dieser Herren selbst gestanden hat. Die Auf-
rührung von Leidenschaften, wie das Hetzen gegen
eine preussische Anstalt und die herostratischen An-
griffe gegen berühmte Kunstwerke, sichert Herrn Voll
ja einen Erfolg in gewissen Kreisen, aber ob er an
diesem allein auf die Dauer Freude haben wird? Es
ist noch nicht so lange her, dass eine andere »kritische
Studie« in weitesten Kreisen das grösste Aufsehen
erregte; Max Lautner's Buch: »Wer ist Rembrandt?«
verdankte der Empfehlung eines Professors der Kunst-
geschichte seine Veröffentlichung mit Hilfe einer reichen
Staatsunterstützung; seine Entdeckung wurde von ver-
schiedenen berühmten Kunsthistorikern »sympathisch'
oder begeistert aufgenommen, und Forscher und Kri-
tiker belagerten die »sogenannten Rembrandts« unserer
Galerie, um mit Lupen auf den Nasen, Bäuchen und
anderen unmöglichen Stellen die »latenten« Inschriften
F. Bol zu entdecken. Und heute nach zehn Jahren?
Wer von diesen Herren würde da noch gern an diesen
furor teutonicus erinnert! w. BODE.
PARISER BRIEF
Der vor drei Jahren verstorbene Maler Gustav Moreau
hat sein Haus in der Rue Rochefoucauld samt den darin
befindlichen Gemälden und Zeichnungen der Stadt Paris
hinterlassen, damit man daraus ein Museum herrichte.
Diese Einrichtung ist jetzt vollendet und das neue Museum
dem Publikum geöffnet. Moreau's ausserordentlich ge-
räumiges, in zwei Stockwerken übereinander gelegenes
Atelier enthält die grösseren Gemälde und eine grosse
Anzahl Skizzen, drei oder vier kleinere Räume im Erd-
geschoss sind für Zeichnungen und Skizzen hergerichtet
worden. In dem neuen Museum ist vor allen Dingen die
überaus praktische Anordnung zu loben, welche es er-
möglicht, in verhältnismässig beschränktem Räume mehr
als tausend grosse und kleine Arbeiten zu zeigen. Ringsum
sind in allen Räumen des Museums die Wände hohl und
enthalten in zehn- und zwölffach übereinander liegenden,
in Angeln drehbaren Rahmen unzählige Zeichnungen und
Ölfarbenskizzen. Die Sache ist so raffiniert und über-
raschend arrangiert, dass man sich fast in dem Zauber-
kabinett eines Tausendkünstlers wähnt, der aus anscheinend
leeren Hüten eine endlose Reihe von Gegenständen zieht.
Man drückt auf einen Knopf an der Wand neben einem
Gemälde, und alsbald öffnet sich eine breite Thüre, hinter
der zehn oder zwölf dicht anliegende weitere Thülen er-
scheinen. Alle diese Thüren oder Rahmen sind auf beiden
Seiten mit Zeichnungen und Bildern bedeckt und lassen
sich umdrehen, wie man die Blätter eines Buches umwendet.
Es wäre sehr zu wünschen, dass die Leiter des Louvre
dieses praktische System adoptierten und mit seiner Hilfe
die vielen tausend Zeichnungen der grössten Meister, welche
jetzt keines Menschen Auge erfreuen, dem Publikum zu-
gänglich machten. Im Louvre, der mehr als dreissigtausend
Handzeichnungen berühmter Meister besitzt, sind nur etwa
vierhundert in Glas und Rahmen aufgehängt und sichtbar,
weil eben der Platz nicht ausreicht. Mit dem nun für die
Arbeiten Moreau's angewandten System aber könnte man *
in den vorhandenen Sälen des Louvre mit Leichtigkeit den
grössten Teil oder gar alle Zeichnungen, die sich im Be-
sitze des Museums befinden, unterbringen.
Von dem Arrangement abgesehen, wird der Besucher
des Moreau-Museums am meisten durch den unheimlichen
Fleiss des verschiedenen Malers in Erstaunen gesetzt. Dass
jemand so und so viele Quadratmeter Leinwand mit Farbe
bedeckt, sei diese Fläche auch noch so gross, braucht uns
gerade nicht in Erstaunen zu setzen, aber wenn dabei das
sorgfältig ausgeführte Detail des Beiwerkes den ganzen
Raum überzieht, kann man sich doch einer staunenden Ehr-
furcht nicht erwehren. Moreau's Stärke liegt in dieser bis
aufs äusserste getriebenen Vollendung des Beiwerkes. Die
Gewänder seiner Figuren sind mit kostbaren Stickereien
in seltsamen Mustern bedeckt, die Architektur ist aus den
Tempeln Indiens, Chinas und Japans zusammengetragen
und mit griechischen, gotischen und arabischen Reminis-
Pariser Brief.
Besitzes für unsere Galerie noch ebenso sehr wie zur
Zeit der Erwerbung, obgleich ich, da ich als Direktor
der Skulpturenabteilung zur Zeit der Versteigerung
in Italien war, die Ehre der Erwerbung nicht für
mich in Anspruch nehmen kann. Dadurch, dass Herr
Voll die Burleigh-Madonna für »klein und nüchtern«
erklärt, bringt er die bisherige Bewunderung nicht
aus der Welt.
Mein Verschulden ist freilich der Ankauf des »seg-
nenden Profilchristus« (um mit Dr. Voll zu reden),
den ich für wenige Pfund Sterling nicht als van Eyck,
sondern als archäologische Kuriosität wegen seines
Zusammenhangs mit dem »namhaft langweiligen Rex
Regum« von Jan van Eyck und wegen der Bezieh-
ungen beider zu der berühmten Vera Ikon des Vati-
kans und seiner zahlreichen Nachbildungen erworben
habe. Dass ich die Frage aufgeworfen habe, ob uns
auch in diesem Bildchen das Bruchstück eines Werkes
von Jan van Eyck erhalten sei, rechne ich mir keines-
wegs zu einem Verbrechen an, obgleich die Eyck-
Forschung die Frage ablehnend beantwortet hat und
ich mich selbst von der Richtigkeit dieser Ablehnung
überzeugt habe. Als das, was dieses Bildchen ge-
kauft ist, behält es trotzdem seinen vollen Wert.
Überhaupt wird man niemandem einen Vorwurf daraus
machen, dass er einmal seine Ansicht über irgend
ein Kunstwerk ändert und seinen Irrtum offen ein-
gesteht. Bedauerlich und für jede Forschung ver-
hängnisvoll ist vielmehr das eigensinnige Festhalten
an einmal ausgesprochenen Ansichten, an allen Ent-
deckungen und eingebildeten Entdeckungen, hinter
die man wohl gar noch ein Kreuzchen macht, um
sich die Unsterblichkeit zu sichern. Über solche
Kreuzesritter wird mit der Zeit unbarmherzig das
Kreuz geschlagen! Am häufigsten wird man sich
reformieren müssen, wenn man wiederholt Kataloge
von grossen und sehr verschiedenartigen Kunstsamm-
lungen zu bearbeiten hat; denn nicht jeder ist, wie
Dr. Voll, in der glücklichen Lage, alles zu verstehen.
Ebenso sehr wird man sich dabei aber hüten müssen,
jede Kritik, jede sogenannte Entdeckung über ein
altes Kunstwerk sofort bei der Bestimmung desselben
zu acceptieren.
Zum Schlüsse acceptiert Herr Voll aus vollem
Herzen eine Bemerkung meines Aufsatzes, dass näm-
lich von »einzelnen ernsten und tüchtigen Forschern«
sein Buch warm empfohlen sei; »ich denke, das darf
man Bode aufs Wort glauben« so schliesst er
stolz seinen neuesten Beitrag zur Eyck-Forschung.
Ich fürchte, dass er wenig Recht mehr dazu hat, und
dass diese Bewunderer inzwischen doch etwas irre
geworden sind an ihrem Helden, nach dem, was mir
einer dieser Herren selbst gestanden hat. Die Auf-
rührung von Leidenschaften, wie das Hetzen gegen
eine preussische Anstalt und die herostratischen An-
griffe gegen berühmte Kunstwerke, sichert Herrn Voll
ja einen Erfolg in gewissen Kreisen, aber ob er an
diesem allein auf die Dauer Freude haben wird? Es
ist noch nicht so lange her, dass eine andere »kritische
Studie« in weitesten Kreisen das grösste Aufsehen
erregte; Max Lautner's Buch: »Wer ist Rembrandt?«
verdankte der Empfehlung eines Professors der Kunst-
geschichte seine Veröffentlichung mit Hilfe einer reichen
Staatsunterstützung; seine Entdeckung wurde von ver-
schiedenen berühmten Kunsthistorikern »sympathisch'
oder begeistert aufgenommen, und Forscher und Kri-
tiker belagerten die »sogenannten Rembrandts« unserer
Galerie, um mit Lupen auf den Nasen, Bäuchen und
anderen unmöglichen Stellen die »latenten« Inschriften
F. Bol zu entdecken. Und heute nach zehn Jahren?
Wer von diesen Herren würde da noch gern an diesen
furor teutonicus erinnert! w. BODE.
PARISER BRIEF
Der vor drei Jahren verstorbene Maler Gustav Moreau
hat sein Haus in der Rue Rochefoucauld samt den darin
befindlichen Gemälden und Zeichnungen der Stadt Paris
hinterlassen, damit man daraus ein Museum herrichte.
Diese Einrichtung ist jetzt vollendet und das neue Museum
dem Publikum geöffnet. Moreau's ausserordentlich ge-
räumiges, in zwei Stockwerken übereinander gelegenes
Atelier enthält die grösseren Gemälde und eine grosse
Anzahl Skizzen, drei oder vier kleinere Räume im Erd-
geschoss sind für Zeichnungen und Skizzen hergerichtet
worden. In dem neuen Museum ist vor allen Dingen die
überaus praktische Anordnung zu loben, welche es er-
möglicht, in verhältnismässig beschränktem Räume mehr
als tausend grosse und kleine Arbeiten zu zeigen. Ringsum
sind in allen Räumen des Museums die Wände hohl und
enthalten in zehn- und zwölffach übereinander liegenden,
in Angeln drehbaren Rahmen unzählige Zeichnungen und
Ölfarbenskizzen. Die Sache ist so raffiniert und über-
raschend arrangiert, dass man sich fast in dem Zauber-
kabinett eines Tausendkünstlers wähnt, der aus anscheinend
leeren Hüten eine endlose Reihe von Gegenständen zieht.
Man drückt auf einen Knopf an der Wand neben einem
Gemälde, und alsbald öffnet sich eine breite Thüre, hinter
der zehn oder zwölf dicht anliegende weitere Thülen er-
scheinen. Alle diese Thüren oder Rahmen sind auf beiden
Seiten mit Zeichnungen und Bildern bedeckt und lassen
sich umdrehen, wie man die Blätter eines Buches umwendet.
Es wäre sehr zu wünschen, dass die Leiter des Louvre
dieses praktische System adoptierten und mit seiner Hilfe
die vielen tausend Zeichnungen der grössten Meister, welche
jetzt keines Menschen Auge erfreuen, dem Publikum zu-
gänglich machten. Im Louvre, der mehr als dreissigtausend
Handzeichnungen berühmter Meister besitzt, sind nur etwa
vierhundert in Glas und Rahmen aufgehängt und sichtbar,
weil eben der Platz nicht ausreicht. Mit dem nun für die
Arbeiten Moreau's angewandten System aber könnte man *
in den vorhandenen Sälen des Louvre mit Leichtigkeit den
grössten Teil oder gar alle Zeichnungen, die sich im Be-
sitze des Museums befinden, unterbringen.
Von dem Arrangement abgesehen, wird der Besucher
des Moreau-Museums am meisten durch den unheimlichen
Fleiss des verschiedenen Malers in Erstaunen gesetzt. Dass
jemand so und so viele Quadratmeter Leinwand mit Farbe
bedeckt, sei diese Fläche auch noch so gross, braucht uns
gerade nicht in Erstaunen zu setzen, aber wenn dabei das
sorgfältig ausgeführte Detail des Beiwerkes den ganzen
Raum überzieht, kann man sich doch einer staunenden Ehr-
furcht nicht erwehren. Moreau's Stärke liegt in dieser bis
aufs äusserste getriebenen Vollendung des Beiwerkes. Die
Gewänder seiner Figuren sind mit kostbaren Stickereien
in seltsamen Mustern bedeckt, die Architektur ist aus den
Tempeln Indiens, Chinas und Japans zusammengetragen
und mit griechischen, gotischen und arabischen Reminis-