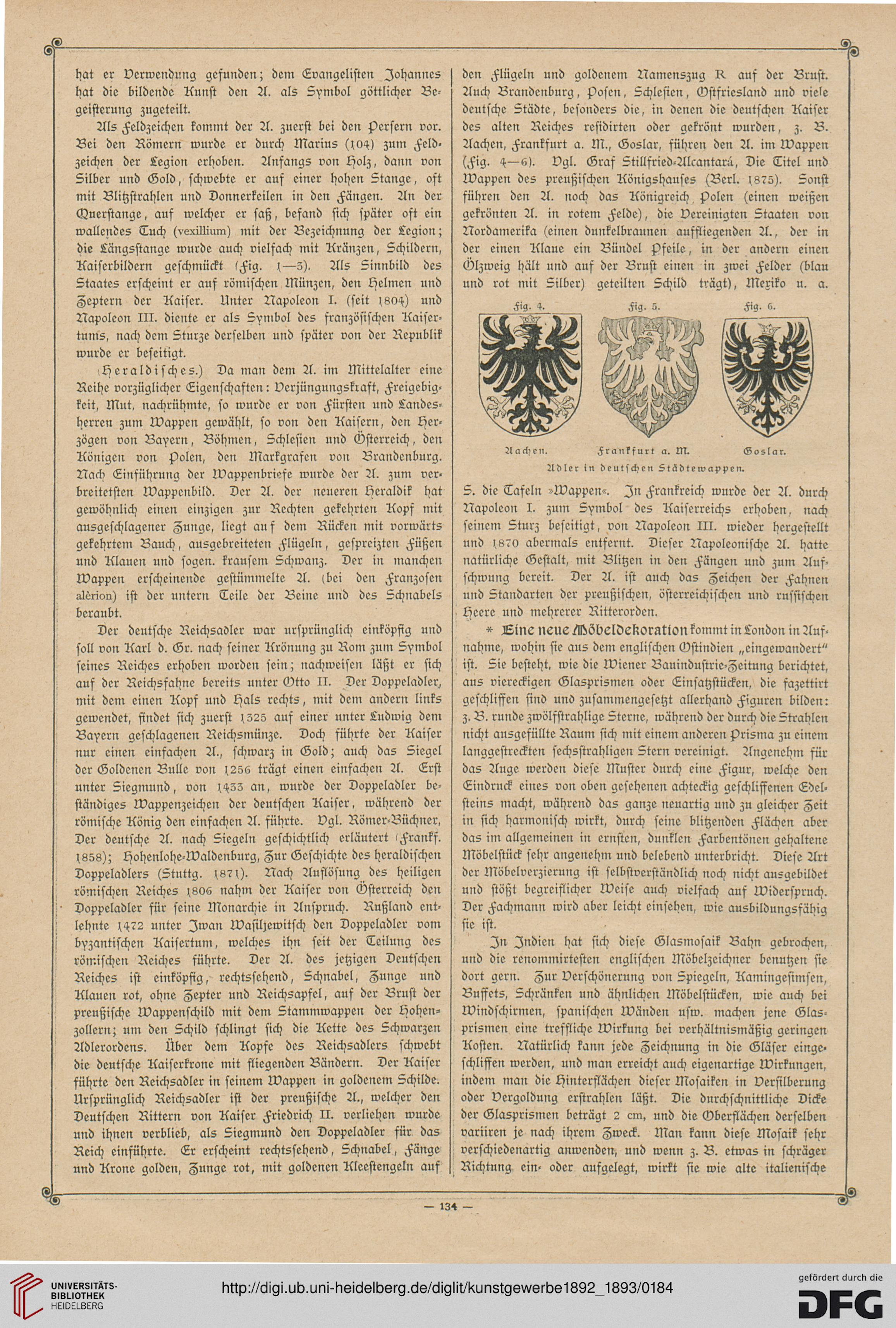hat er verwendung gefunden; dein Lvangelisten Iohannes
hat die bildende Uunst den A. als Symbol göttlicher Be-
geisternng zugeteilt.
Als Feldzeichen kommt der 2l. zuerst bei den Persern vor.
Bei den Römern wurde er durch Marius zum Feld-
zeichen der Legion erhoben. Anfangs von kolz, dann von
Silber und Gold, schwcbte er auf einer hohen Stange, oft
mit Blitzstrahlen nnd Donnerkeilen in den Fängen. An der
Vuerstange, auf welcher er saß, befand stch spätcr oft ein
wallendes Tuch (vexillium) mit der Bezeichnung der Legion;
die Längsstange wurde auch vielfach mit Rränzen, Schildern,
Raiserbildern geschmückt lFig. ;—3). Als Sinnbild des
Staates erscheint er auf römischen Miinzcn, den Lfelmen und
Zeptern der Aaiser. Unter Napoleon I. (seit ;80-l) und
Napoleon III. dicnte er als Symbol des französischen Aaiser-
tums, nach dem Sturze derselben und später von der Republik
wurde er beseitigt.
kseraldisches.) T>a man dem A. im Nlittelalter eine
Reihe vorzüglicher Ligenschaften: verjüngungskraft, Freigcbig-
keit, Nlut, nachrühmte, so wurde cr von Fürsten und Landes-
herren zum Ivappen gewählt, so von den Aaiscrn, dcn k)er>
zögen von Bayern, Böhmen, Schlesien und Bsterreich, dcn
Aönigen von Polen, den Nlarkgrafen von Brandenburg.
Nach Linführung der Ivappenbriefe wnrde der dl. zum ver-
breitetsten Ivappenbild. Der A. dcr neueren keraldik hat
gewöhnlich einen einzigen zur Rechten gckehrten Aopf mit
ausgeschlagener Zunge, liegt an f dem Rückon mit vorwärts
gekehrtem Bauch, ausgebreiteten Flügeln, gesxreizten Füßen
und Alauen und sogen. krausem Schwanz. Der in manchen
IVappen crscheinende gestümmelte A. ;bei den Franzosen
ulLriou) ist der untern Teile der Beine uud des Schnabels
beraubt.
Der deutsche Reichsavler war ursprünglich einköpfig und
soll von Aarl d. Gr. nach seiner Arönung zu Rom zum Symbol
seines Reiches erhoben worden sein; nachweisen läßt er stch
auf der Reichsfahne bereits unter Gtto II. Der Doppeladler,
mit dem einen Aopf und kjals rechts, mit dcm andern links
gewendet, findet sich zuerst 132s auf einer unter Ludwig dem
Bayern geschlagenon Reichsmünze. Doch führte dcr Aaiser
nur einen einfachen A., schwarz in Gold; auch das Siegel
dor Goldencn Bullo von ;256 trägt einen einfachen A. Lrst
untor Siegmund, von 1433 an, wurde der Doppeladler be-
ständiges lvappenzeichen der deutschen Aaiser, während der
römische Aönig den einfachen A. führte. vgl. Römer-Büchner,
Der deutsche A. nach Siegeln geschichtlich erläutert 'Frankf.
Z858); kjohenlohe-lvaldenburg, Znr Geschichte des heraldischen
Doppeladlers (Stuttg. 18?;). Nach Auflösnng des heiligen
römischen Reichcs ;8v6 nahm der Aaiser von Bstcrreich den
Doppeladler sür seine Nlonarchie in Anspruch. Rußland ent-
lehnte IH72 unter Iwan IVasiljewitsch den Doppeladler vom
byzantischen Aaisertum, welches ihn seit der Tcilung des
römischen Reiches führte. Der 2l. des jetzigen Deutschen
Reiches ist einköpfig, rechtssehend, Schnabcl, Zunge und
Alauen rot, ohne Zexter und Reichsapfel, auf der Brust der
preußische lvappenschild mit dem Stammwappen der ^ohen-
zollern; um den Schild schlingt sich die Aette des Schwarzen
Adlorordens. Über dem Aopfe des Reichsadlers schwcbt
die deutsche Aaiserkrone mit sliegenden Bändorn. Der Aaiser
sührte den Reichsadler in seinem lvappen in goldenem Schilde.
Ursprünglich Reichsadler ist der xreußische A., welcher den
Deutschen Rittern von Aaiser Friedrich II. verliehen wurde
und ihnen verblieb, als Siegmund den Doxxeladler für das
Reich einsührte. Lr erscheint rechtssehend, Schnabel, Fänge
und Arone golden, Zunge rot, mit goldencn Aleestengeln auf
den Flügeln und goldenem Namonszug R. auf der Brust.
Auch Brandenburg, posen, Schlesicn, Gstsriesland und viele
dcutsche Städte, besonders dio, in denen die deutschen Aaiser
des alten Reiches residirton oder gckrönt wurden, z. B.
Aachen, Franksnrt a. NI., Goslar, sühren den A. im lvappen
(Fig. -l—s>. vgl. Graf Stillfried-Alcantarä, Die Titel und
lvappen des preußischen Aönigshauses (Berl. j875). Sonst
sühren den A. noch das Aönigreich Polen (einen weißen
gekrönten A. in rotom Felde), die vereinigten Staaten von
Nordamerika (eincn dunkclbrauncn auffliegenden A., dcr in
der einen Alaue ein Bündel Pfeile, in der anöern einen
Glzweig hält und aus der Brust einen in zwei Felder (blau
und rot mit Silber) geteilten Schild trägt), lNeriko u. a.
Fig- g- Fig. s. jig. s.
S. die Tafeln »lvapxen«. In Frankreich wurde der A. durch
Naxoleon I. zum Symbol des Aaiserreichs erhoben, nach
seinem Sturz beseitigt, von Napoleon III. wieder hergestellt
nnd ;87v abermals entfernt. Diesor Napoleonische A. hatte
natürliche Gestalt, mit Blitzen in den Fängcn und zum Auf-
schwung bereit. Der A. ist auch das Zeichen der Fahnen
und Standarten der xreußischen, österreichischen und russischen
lseere und mehrerer Ritterorden.
* Line neue Nldöbeldekoratlon kommt in London in Aus-
nahme, wohin sie ans dem englischen Gstindien „eingewandert"
ist. Sie besteht, wie die lviener Bauindustrie-Zeitung berichtet,
aus viereckigen Glasprismen oder Linsatzstücken, die sazettirt
geschliffen sind nnö zusammengeseht allerhand Figuren bilden:
z. B. runde zwölfstrahlige Sterne, während der durch die Strahlen
nicht ausgefüllte Raum sich mit einem anderen Prisma zu einem
langgestrecktcn sechsstrahligen Storn vereinigt. Angenehm für
das Ange werden diese Mustcr durch eine Figur, welche den
Lindruck eines von oben gesehenen achteckig geschliffenen Ldel-
steins macht, während das ganze neuartig und zu gleicher Zeit
in sich harmonisch wirkt, durch seine blihenden Flächen aber
das im allgemeinen in ernstcn, dunklcn Farbentönen gehaltene
Nlöbelstück sehr angenehm und belebend unterbricht. Diese Art
dcr Nlöbclverzierung ist selbstverständlich noch nicht au-gebildet
und stößt begreiflicher lveiso auch vielfach auf lviderspruch.
Der Fachmann wird abor leicht einsehen, wie ausbildungsfähig
sie ist.
In Indien hat sich diese Glasmosaik Bahn gebrochen,
und die renommirtesten englischen Nlöbelzeichner benutzen sie
dort gern. Zur verschönerung von Spiegcln, Aamingesimsen,
Buffcts, Schränken und ähnlichen Möbelstücken, wie auch bei
lvindschirmen, spanischen lvänden usw. machen jene Glas-
prismen eine treffliche lvirkung bei verhältnismäßig geringen
Aosten. Natürlich kann jede Ieichnung in die Gläser einge-
schliffen werden, und man erreicht auch eigenartige lvirkungen,
indem man die kjinterflächcn dieser Mosaiken in versilberung
oder vergoldung erstrahlen läßt. Die dnrchschnittliche Dicke
der Glasxrismen bcträgt 2 cm, und die Gberflächen derselben
variiren je nach ihrem Zweck. Man kann diese Mosaik sehr
verschiedenartig anwenden, und wenn z. B. etwas in schräger
Richtung ein- oder aufgelegt, wirkt sie wie alte italienische
— 134 —
hat die bildende Uunst den A. als Symbol göttlicher Be-
geisternng zugeteilt.
Als Feldzeichen kommt der 2l. zuerst bei den Persern vor.
Bei den Römern wurde er durch Marius zum Feld-
zeichen der Legion erhoben. Anfangs von kolz, dann von
Silber und Gold, schwcbte er auf einer hohen Stange, oft
mit Blitzstrahlen nnd Donnerkeilen in den Fängen. An der
Vuerstange, auf welcher er saß, befand stch spätcr oft ein
wallendes Tuch (vexillium) mit der Bezeichnung der Legion;
die Längsstange wurde auch vielfach mit Rränzen, Schildern,
Raiserbildern geschmückt lFig. ;—3). Als Sinnbild des
Staates erscheint er auf römischen Miinzcn, den Lfelmen und
Zeptern der Aaiser. Unter Napoleon I. (seit ;80-l) und
Napoleon III. dicnte er als Symbol des französischen Aaiser-
tums, nach dem Sturze derselben und später von der Republik
wurde er beseitigt.
kseraldisches.) T>a man dem A. im Nlittelalter eine
Reihe vorzüglicher Ligenschaften: verjüngungskraft, Freigcbig-
keit, Nlut, nachrühmte, so wurde cr von Fürsten und Landes-
herren zum Ivappen gewählt, so von den Aaiscrn, dcn k)er>
zögen von Bayern, Böhmen, Schlesien und Bsterreich, dcn
Aönigen von Polen, den Nlarkgrafen von Brandenburg.
Nach Linführung der Ivappenbriefe wnrde der dl. zum ver-
breitetsten Ivappenbild. Der A. dcr neueren keraldik hat
gewöhnlich einen einzigen zur Rechten gckehrten Aopf mit
ausgeschlagener Zunge, liegt an f dem Rückon mit vorwärts
gekehrtem Bauch, ausgebreiteten Flügeln, gesxreizten Füßen
und Alauen und sogen. krausem Schwanz. Der in manchen
IVappen crscheinende gestümmelte A. ;bei den Franzosen
ulLriou) ist der untern Teile der Beine uud des Schnabels
beraubt.
Der deutsche Reichsavler war ursprünglich einköpfig und
soll von Aarl d. Gr. nach seiner Arönung zu Rom zum Symbol
seines Reiches erhoben worden sein; nachweisen läßt er stch
auf der Reichsfahne bereits unter Gtto II. Der Doppeladler,
mit dem einen Aopf und kjals rechts, mit dcm andern links
gewendet, findet sich zuerst 132s auf einer unter Ludwig dem
Bayern geschlagenon Reichsmünze. Doch führte dcr Aaiser
nur einen einfachen A., schwarz in Gold; auch das Siegel
dor Goldencn Bullo von ;256 trägt einen einfachen A. Lrst
untor Siegmund, von 1433 an, wurde der Doppeladler be-
ständiges lvappenzeichen der deutschen Aaiser, während der
römische Aönig den einfachen A. führte. vgl. Römer-Büchner,
Der deutsche A. nach Siegeln geschichtlich erläutert 'Frankf.
Z858); kjohenlohe-lvaldenburg, Znr Geschichte des heraldischen
Doppeladlers (Stuttg. 18?;). Nach Auflösnng des heiligen
römischen Reichcs ;8v6 nahm der Aaiser von Bstcrreich den
Doppeladler sür seine Nlonarchie in Anspruch. Rußland ent-
lehnte IH72 unter Iwan IVasiljewitsch den Doppeladler vom
byzantischen Aaisertum, welches ihn seit der Tcilung des
römischen Reiches führte. Der 2l. des jetzigen Deutschen
Reiches ist einköpfig, rechtssehend, Schnabcl, Zunge und
Alauen rot, ohne Zexter und Reichsapfel, auf der Brust der
preußische lvappenschild mit dem Stammwappen der ^ohen-
zollern; um den Schild schlingt sich die Aette des Schwarzen
Adlorordens. Über dem Aopfe des Reichsadlers schwcbt
die deutsche Aaiserkrone mit sliegenden Bändorn. Der Aaiser
sührte den Reichsadler in seinem lvappen in goldenem Schilde.
Ursprünglich Reichsadler ist der xreußische A., welcher den
Deutschen Rittern von Aaiser Friedrich II. verliehen wurde
und ihnen verblieb, als Siegmund den Doxxeladler für das
Reich einsührte. Lr erscheint rechtssehend, Schnabel, Fänge
und Arone golden, Zunge rot, mit goldencn Aleestengeln auf
den Flügeln und goldenem Namonszug R. auf der Brust.
Auch Brandenburg, posen, Schlesicn, Gstsriesland und viele
dcutsche Städte, besonders dio, in denen die deutschen Aaiser
des alten Reiches residirton oder gckrönt wurden, z. B.
Aachen, Franksnrt a. NI., Goslar, sühren den A. im lvappen
(Fig. -l—s>. vgl. Graf Stillfried-Alcantarä, Die Titel und
lvappen des preußischen Aönigshauses (Berl. j875). Sonst
sühren den A. noch das Aönigreich Polen (einen weißen
gekrönten A. in rotom Felde), die vereinigten Staaten von
Nordamerika (eincn dunkclbrauncn auffliegenden A., dcr in
der einen Alaue ein Bündel Pfeile, in der anöern einen
Glzweig hält und aus der Brust einen in zwei Felder (blau
und rot mit Silber) geteilten Schild trägt), lNeriko u. a.
Fig- g- Fig. s. jig. s.
S. die Tafeln »lvapxen«. In Frankreich wurde der A. durch
Naxoleon I. zum Symbol des Aaiserreichs erhoben, nach
seinem Sturz beseitigt, von Napoleon III. wieder hergestellt
nnd ;87v abermals entfernt. Diesor Napoleonische A. hatte
natürliche Gestalt, mit Blitzen in den Fängcn und zum Auf-
schwung bereit. Der A. ist auch das Zeichen der Fahnen
und Standarten der xreußischen, österreichischen und russischen
lseere und mehrerer Ritterorden.
* Line neue Nldöbeldekoratlon kommt in London in Aus-
nahme, wohin sie ans dem englischen Gstindien „eingewandert"
ist. Sie besteht, wie die lviener Bauindustrie-Zeitung berichtet,
aus viereckigen Glasprismen oder Linsatzstücken, die sazettirt
geschliffen sind nnö zusammengeseht allerhand Figuren bilden:
z. B. runde zwölfstrahlige Sterne, während der durch die Strahlen
nicht ausgefüllte Raum sich mit einem anderen Prisma zu einem
langgestrecktcn sechsstrahligen Storn vereinigt. Angenehm für
das Ange werden diese Mustcr durch eine Figur, welche den
Lindruck eines von oben gesehenen achteckig geschliffenen Ldel-
steins macht, während das ganze neuartig und zu gleicher Zeit
in sich harmonisch wirkt, durch seine blihenden Flächen aber
das im allgemeinen in ernstcn, dunklcn Farbentönen gehaltene
Nlöbelstück sehr angenehm und belebend unterbricht. Diese Art
dcr Nlöbclverzierung ist selbstverständlich noch nicht au-gebildet
und stößt begreiflicher lveiso auch vielfach auf lviderspruch.
Der Fachmann wird abor leicht einsehen, wie ausbildungsfähig
sie ist.
In Indien hat sich diese Glasmosaik Bahn gebrochen,
und die renommirtesten englischen Nlöbelzeichner benutzen sie
dort gern. Zur verschönerung von Spiegcln, Aamingesimsen,
Buffcts, Schränken und ähnlichen Möbelstücken, wie auch bei
lvindschirmen, spanischen lvänden usw. machen jene Glas-
prismen eine treffliche lvirkung bei verhältnismäßig geringen
Aosten. Natürlich kann jede Ieichnung in die Gläser einge-
schliffen werden, und man erreicht auch eigenartige lvirkungen,
indem man die kjinterflächcn dieser Mosaiken in versilberung
oder vergoldung erstrahlen läßt. Die dnrchschnittliche Dicke
der Glasxrismen bcträgt 2 cm, und die Gberflächen derselben
variiren je nach ihrem Zweck. Man kann diese Mosaik sehr
verschiedenartig anwenden, und wenn z. B. etwas in schräger
Richtung ein- oder aufgelegt, wirkt sie wie alte italienische
— 134 —