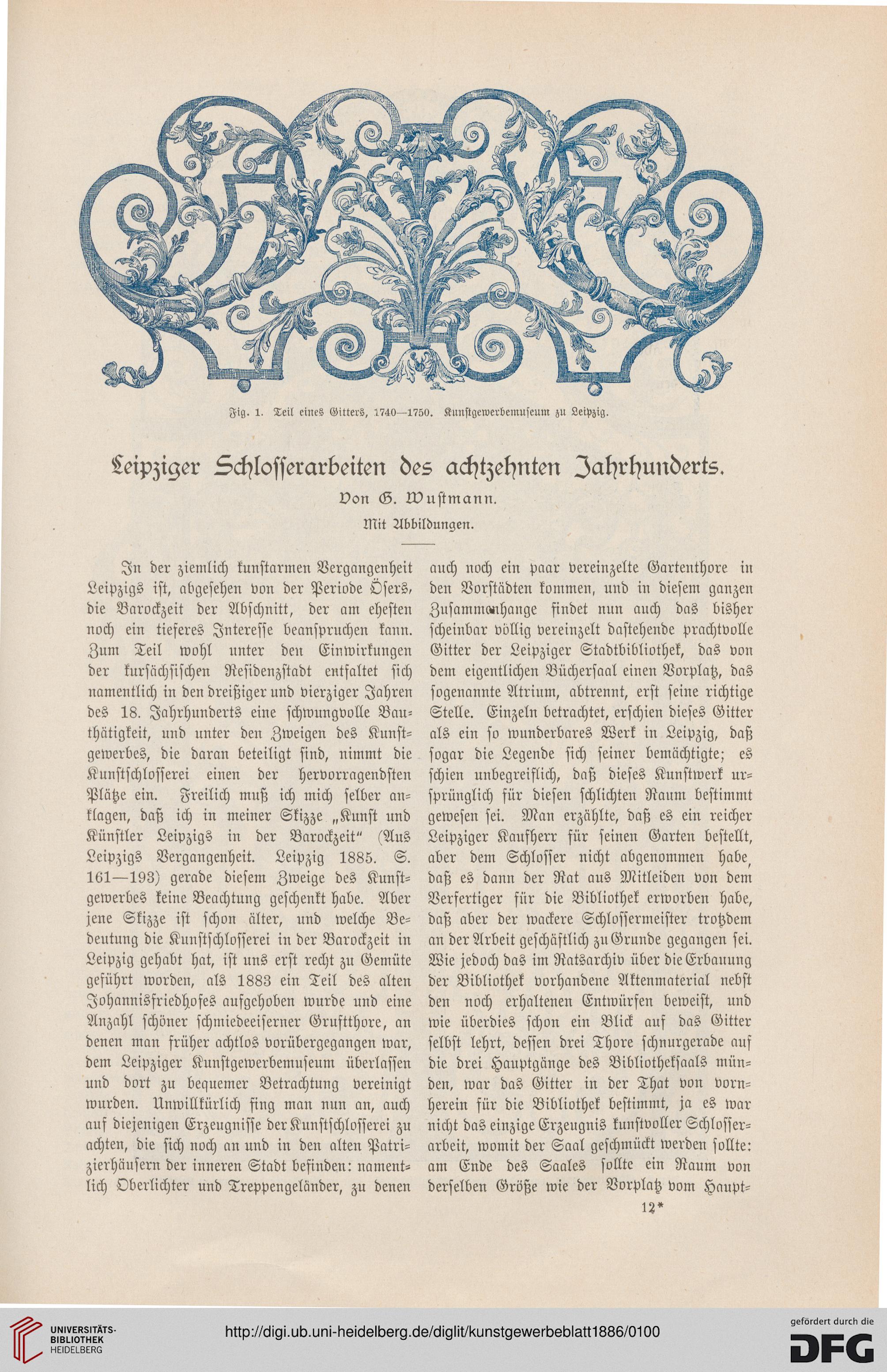Fig. 1. Teil eines Gitters, 1740—1750. Kmistgewerremuseum zu Leipzig.
Leipziger Schlosserarbeiten des achtzehnten Iabrbunderts.
Von G. N)ustmann.
Nit Abbildungen.
Jn der ziemlich kunstarmen Vergangenheit
Leipzigs ist, abgesehen von der Periode Ösers,
die Barockzeit der Abschnitt, der am ehesten
noch ein tieferes Jnteresse beanspruchen kann.
Zum Teil wohl nnter den Einwirkungen
der kursächsischen Residenzstadt entfaltet stch
namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren
des 18. Jahrhunderts eine schwungvolle Bau-
thätigkeit, und nnter den Zweigen des Knnst-
gewerbes, die daran beteiligt sind, nimmt die
Kunstschlosserei einen der hervorragendsten
Plätze ein. Freilich muß ich mich selber an-
klagen, daß ich in meiner Skizze „Kunst und
Künstler Leipzigs in der Barockzeit" (Aus
Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885. S.
161—193) gerade diesem Zweige des Kunst-
gewerbes keine Beachtung geschenkt habe. Aber
jene Skizze ist schon älter, und welche Be-
deutung die Kunstschlosserei in der Barockzeit in
Leipzig gehabt hat, ist uns erst recht zu Gemüte
geführt worden, als 1883 ein Teil des alten
Johannisfriedhofes aufgehoben wurde und eine
Anzahl schöner schmiedeeiserner Gruftthore, an
denen man früher achtlos vorübergegangen war,
dem Leipziger Kunstgewerbemuseum überlassen
und dort zu bequemer Betrachtung vereinigt
wurden. Unwillkürlich fing man nun an, auch
auf diejenigen Erzeugnisse der Kunftschlosserei zu
achten, die sich noch an und in den alten Patri-
zierhäusern der inneren Stadt befindeu: nament-
lich Oberlichter und Treppengeländer, zu denen
auch noch ein paar vereinzelte Gartenthore in
den Vorstädten kommen, und in diesem ganzen
Zusammimhange findet uun auch das bisher
scheinbar völlig vereinzelt dastehende prachtvolle
Gitter der Leipziger Stadtbibliothek, das vou
dem eigentlichen Büchersaal einen Vorplatz, das
sogenannte Atrium, abtrennt, erst seine richtige
Stelle. Einzeln betrachtet, erschien dieses Gitter
als ein so wunderbares Werk in Leipzig, daß
sogar die Legende fich seiner bemächtigte; es
schien unbegreiflich, daß dieses Kunstwerk ur-
sprünglich für diesen schlichten Raum bestimmt
gewesen sei. Man erzählte, daß es ein reicher
Leipziger Kaufherr für seineu Garten bestellt,
aber dem Schlosser nicht abgenommen habe
daß es danu der Rat aus Mitleideu von dem
Verfertiger für die Bibliothek erworben habe,
daß aber der wackere Schlossermeister trotzdem
an der Arbeit geschäftlich zuGrunde gegangen sei.
Wie jedoch das im Ratsarchiv über die Erbauung
der Bibliothek vorhandene Aktenmaterial nebst
den noch erhaltenen Eutwürfen beweist, und
wie überdies schon ein Blick auf das Gitter
selbst lehrt, dessen drei Thore schnurgerade auf
die drei Hauptgänge des Bibliotheksaals mün-
den, war das Gitter in der That von vorn-
herein für die Bibliothek bestimmt, ja es war
nicht das einzige Erzeugnis kunstvoller Schlosser-
arbeit, womit der Saal geschmückt werden sollte:
am Ende des Saales solltc ein Raum von
derselben Größe wie der Vorplatz vom Haupt-
Leipziger Schlosserarbeiten des achtzehnten Iabrbunderts.
Von G. N)ustmann.
Nit Abbildungen.
Jn der ziemlich kunstarmen Vergangenheit
Leipzigs ist, abgesehen von der Periode Ösers,
die Barockzeit der Abschnitt, der am ehesten
noch ein tieferes Jnteresse beanspruchen kann.
Zum Teil wohl nnter den Einwirkungen
der kursächsischen Residenzstadt entfaltet stch
namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren
des 18. Jahrhunderts eine schwungvolle Bau-
thätigkeit, und nnter den Zweigen des Knnst-
gewerbes, die daran beteiligt sind, nimmt die
Kunstschlosserei einen der hervorragendsten
Plätze ein. Freilich muß ich mich selber an-
klagen, daß ich in meiner Skizze „Kunst und
Künstler Leipzigs in der Barockzeit" (Aus
Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885. S.
161—193) gerade diesem Zweige des Kunst-
gewerbes keine Beachtung geschenkt habe. Aber
jene Skizze ist schon älter, und welche Be-
deutung die Kunstschlosserei in der Barockzeit in
Leipzig gehabt hat, ist uns erst recht zu Gemüte
geführt worden, als 1883 ein Teil des alten
Johannisfriedhofes aufgehoben wurde und eine
Anzahl schöner schmiedeeiserner Gruftthore, an
denen man früher achtlos vorübergegangen war,
dem Leipziger Kunstgewerbemuseum überlassen
und dort zu bequemer Betrachtung vereinigt
wurden. Unwillkürlich fing man nun an, auch
auf diejenigen Erzeugnisse der Kunftschlosserei zu
achten, die sich noch an und in den alten Patri-
zierhäusern der inneren Stadt befindeu: nament-
lich Oberlichter und Treppengeländer, zu denen
auch noch ein paar vereinzelte Gartenthore in
den Vorstädten kommen, und in diesem ganzen
Zusammimhange findet uun auch das bisher
scheinbar völlig vereinzelt dastehende prachtvolle
Gitter der Leipziger Stadtbibliothek, das vou
dem eigentlichen Büchersaal einen Vorplatz, das
sogenannte Atrium, abtrennt, erst seine richtige
Stelle. Einzeln betrachtet, erschien dieses Gitter
als ein so wunderbares Werk in Leipzig, daß
sogar die Legende fich seiner bemächtigte; es
schien unbegreiflich, daß dieses Kunstwerk ur-
sprünglich für diesen schlichten Raum bestimmt
gewesen sei. Man erzählte, daß es ein reicher
Leipziger Kaufherr für seineu Garten bestellt,
aber dem Schlosser nicht abgenommen habe
daß es danu der Rat aus Mitleideu von dem
Verfertiger für die Bibliothek erworben habe,
daß aber der wackere Schlossermeister trotzdem
an der Arbeit geschäftlich zuGrunde gegangen sei.
Wie jedoch das im Ratsarchiv über die Erbauung
der Bibliothek vorhandene Aktenmaterial nebst
den noch erhaltenen Eutwürfen beweist, und
wie überdies schon ein Blick auf das Gitter
selbst lehrt, dessen drei Thore schnurgerade auf
die drei Hauptgänge des Bibliotheksaals mün-
den, war das Gitter in der That von vorn-
herein für die Bibliothek bestimmt, ja es war
nicht das einzige Erzeugnis kunstvoller Schlosser-
arbeit, womit der Saal geschmückt werden sollte:
am Ende des Saales solltc ein Raum von
derselben Größe wie der Vorplatz vom Haupt-