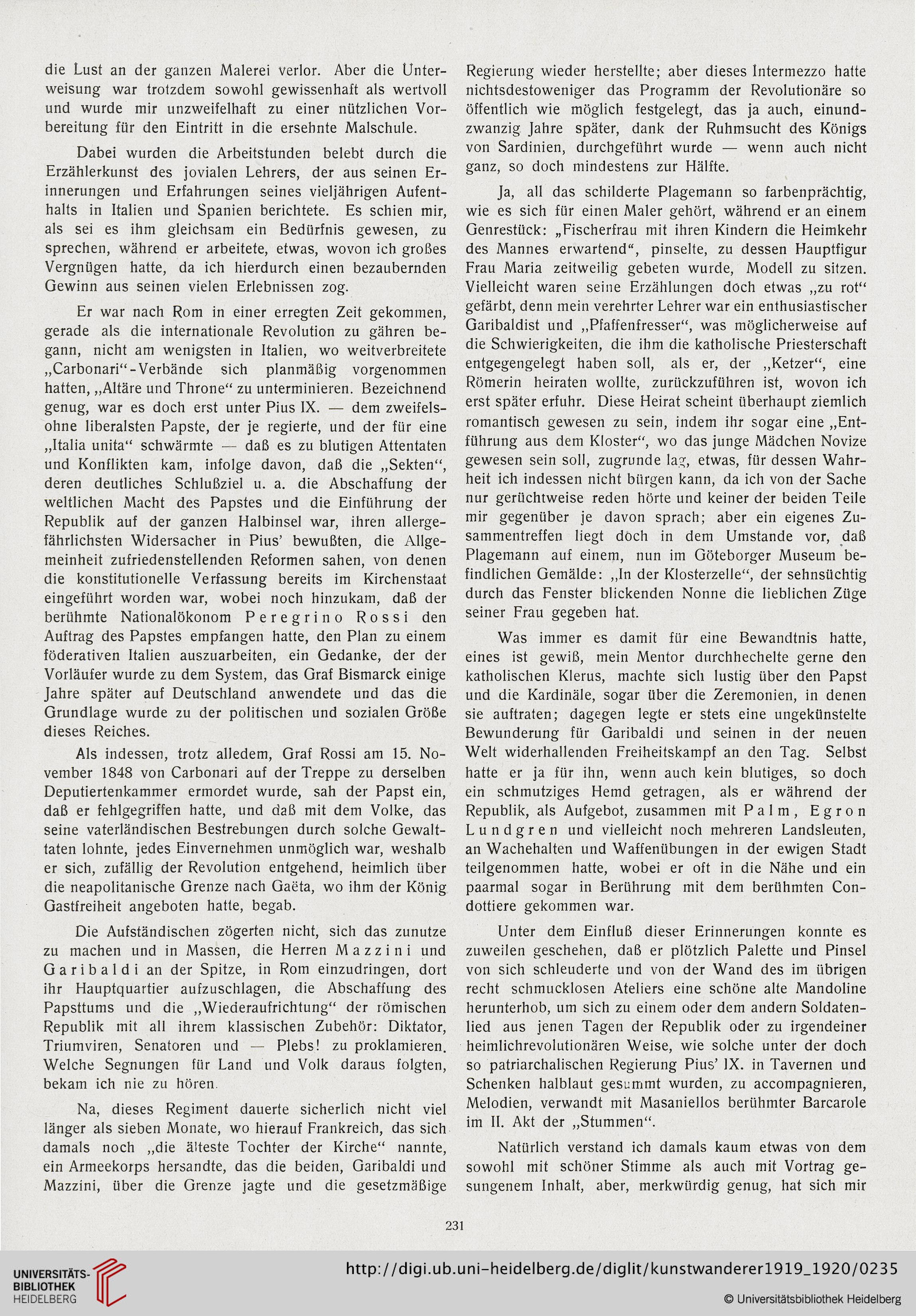die Lust an der ganzen Malerei verlor. Aber die Unter-
weisung war trotzdem sowohl gewissenhaft als wertvoll
und wurde mir unzweifelhaft zu einer nützlichen Vor-
bereitung für den Eintritt in die ersehnte Malschule.
Dabei wurden die Arbeitstunden belebt durch die
Erzählerkunst des jovialen Lehrers, der aus seinen Er-
innerungen und Erfahrungen seines vieljährigen Aufent-
halts in Italien und Spanien berichtete. Es schien mir,
als sei es ihm gleichsam ein Bedürfnis gewesen, zu
sprechen, während er arbeitete, etwas, wovon ich großes
Vergnügen hatte, da ich hierdurch einen bezaubernden
Gewinn aus seinen vielen Erlebnissen zog.
Er war nach Rom in einer erregten Zeit gekommen,
gerade als die internationale Revolution zu gähren be-
gann, nicht am wenigsten in Italien, wo weitverbreitete
„Carbonari“-Verbände sich planmäßig vorgenommen
hatten, „Altäre und Throne“ zu unterminieren. Bezeichnend
genug, war es doch erst unter Pius IX. — dem zweifels-
ohne liberalsten Papste, der je regierte, und der für eine
„Italia unita“ schwärmte — daß es zu blutigen Attentaten
und Konflikten kam, infolge davon, daß die „Sekten“,
deren deutliches Schlußziel u. a. die Abschaffung der
weltlichen Macht des Papstes und die Einführung der
Republik auf der ganzen Halbinsel war, ihren allerge-
fährlichsten Widersacher in Pius’ bewußten, die Allge-
meinheit zufriedenstellenden Reformen sahen, von denen
die konstitutionelle Verfassung bereits im Kirchenstaat
eingeführt worden war, wobei noch hinzukam, daß der
berühmte Nationalökonom Peregrino Rossi den
Auftrag des Papstes empfangen hatte, den Plan zu einem
föderativen Italien auszuarbeiten, ein Gedanke, der der
Vorläufer wurde zu dem System, das Graf Bismarck einige
Jahre später auf Deutschland anwendete und das die
Grundlage wurde zu der politischen und sozialen Größe
dieses Reiches.
Als indessen, trotz alledem, Graf Rossi am 15. No-
vember 1848 von Carbonari auf der Treppe zu derselben
Deputiertenkammer ermordet wurde, sah der Papst ein,
daß er fehlgegriffen hatte, und daß mit dem Volke, das
seine vaterländischen Bestrebungen durch solche Gewalt-
taten lohnte, jedes Einvernehmen unmöglich war, weshalb
er sich, zufällig der Revolution entgehend, heimlich über
die neapolitanische Grenze nach Gaeta, wo ihm der König
Gastfreiheit angeboten hatte, begab.
Die Aufständischen zögerten nicht, sich das zunutze
zu machen und in Massen, die Herren Mazzini und
Garibaldi an der Spitze, in Rom einzudringen, dort
ihr Hauptquartier aufzuschlagen, die Abschaffung des
Papsttums und die „Wiederaufrichtung“ der römischen
Republik mit all ihrem klassischen Zubehör: Diktator,
Triumviren, Senatoren und — Plebs! zu proklamieren.
Welche Segnungen für Land und Volk daraus folgten,
bekam ich nie zu hören
Na, dieses Regiment dauerte sicherlich nicht viel
länger als sieben Monate, wo hierauf Frankreich, das sich
damals noch „die älteste Tochter der Kirche“ nannte,
ein Armeekorps hersandte, das die beiden, Garibaldi und
Mazzini, über die Grenze jagte und die gesetzmäßige
Regierung wieder herstellte; aber dieses Intermezzo hatte
nichtsdestoweniger das Programm der Revolutionäre so
öffentlich wie möglich festgelegt, das ja auch, einund-
zwanzig Jahre später, dank der Ruhmsucht des Königs
von Sardinien, durchgeführt wurde — wenn auch nicht
ganz, so doch mindestens zur Hälfte.
Ja, all das schilderte Plagemann so farbenprächtig,
wie es sich für einen Maler gehört, während er an einem
Genrestück: „Fischerfrau mit ihren Kindern die Heimkehr
des Mannes erwartend“, pinselte, zu dessen Hauptfigur
Frau Maria zeitweilig gebeten wurde, Modell zu sitzen.
Vielleicht waren seine Erzählungen doch etwas „zu rot“
gefärbt, denn mein verehrter Lehrer war ein enthusiastischer
Garibaldist und „Pfaffenfresser“, was möglicherweise auf
die Schwierigkeiten, die ihm die katholische Priesterschaft
entgegengelegt haben soll, als er, der „Ketzer“, eine
Römerin heiraten wollte, zurückzuführen ist, wovon ich
erst später erfuhr. Diese Heirat scheint überhaupt ziemlich
romantisch gewesen zu sein, indem ihr sogar eine „Ent-
führung aus dem Kloster“, wo das junge Mädchen Novize
gewesen sein soll, zugrunde lag, etwas, für dessen Wahr-
heit ich indessen nicht bürgen kann, da ich von der Sache
nur gerüchtweise reden hörte und keiner der beiden Teile
mir gegenüber je davon sprach; aber ein eigenes Zu-
sammentreffen liegt doch in dem Umstande vor, daß
Plagemann auf einem, nun im Göteborger Museum be-
findlichen Gemälde: „In der Klosterzelle“, der sehnsüchtig
durch das Fenster blickenden Nonne die lieblichen Züge
seiner Frau gegeben hat.
Was immer es damit für eine Bewandtnis hatte,
eines ist gewiß, mein Mentor durchhechelte gerne den
katholischen Klerus, machte sich lustig über den Papst
und die Kardinäle, sogar über die Zeremonien, in denen
sie auftraten; dagegen legte er stets eine ungekünstelte
Bewunderung für Garibaldi und seinen in der neuen
Welt widerhallenden Freiheitskampf an den Tag. Selbst
hatte er ja für ihn, wenn auch kein blutiges, so doch
ein schmutziges Hemd getragen, als er während der
Republik, als Aufgebot, zusammen mit Palm, Egron
Lundgren und vielleicht noch mehreren Landsleuten,
an Wachehalten und Waffenübungen in der ewigen Stadt
teilgenommen hatte, wobei er oft in die Nähe und ein
paarmal sogar in Berührung mit dem berühmten Con-
dottiere gekommen war.
Unter dem Einfluß dieser Erinnerungen konnte es
zuweilen geschehen, daß er plötzlich Palette und Pinsel
von sich schleuderte und von der Wand des im übrigen
recht schmucklosen Ateliers eine schöne alte Mandoline
herunterhob, um sich zu einem oder dem andern Soldaten-
lied aus jenen Tagen der Republik oder zu irgendeiner
heimlichrevolutionären Weise, wie solche unter der doch
so patriarchalischen Regierung Pius’ IX. in Tavernen und
Schenken halblaut gesummt wurden, zu accompagnieren,
Melodien, verwandt mit Masaniellos berühmter Barcarole
im II. Akt der „Stummen“.
Natürlich verstand ich damals kaum etwas von dem
sowohl mit schöner Stimme als auch mit Vortrag ge-
sungenem Inhalt, aber, merkwürdig genug, hat sich mir
231
weisung war trotzdem sowohl gewissenhaft als wertvoll
und wurde mir unzweifelhaft zu einer nützlichen Vor-
bereitung für den Eintritt in die ersehnte Malschule.
Dabei wurden die Arbeitstunden belebt durch die
Erzählerkunst des jovialen Lehrers, der aus seinen Er-
innerungen und Erfahrungen seines vieljährigen Aufent-
halts in Italien und Spanien berichtete. Es schien mir,
als sei es ihm gleichsam ein Bedürfnis gewesen, zu
sprechen, während er arbeitete, etwas, wovon ich großes
Vergnügen hatte, da ich hierdurch einen bezaubernden
Gewinn aus seinen vielen Erlebnissen zog.
Er war nach Rom in einer erregten Zeit gekommen,
gerade als die internationale Revolution zu gähren be-
gann, nicht am wenigsten in Italien, wo weitverbreitete
„Carbonari“-Verbände sich planmäßig vorgenommen
hatten, „Altäre und Throne“ zu unterminieren. Bezeichnend
genug, war es doch erst unter Pius IX. — dem zweifels-
ohne liberalsten Papste, der je regierte, und der für eine
„Italia unita“ schwärmte — daß es zu blutigen Attentaten
und Konflikten kam, infolge davon, daß die „Sekten“,
deren deutliches Schlußziel u. a. die Abschaffung der
weltlichen Macht des Papstes und die Einführung der
Republik auf der ganzen Halbinsel war, ihren allerge-
fährlichsten Widersacher in Pius’ bewußten, die Allge-
meinheit zufriedenstellenden Reformen sahen, von denen
die konstitutionelle Verfassung bereits im Kirchenstaat
eingeführt worden war, wobei noch hinzukam, daß der
berühmte Nationalökonom Peregrino Rossi den
Auftrag des Papstes empfangen hatte, den Plan zu einem
föderativen Italien auszuarbeiten, ein Gedanke, der der
Vorläufer wurde zu dem System, das Graf Bismarck einige
Jahre später auf Deutschland anwendete und das die
Grundlage wurde zu der politischen und sozialen Größe
dieses Reiches.
Als indessen, trotz alledem, Graf Rossi am 15. No-
vember 1848 von Carbonari auf der Treppe zu derselben
Deputiertenkammer ermordet wurde, sah der Papst ein,
daß er fehlgegriffen hatte, und daß mit dem Volke, das
seine vaterländischen Bestrebungen durch solche Gewalt-
taten lohnte, jedes Einvernehmen unmöglich war, weshalb
er sich, zufällig der Revolution entgehend, heimlich über
die neapolitanische Grenze nach Gaeta, wo ihm der König
Gastfreiheit angeboten hatte, begab.
Die Aufständischen zögerten nicht, sich das zunutze
zu machen und in Massen, die Herren Mazzini und
Garibaldi an der Spitze, in Rom einzudringen, dort
ihr Hauptquartier aufzuschlagen, die Abschaffung des
Papsttums und die „Wiederaufrichtung“ der römischen
Republik mit all ihrem klassischen Zubehör: Diktator,
Triumviren, Senatoren und — Plebs! zu proklamieren.
Welche Segnungen für Land und Volk daraus folgten,
bekam ich nie zu hören
Na, dieses Regiment dauerte sicherlich nicht viel
länger als sieben Monate, wo hierauf Frankreich, das sich
damals noch „die älteste Tochter der Kirche“ nannte,
ein Armeekorps hersandte, das die beiden, Garibaldi und
Mazzini, über die Grenze jagte und die gesetzmäßige
Regierung wieder herstellte; aber dieses Intermezzo hatte
nichtsdestoweniger das Programm der Revolutionäre so
öffentlich wie möglich festgelegt, das ja auch, einund-
zwanzig Jahre später, dank der Ruhmsucht des Königs
von Sardinien, durchgeführt wurde — wenn auch nicht
ganz, so doch mindestens zur Hälfte.
Ja, all das schilderte Plagemann so farbenprächtig,
wie es sich für einen Maler gehört, während er an einem
Genrestück: „Fischerfrau mit ihren Kindern die Heimkehr
des Mannes erwartend“, pinselte, zu dessen Hauptfigur
Frau Maria zeitweilig gebeten wurde, Modell zu sitzen.
Vielleicht waren seine Erzählungen doch etwas „zu rot“
gefärbt, denn mein verehrter Lehrer war ein enthusiastischer
Garibaldist und „Pfaffenfresser“, was möglicherweise auf
die Schwierigkeiten, die ihm die katholische Priesterschaft
entgegengelegt haben soll, als er, der „Ketzer“, eine
Römerin heiraten wollte, zurückzuführen ist, wovon ich
erst später erfuhr. Diese Heirat scheint überhaupt ziemlich
romantisch gewesen zu sein, indem ihr sogar eine „Ent-
führung aus dem Kloster“, wo das junge Mädchen Novize
gewesen sein soll, zugrunde lag, etwas, für dessen Wahr-
heit ich indessen nicht bürgen kann, da ich von der Sache
nur gerüchtweise reden hörte und keiner der beiden Teile
mir gegenüber je davon sprach; aber ein eigenes Zu-
sammentreffen liegt doch in dem Umstande vor, daß
Plagemann auf einem, nun im Göteborger Museum be-
findlichen Gemälde: „In der Klosterzelle“, der sehnsüchtig
durch das Fenster blickenden Nonne die lieblichen Züge
seiner Frau gegeben hat.
Was immer es damit für eine Bewandtnis hatte,
eines ist gewiß, mein Mentor durchhechelte gerne den
katholischen Klerus, machte sich lustig über den Papst
und die Kardinäle, sogar über die Zeremonien, in denen
sie auftraten; dagegen legte er stets eine ungekünstelte
Bewunderung für Garibaldi und seinen in der neuen
Welt widerhallenden Freiheitskampf an den Tag. Selbst
hatte er ja für ihn, wenn auch kein blutiges, so doch
ein schmutziges Hemd getragen, als er während der
Republik, als Aufgebot, zusammen mit Palm, Egron
Lundgren und vielleicht noch mehreren Landsleuten,
an Wachehalten und Waffenübungen in der ewigen Stadt
teilgenommen hatte, wobei er oft in die Nähe und ein
paarmal sogar in Berührung mit dem berühmten Con-
dottiere gekommen war.
Unter dem Einfluß dieser Erinnerungen konnte es
zuweilen geschehen, daß er plötzlich Palette und Pinsel
von sich schleuderte und von der Wand des im übrigen
recht schmucklosen Ateliers eine schöne alte Mandoline
herunterhob, um sich zu einem oder dem andern Soldaten-
lied aus jenen Tagen der Republik oder zu irgendeiner
heimlichrevolutionären Weise, wie solche unter der doch
so patriarchalischen Regierung Pius’ IX. in Tavernen und
Schenken halblaut gesummt wurden, zu accompagnieren,
Melodien, verwandt mit Masaniellos berühmter Barcarole
im II. Akt der „Stummen“.
Natürlich verstand ich damals kaum etwas von dem
sowohl mit schöner Stimme als auch mit Vortrag ge-
sungenem Inhalt, aber, merkwürdig genug, hat sich mir
231