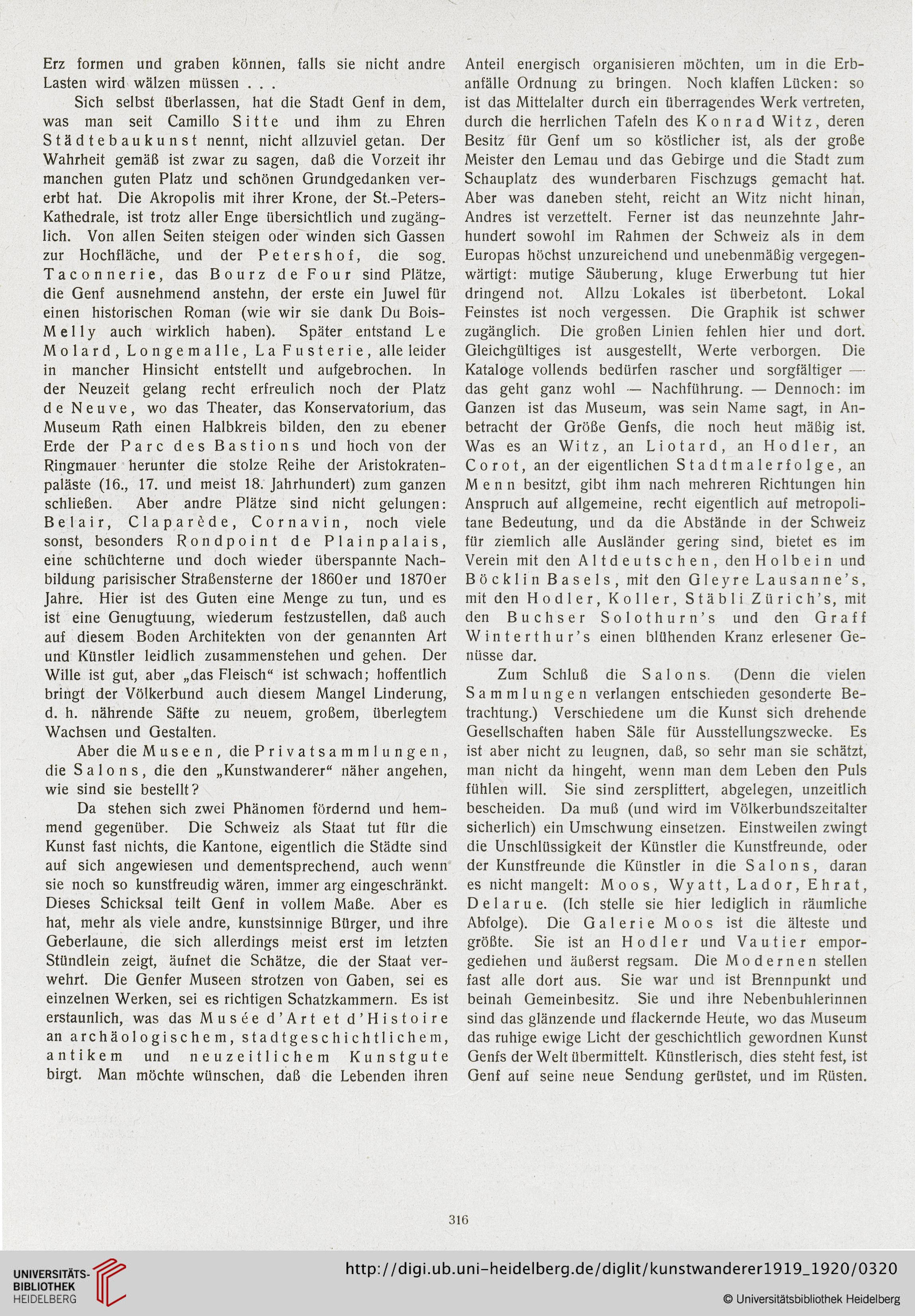Erz formen und graben können, falls sie nicht andre
Lasten wird wälzen müssen . . .
Sich selbst überlassen, hat die Stadt Genf in dem,
was man seit Camillo Sitte und ihm zu Ehren
Städtebaukunst nennt, nicht allzuviel getan. Der
Wahrheit gemäß ist zwar zu sagen, daß die Vorzeit ihr
manchen guten Platz und schönen Grundgedanken ver-
erbt hat. Die Akropolis mit ihrer Krone, der St.-Peters-
Kathedrale, ist trotz aller Enge übersichtlich und zugäng-
lich. Von allen Seiten steigen oder winden sich Gassen
zur Hochfläche, und der Petershof, die sog.
Taconnerie, das Bourz de Four sind Plätze,
die Genf ausnehmend anstehn, der erste ein Juwel für
einen historischen Roman (wie wir sie dank Du Bois-
M e 11 y auch wirklich haben). Später entstand L e
Molard, Longemalle, LaFusterie, alle leider
in mancher Hinsicht entstellt und aufgebrochen. In
der Neuzeit gelang recht erfreulich noch der Platz
de Neuve, wo das Theater, das Konservatorium, das
Museum Rath einen Halbkreis bilden, den zu ebener
Erde der Parc des Bastions und hoch von der
Ringmauer herunter die stolze Reihe der Aristokraten-
paläste (16., 17. und meist 18. Jahrhundert) zum ganzen
schließen. Aber andre Plätze sind nicht gelungen:
Beiair, Clapar£de, Cornavin, noch viele
sonst, besonders Rondpoint de Plainpalais,
eine schüchterne und doch wieder überspannte Nach-
bildung parisischer Straßensterne der 1860er und 1870er
Jahre. Hier ist des Guten eine Menge zu tun, und es
ist eine Genugtuung, wiederum festzustellen, daß auch
auf diesem Boden Architekten von der genannten Art
und Künstler leidlich zusammenstehen und gehen. Der
Wille ist gut, aber „das Fleisch“ ist schwach; hoffentlich
bringt der Völkerbund auch diesem Mangel Linderung,
d. h. nährende Säfte zu neuem, großem, überlegtem
Wachsen und Gestalten.
Aber die Museen, die Privatsammlungen,
die Salons, die den „Kunstwanderer“ näher angehen,
wie sind sie bestellt?
Da stehen sich zwei Phänomen fördernd und hem-
mend gegenüber. Die Schweiz als Staat tut für die
Kunst fast nichts, die Kantone, eigentlich die Städte sind
auf sich angewiesen und dementsprechend, auch wenn
sie noch so kunstfreudig wären, immer arg eingeschränkt.
Dieses Schicksal teilt Genf in vollem Maße. Aber es
hat, mehr als viele andre, kunstsinnige Bürger, und ihre
Geberlaune, die sich allerdings meist erst im letzten
Stündlein zeigt, äufnet die Schätze, die der Staat ver-
wehrt. Die Genfer Museen strotzen von Gaben, sei es
einzelnen Werken, sei es richtigen Schatzkammern. Es ist
erstaunlich, was das Musee d’Art et d’Histoire
an archäologischem, stadtgeschichtlichem,
antikem und neuzeitlichem Kunstgute
birgt. Man möchte wünschen, daß die Lebenden ihren
Anteil energisch organisieren möchten, um in die Erb-
anfälle Ordnung zu bringen. Noch klaffen Lücken: so
ist das Mittelalter durch ein überragendes Werk vertreten,
durch die herrlichen Tafeln des Konrad Witz, deren
Besitz für Genf um so köstlicher ist, als der große
Meister den Lemau und das Gebirge und die Stadt zum
Schauplatz des wunderbaren Fischzugs gemacht hat.
Aber was daneben steht, reicht an Witz nicht hinan,
Andres ist verzettelt. Ferner ist das neunzehnte Jahr-
hundert sowohl im Rahmen der Schweiz als in dem
Europas höchst unzureichend und unebenmäßig vergegen-
wärtigt: mutige Säuberung, kluge Erwerbung tut hier
dringend not. Allzu Lokales ist überbetont. Lokal
Feinstes ist noch vergessen. Die Graphik ist schwer
zugänglich. Die großen Linien fehlen hier und dort.
Gleichgültiges ist ausgestellt, Werte verborgen. Die
Kataloge vollends bedürfen rascher und sorgfältiger —
das geht ganz wohl — Nachführung. — Dennoch: im
Ganzen ist das Museum, was sein Name sagt, in An-
betracht der Größe Genfs, die noch heut mäßig ist.
Was es an Witz, an Liotard, an Hodler, an
Corot, an der eigentlichen Stadtmalerfolge, an
M e n n besitzt, gibt ihm nach mehreren Richtungen hin
Anspruch auf allgemeine, recht eigentlich auf metropoli-
tane Bedeutung, und da die Abstände in der Schweiz
für ziemlich alle Ausländer gering sind, bietet es im
Verein mit den Altdeutschen, den H o 1 b e i n und
Böcklin Basels, mit den Gleyre Lausanne’s,
mit den Hodler, Koller, Stäbli Zürich’s, mit
den Buchser Solothurn’s und den G r a f f
Winterthur’s einen blühenden Kranz erlesener Ge-
nüsse dar.
Zum Schluß die Salons. (Denn die vielen
Sammlungen verlangen entschieden gesonderte Be-
trachtung.) Verschiedene um die Kunst sich drehende
Gesellschaften haben Säle für Ausstellungszwecke. Es
ist aber nicht zu leugnen, daß, so sehr man sie schätzt,
man nicht da hingeht, wenn man dem Leben den Puls
fühlen will. Sie sind zersplittert, abgelegen, unzeitlich
bescheiden. Da muß (und wird im Völkerbundszeitalter
sicherlich) ein Umschwung einsetzen. Einstweilen zwingt
die Unschlüssigkeit der Künstler die Kunstfreunde, oder
der Kunstfreunde die Künstler in die Salons, daran
es nicht mangelt: Moos, Wyatt, Lador, Ehrat,
D e 1 a r u e. (Ich stelle sie hier lediglich in räumliche
Abfolge). Die G a 1 e r i e M o o s ist die älteste und
größte. Sie ist an Hodler und V a u t i e r empor-
gediehen und äußerst regsam. Die Modernen stellen
fast alle dort aus. Sie war und ist Brennpunkt und
beinah Gemeinbesitz. Sie und ihre Nebenbuhlerinnen
sind das glänzende und flackernde Heute, wo das Museum
das ruhige ewige Licht der geschichtlich gewordnen Kunst
Genfs der Welt übermittelt. Künstlerisch, dies steht fest, ist
Genf auf seine neue Sendung gerüstet, und im Rüsten.
316
Lasten wird wälzen müssen . . .
Sich selbst überlassen, hat die Stadt Genf in dem,
was man seit Camillo Sitte und ihm zu Ehren
Städtebaukunst nennt, nicht allzuviel getan. Der
Wahrheit gemäß ist zwar zu sagen, daß die Vorzeit ihr
manchen guten Platz und schönen Grundgedanken ver-
erbt hat. Die Akropolis mit ihrer Krone, der St.-Peters-
Kathedrale, ist trotz aller Enge übersichtlich und zugäng-
lich. Von allen Seiten steigen oder winden sich Gassen
zur Hochfläche, und der Petershof, die sog.
Taconnerie, das Bourz de Four sind Plätze,
die Genf ausnehmend anstehn, der erste ein Juwel für
einen historischen Roman (wie wir sie dank Du Bois-
M e 11 y auch wirklich haben). Später entstand L e
Molard, Longemalle, LaFusterie, alle leider
in mancher Hinsicht entstellt und aufgebrochen. In
der Neuzeit gelang recht erfreulich noch der Platz
de Neuve, wo das Theater, das Konservatorium, das
Museum Rath einen Halbkreis bilden, den zu ebener
Erde der Parc des Bastions und hoch von der
Ringmauer herunter die stolze Reihe der Aristokraten-
paläste (16., 17. und meist 18. Jahrhundert) zum ganzen
schließen. Aber andre Plätze sind nicht gelungen:
Beiair, Clapar£de, Cornavin, noch viele
sonst, besonders Rondpoint de Plainpalais,
eine schüchterne und doch wieder überspannte Nach-
bildung parisischer Straßensterne der 1860er und 1870er
Jahre. Hier ist des Guten eine Menge zu tun, und es
ist eine Genugtuung, wiederum festzustellen, daß auch
auf diesem Boden Architekten von der genannten Art
und Künstler leidlich zusammenstehen und gehen. Der
Wille ist gut, aber „das Fleisch“ ist schwach; hoffentlich
bringt der Völkerbund auch diesem Mangel Linderung,
d. h. nährende Säfte zu neuem, großem, überlegtem
Wachsen und Gestalten.
Aber die Museen, die Privatsammlungen,
die Salons, die den „Kunstwanderer“ näher angehen,
wie sind sie bestellt?
Da stehen sich zwei Phänomen fördernd und hem-
mend gegenüber. Die Schweiz als Staat tut für die
Kunst fast nichts, die Kantone, eigentlich die Städte sind
auf sich angewiesen und dementsprechend, auch wenn
sie noch so kunstfreudig wären, immer arg eingeschränkt.
Dieses Schicksal teilt Genf in vollem Maße. Aber es
hat, mehr als viele andre, kunstsinnige Bürger, und ihre
Geberlaune, die sich allerdings meist erst im letzten
Stündlein zeigt, äufnet die Schätze, die der Staat ver-
wehrt. Die Genfer Museen strotzen von Gaben, sei es
einzelnen Werken, sei es richtigen Schatzkammern. Es ist
erstaunlich, was das Musee d’Art et d’Histoire
an archäologischem, stadtgeschichtlichem,
antikem und neuzeitlichem Kunstgute
birgt. Man möchte wünschen, daß die Lebenden ihren
Anteil energisch organisieren möchten, um in die Erb-
anfälle Ordnung zu bringen. Noch klaffen Lücken: so
ist das Mittelalter durch ein überragendes Werk vertreten,
durch die herrlichen Tafeln des Konrad Witz, deren
Besitz für Genf um so köstlicher ist, als der große
Meister den Lemau und das Gebirge und die Stadt zum
Schauplatz des wunderbaren Fischzugs gemacht hat.
Aber was daneben steht, reicht an Witz nicht hinan,
Andres ist verzettelt. Ferner ist das neunzehnte Jahr-
hundert sowohl im Rahmen der Schweiz als in dem
Europas höchst unzureichend und unebenmäßig vergegen-
wärtigt: mutige Säuberung, kluge Erwerbung tut hier
dringend not. Allzu Lokales ist überbetont. Lokal
Feinstes ist noch vergessen. Die Graphik ist schwer
zugänglich. Die großen Linien fehlen hier und dort.
Gleichgültiges ist ausgestellt, Werte verborgen. Die
Kataloge vollends bedürfen rascher und sorgfältiger —
das geht ganz wohl — Nachführung. — Dennoch: im
Ganzen ist das Museum, was sein Name sagt, in An-
betracht der Größe Genfs, die noch heut mäßig ist.
Was es an Witz, an Liotard, an Hodler, an
Corot, an der eigentlichen Stadtmalerfolge, an
M e n n besitzt, gibt ihm nach mehreren Richtungen hin
Anspruch auf allgemeine, recht eigentlich auf metropoli-
tane Bedeutung, und da die Abstände in der Schweiz
für ziemlich alle Ausländer gering sind, bietet es im
Verein mit den Altdeutschen, den H o 1 b e i n und
Böcklin Basels, mit den Gleyre Lausanne’s,
mit den Hodler, Koller, Stäbli Zürich’s, mit
den Buchser Solothurn’s und den G r a f f
Winterthur’s einen blühenden Kranz erlesener Ge-
nüsse dar.
Zum Schluß die Salons. (Denn die vielen
Sammlungen verlangen entschieden gesonderte Be-
trachtung.) Verschiedene um die Kunst sich drehende
Gesellschaften haben Säle für Ausstellungszwecke. Es
ist aber nicht zu leugnen, daß, so sehr man sie schätzt,
man nicht da hingeht, wenn man dem Leben den Puls
fühlen will. Sie sind zersplittert, abgelegen, unzeitlich
bescheiden. Da muß (und wird im Völkerbundszeitalter
sicherlich) ein Umschwung einsetzen. Einstweilen zwingt
die Unschlüssigkeit der Künstler die Kunstfreunde, oder
der Kunstfreunde die Künstler in die Salons, daran
es nicht mangelt: Moos, Wyatt, Lador, Ehrat,
D e 1 a r u e. (Ich stelle sie hier lediglich in räumliche
Abfolge). Die G a 1 e r i e M o o s ist die älteste und
größte. Sie ist an Hodler und V a u t i e r empor-
gediehen und äußerst regsam. Die Modernen stellen
fast alle dort aus. Sie war und ist Brennpunkt und
beinah Gemeinbesitz. Sie und ihre Nebenbuhlerinnen
sind das glänzende und flackernde Heute, wo das Museum
das ruhige ewige Licht der geschichtlich gewordnen Kunst
Genfs der Welt übermittelt. Künstlerisch, dies steht fest, ist
Genf auf seine neue Sendung gerüstet, und im Rüsten.
316