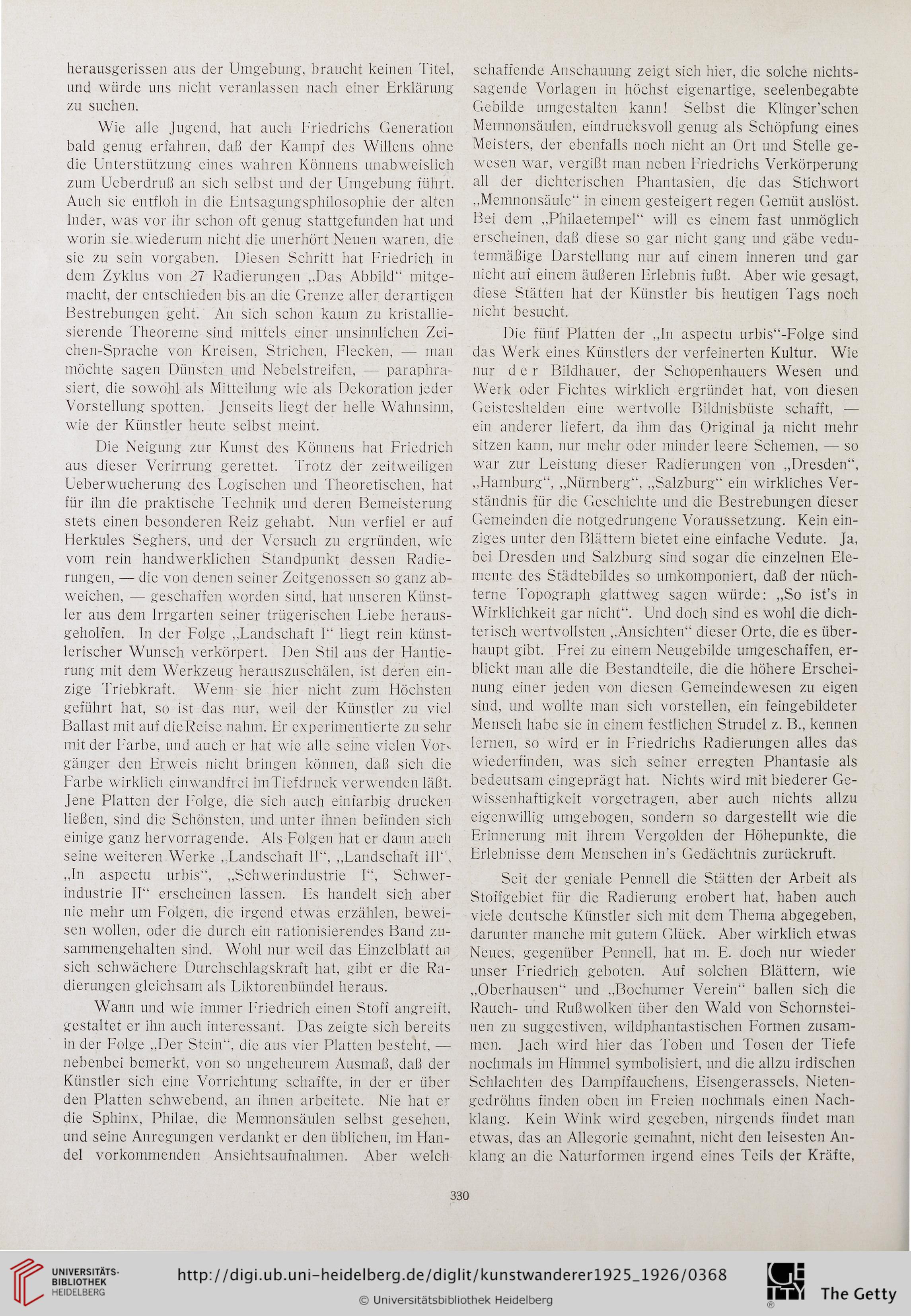herausgerissen aus der Umgebung, braucht keinen Titel,
und würde uns nicht veranlassen nach einer Erklärung
zu suchen.
Wie alle Jugend, hat auch Friedrichs Generation
bald genug erfahren, daß der Kampf des Willens ohne
die Unterstützung eines wahren Könnens unabweislich
zum Ueberdruß an sich selbst und der Umgebung führt.
Auch sie entfloh in die Entsagungsphilosophie der alten
inder, was vor ihr schon oft genug stattgefunden hat und
worin sie wiederum nicht die unerhört Neuen waren, die
sie zu sein vorgaben. Diesen Schritt hat Friedrich in
dem Zyklus von 27 Radierungen ,,Das Abbild“ mitge-
macht, der entschieden bis an die Grenze aller derartigen
Bestrebungen geht. An sicli schon kaum zu kristallie-
sierende Theoreme sind inittels einer unsinnlichen Zei-
chen-Sprache von Kreisen, Strichen, Flecken, — man
möclite sagen Dünsten und Nebelstreifen, — paraphra-
siert, die sowohl als Mitteilung wie als Dekoration jeder
Vorstellung spotten. Jenseits liegt der helle Wahnsinn,
wie der Künstler heute selbst meint.
Die Neigung zur Kunst des Könnens hat Friedrich
aus dieser Verirrung gerettet. Trotz der zeitweiligen
Ueberwucherung des Fogischen und Theoretischen, hat
für ihn die praktische Technik und deren Bemeisterung
stets einen besonderen Reiz gehabt. Nun verfiel er auf
Herkules Seghers, und der Versuch zu ergründen, wie
vom rein handwerklichen Standpunkt dessen Radie-
rungen, — die von denen seiner Zeitgenossen so ganz ab-
weichen, — geschaffen worden sind, hat unseren Künst-
ler aus dem Irrgarten seiner trügerischen Fiebe heraus-
geholfen. In der Folge ,,Fandschaft I“ liegt rein künst-
lerischer Wunsch verkörpert. Den Stil aus der Hantie-
rung mit dem Werkzeug herauszuschälen, ist deren ein-
zige Triebkraft. Wenn sie hier nicht zum Höchsten
geführt hat, so ist das nur, weil der Künstler zu viel
Ballast mit auf dieReise nahm. Er experimentierte zu sehr
mit der Farbe, und auch er hat wie alle seine vielen Vorv
gänger den Erweis nicht bringen können, daß sich die
Farbe wirklich einwandfrei imTiefdruck verwenden läßt.
Jene Platten der Folge, die sich auch einfarbig drucken
ließen, sind die Schönsten, und unter ihnen befinden sich
einige ganz hervorragende. Als Folgen hat er dann aucli
seine weiteren Werke „Fandschaft II“, ,,Fandschaft III“,
„In aspectu urbis“, „Schwerindustrie I“, Schwer-
industrie II“ erscheinen lassen. Es handelt sich aber
nie mehr um Folgen, die irgend etwas erzählen, bewei-
sen wollen, oder die durch ein rationisierendes Band zu-
sammengehalten sind. Wohl nur weil das Einzelblatt an
sich schwächere Durchschlagskraft hat, gibt er die Ra-
dierungen gleichsam als Fiktorenbündel heraus.
Wann und wie immer Friedrich einen Stoff angreift.
gestaltet er ihn auch interessant. Das zeigte sich bereits
in der Folge „Der Stein“, die aus vier Platten besteht, —
nebenbei bemerkt, von so ungeheurem Ausmaß, daß der
Künstler sich eine Vorrichtung schaffte, in der er über
den Platten schwebend, an ihnen arbeitete. Nie hat er
die Sphinx, Philae, die Memnonsäulen selbst gesehcn,
und seine Anregungen verdankt er den iiblichen, im Han-
del vorkommenden Ansichtsaufnahmen. Aber welch
schaffende Anschauung zeigt sich hier, die solche nichts-
sagende Vorlagen in höchst eigenartige, seelenbegabte
Gebilde umgestalten kann! Selbst die Klinger’schen
Memnonsäulen, eindrucksvoll genug als Schöpfung eines
Meisters, der ebenfalls noch nicht an Ort und Stelle ge-
wesen war, vergißt man neben Friedrichs Verkörperung
all der dichterischen Phantasien, die das Stichwort
„Memnonsäule“ in einem gesteigert regen Gemüt auslöst.
Bei dem „Philaetempel“ will es einem fast unmöglich
erscheinen, daß diese so gar nicht gang und gäbe vedu-
tenmäßige Darstellung nur auf einem inneren und gar
nicht auf einem äußeren Erlebnis fußt. Aber wie gesagt,
diese Stätten hat der Künstler bis heutigen Tags noch
nicht besucht.
Die fünf Platten der „In aspectu urbis“-Folge sind
das Werk eines Künstlers der verfeinerten Kultur. Wie
nur d e r Bildhauer, der Schopenhauers Wesen und
Werk oder Fichtes wirklich ergründet hat, von diesen
Geisteshelden eine wertvolle Bildnisbüste schafft, —
ein anderer liefert, da ihm das Original ja nicht mehr
sitzen kann, nur mehr oder minder leere Schemen, — so
war zur Feistung dieser Radierungen von „Dresden“,
„Hamburg“, „Nürnberg“, „Salzburg“ ein wirkliches Ver-
ständnis für die Geschichte und die Bestrebungen dieser
Gemeinden die notgedrungene Voraussetzung. Kein ein-
ziges unter den Blättern bietet eine einfache Vedute. Ja,
bei Dresden und Salzburg sind sogar die einzelnen Ele-
mente des Städtebildes so umkomponiert, daß der nüch-
terne Topograph glattweg sagen würde: „So ist’s in
Wirklichkeit gar nicht“. Und doch sind es wohl die dich-
terisch wertvollsten „Ansichten“ dieser Orte, die es über-
haupt gibt. Frei zu einem Neugebilde umgeschaffen, er-
blickt man alle die Bestandteile, die die höhere Erschei-
nung einer jeden von diesen Gemeindewesen zu eigen
sind, und wollte man sich vorstellen, ein feingebildeter
Mensch habe sie in einem festlichen Strudel z. B„ kennen
lernen, so wird er in Friedrichs Radierungen alles das
wiederfinden, was sich seiner erregten Phantasie als
bedeutsam eingeprägt hat. Nichts wird mit biederer Ge-
wissenhaftigkeit vorgetragen, aber auch nichts allzu
eigenwillig umgebogen, sondern so dargestellt wie die
Erinnerung mit ihrem Vergolden der Höhepunkte, die
Erlebnisse dem Menschen in’s Gedächtnis zurückruft.
Seit der geniale Pennell die Stätten der Arbeit als
Stoffgebiet für die Radierung erobert hat, haben auch
viele deutsche Künstler sich mit dem Thema abgegeben,
darunter manche mit gutem Glück. Aber wirklich etwas
Neues, gegenüber Pennell, hat m. E. doch nur wieder
unser Friedrich geboten. Auf solchen Blättern, wie
„Oberhausen“ und „Bochumer Verein“ ballen sich die
Rauch- und Rußwolken über den Wald von Schornstei-
nen zu suggestiven, wildphantastischen Formen zusam-
men. Jach wird hier das Toben und Tosen der Tiefe
nochmals im Himmel symbolisiert, und die allzu irdischen
Schlachten des Dampffauchens, Eisengerassels, Nieten-
gedröhns finden oben im Freien nochmals einen Nach-
klang. Kein Wink wird gegeben, nirgends findet man
etwas, das an Allegorie gemahnt, nicht den leisesten An-
klang an die Naturformen irgend eines Teils der Kräfte,
330
und würde uns nicht veranlassen nach einer Erklärung
zu suchen.
Wie alle Jugend, hat auch Friedrichs Generation
bald genug erfahren, daß der Kampf des Willens ohne
die Unterstützung eines wahren Könnens unabweislich
zum Ueberdruß an sich selbst und der Umgebung führt.
Auch sie entfloh in die Entsagungsphilosophie der alten
inder, was vor ihr schon oft genug stattgefunden hat und
worin sie wiederum nicht die unerhört Neuen waren, die
sie zu sein vorgaben. Diesen Schritt hat Friedrich in
dem Zyklus von 27 Radierungen ,,Das Abbild“ mitge-
macht, der entschieden bis an die Grenze aller derartigen
Bestrebungen geht. An sicli schon kaum zu kristallie-
sierende Theoreme sind inittels einer unsinnlichen Zei-
chen-Sprache von Kreisen, Strichen, Flecken, — man
möclite sagen Dünsten und Nebelstreifen, — paraphra-
siert, die sowohl als Mitteilung wie als Dekoration jeder
Vorstellung spotten. Jenseits liegt der helle Wahnsinn,
wie der Künstler heute selbst meint.
Die Neigung zur Kunst des Könnens hat Friedrich
aus dieser Verirrung gerettet. Trotz der zeitweiligen
Ueberwucherung des Fogischen und Theoretischen, hat
für ihn die praktische Technik und deren Bemeisterung
stets einen besonderen Reiz gehabt. Nun verfiel er auf
Herkules Seghers, und der Versuch zu ergründen, wie
vom rein handwerklichen Standpunkt dessen Radie-
rungen, — die von denen seiner Zeitgenossen so ganz ab-
weichen, — geschaffen worden sind, hat unseren Künst-
ler aus dem Irrgarten seiner trügerischen Fiebe heraus-
geholfen. In der Folge ,,Fandschaft I“ liegt rein künst-
lerischer Wunsch verkörpert. Den Stil aus der Hantie-
rung mit dem Werkzeug herauszuschälen, ist deren ein-
zige Triebkraft. Wenn sie hier nicht zum Höchsten
geführt hat, so ist das nur, weil der Künstler zu viel
Ballast mit auf dieReise nahm. Er experimentierte zu sehr
mit der Farbe, und auch er hat wie alle seine vielen Vorv
gänger den Erweis nicht bringen können, daß sich die
Farbe wirklich einwandfrei imTiefdruck verwenden läßt.
Jene Platten der Folge, die sich auch einfarbig drucken
ließen, sind die Schönsten, und unter ihnen befinden sich
einige ganz hervorragende. Als Folgen hat er dann aucli
seine weiteren Werke „Fandschaft II“, ,,Fandschaft III“,
„In aspectu urbis“, „Schwerindustrie I“, Schwer-
industrie II“ erscheinen lassen. Es handelt sich aber
nie mehr um Folgen, die irgend etwas erzählen, bewei-
sen wollen, oder die durch ein rationisierendes Band zu-
sammengehalten sind. Wohl nur weil das Einzelblatt an
sich schwächere Durchschlagskraft hat, gibt er die Ra-
dierungen gleichsam als Fiktorenbündel heraus.
Wann und wie immer Friedrich einen Stoff angreift.
gestaltet er ihn auch interessant. Das zeigte sich bereits
in der Folge „Der Stein“, die aus vier Platten besteht, —
nebenbei bemerkt, von so ungeheurem Ausmaß, daß der
Künstler sich eine Vorrichtung schaffte, in der er über
den Platten schwebend, an ihnen arbeitete. Nie hat er
die Sphinx, Philae, die Memnonsäulen selbst gesehcn,
und seine Anregungen verdankt er den iiblichen, im Han-
del vorkommenden Ansichtsaufnahmen. Aber welch
schaffende Anschauung zeigt sich hier, die solche nichts-
sagende Vorlagen in höchst eigenartige, seelenbegabte
Gebilde umgestalten kann! Selbst die Klinger’schen
Memnonsäulen, eindrucksvoll genug als Schöpfung eines
Meisters, der ebenfalls noch nicht an Ort und Stelle ge-
wesen war, vergißt man neben Friedrichs Verkörperung
all der dichterischen Phantasien, die das Stichwort
„Memnonsäule“ in einem gesteigert regen Gemüt auslöst.
Bei dem „Philaetempel“ will es einem fast unmöglich
erscheinen, daß diese so gar nicht gang und gäbe vedu-
tenmäßige Darstellung nur auf einem inneren und gar
nicht auf einem äußeren Erlebnis fußt. Aber wie gesagt,
diese Stätten hat der Künstler bis heutigen Tags noch
nicht besucht.
Die fünf Platten der „In aspectu urbis“-Folge sind
das Werk eines Künstlers der verfeinerten Kultur. Wie
nur d e r Bildhauer, der Schopenhauers Wesen und
Werk oder Fichtes wirklich ergründet hat, von diesen
Geisteshelden eine wertvolle Bildnisbüste schafft, —
ein anderer liefert, da ihm das Original ja nicht mehr
sitzen kann, nur mehr oder minder leere Schemen, — so
war zur Feistung dieser Radierungen von „Dresden“,
„Hamburg“, „Nürnberg“, „Salzburg“ ein wirkliches Ver-
ständnis für die Geschichte und die Bestrebungen dieser
Gemeinden die notgedrungene Voraussetzung. Kein ein-
ziges unter den Blättern bietet eine einfache Vedute. Ja,
bei Dresden und Salzburg sind sogar die einzelnen Ele-
mente des Städtebildes so umkomponiert, daß der nüch-
terne Topograph glattweg sagen würde: „So ist’s in
Wirklichkeit gar nicht“. Und doch sind es wohl die dich-
terisch wertvollsten „Ansichten“ dieser Orte, die es über-
haupt gibt. Frei zu einem Neugebilde umgeschaffen, er-
blickt man alle die Bestandteile, die die höhere Erschei-
nung einer jeden von diesen Gemeindewesen zu eigen
sind, und wollte man sich vorstellen, ein feingebildeter
Mensch habe sie in einem festlichen Strudel z. B„ kennen
lernen, so wird er in Friedrichs Radierungen alles das
wiederfinden, was sich seiner erregten Phantasie als
bedeutsam eingeprägt hat. Nichts wird mit biederer Ge-
wissenhaftigkeit vorgetragen, aber auch nichts allzu
eigenwillig umgebogen, sondern so dargestellt wie die
Erinnerung mit ihrem Vergolden der Höhepunkte, die
Erlebnisse dem Menschen in’s Gedächtnis zurückruft.
Seit der geniale Pennell die Stätten der Arbeit als
Stoffgebiet für die Radierung erobert hat, haben auch
viele deutsche Künstler sich mit dem Thema abgegeben,
darunter manche mit gutem Glück. Aber wirklich etwas
Neues, gegenüber Pennell, hat m. E. doch nur wieder
unser Friedrich geboten. Auf solchen Blättern, wie
„Oberhausen“ und „Bochumer Verein“ ballen sich die
Rauch- und Rußwolken über den Wald von Schornstei-
nen zu suggestiven, wildphantastischen Formen zusam-
men. Jach wird hier das Toben und Tosen der Tiefe
nochmals im Himmel symbolisiert, und die allzu irdischen
Schlachten des Dampffauchens, Eisengerassels, Nieten-
gedröhns finden oben im Freien nochmals einen Nach-
klang. Kein Wink wird gegeben, nirgends findet man
etwas, das an Allegorie gemahnt, nicht den leisesten An-
klang an die Naturformen irgend eines Teils der Kräfte,
330