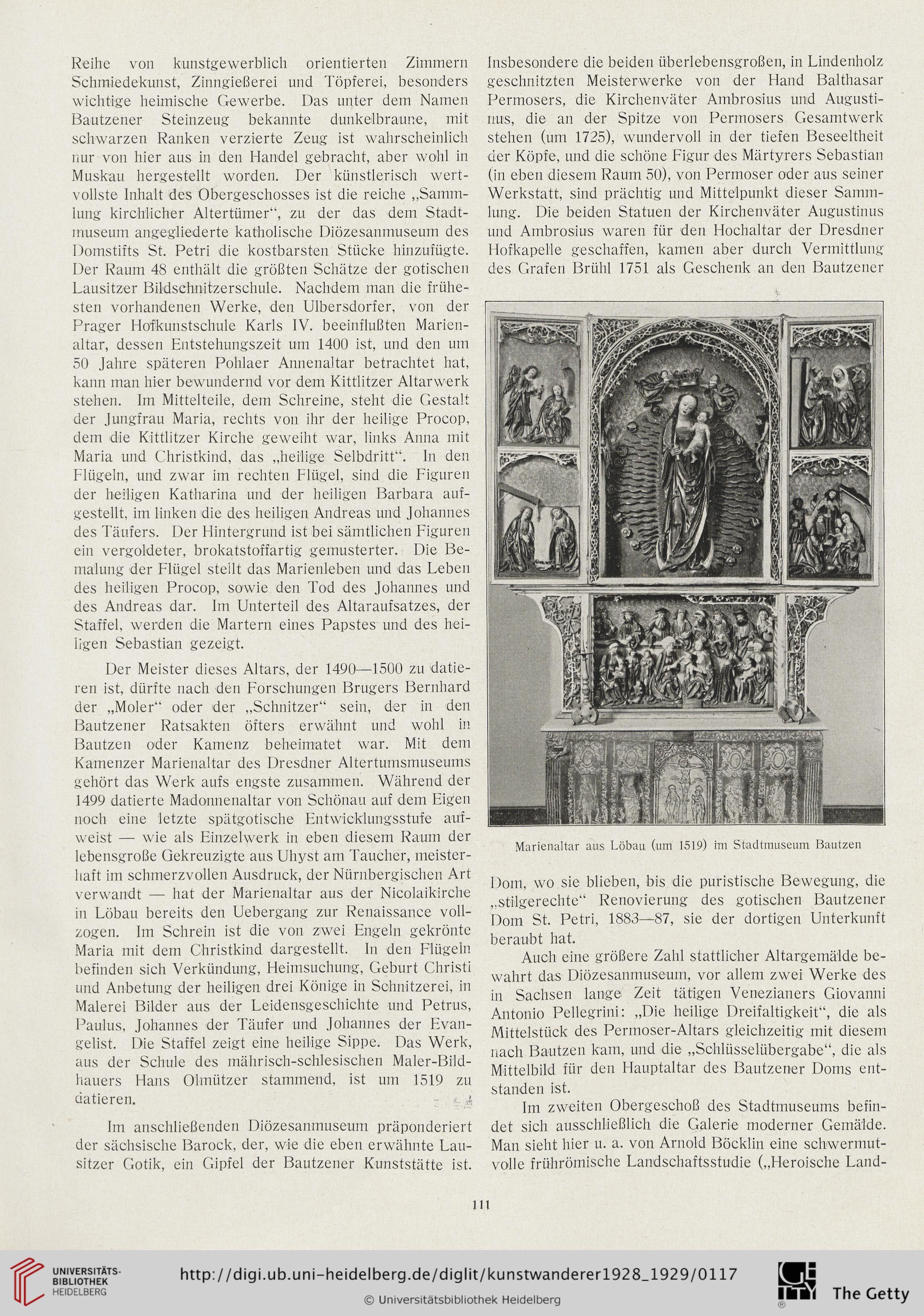Reihe von kunstgewerblich orientierten Zimmern
Schmiedekunst, Zinngießerei und Töpferei, besonders
wichtige heimische Gewerbe. Das unter dem Namen
Bautzener Steinzeug bekannte dunkelbraune, mit
schwarzen Ranken verzierte Zeug ist wahrscheinlich
nur von hier aus in den Handel gebracht, aber wohl in
Muskau hergestellt worden. Der künstlerisch wert-
vollste Inhalt des Obergeschosses ist die reiche „Samm-
lung kirchlicher Altertümer“, zu der das dem Stadt-
museum angegliederte katholische Diözesamnuseum des
Domstifts St. Petri die kostbarsten Stücke hinzufiigte.
Der Raum 48 enthält die größten Schätze der gotischen
Lausitzer Bildschnitzerschule. Nachdem man die frühe-
sten vorhandenen Werke, den Ulbersdorfer, von der
Prager Hofkunstschule Karls IV. beeinflußten Marien-
altar, dessen Entstehungszeit um 1400 ist, und den um
50 Jahre späteren Pohlaer Annenaltar betrachtet hat,
kann man hier bewundernd vor dem Kittlitzer Altarwerk
stehen. Im Mittelteile, dem Schreine, steht die Gestalt
der Jungfrau Maria, rechts von ihr der heilige Procop,
dem die Kittlitzer Kirche geweiht war, links Anna mit
Maria und Christkind, das „heilige Selbdritt“. In den
Flügeln, und zwar im rechten Flügel, sind die Figuren
der heiligen Katharina und der heiligen Barbara auf-
gestellt, im linkendie des hciligen Andreas und Johannes
des Täufers. Der Hintergrund ist bei sämtlichen Figuren
ein vergoldeter, brokatstoffartig gemusterter. Die Be-
maiung der Flügel stellt das Marienleben und das Leben
des heiligen Procop, sowie den Tod des Johannes und
des Andreas dar. Im Unterteil des Altaraufsatzes, der
Staffel, werden die Martern eines Papstes und des hei-
iigeri Sebastian gezeigt.
Der Meister dieses Altars, der 1490—1500 zu datie-
ren ist, dürfte nach den Forsciiungen Brugers Bernhard
der „Moler“ oder der „Schnitzer“ sein, der in den
Bautzener Ratsakten öfters erwähnt und wohl in
Bautzen oder Kamenz beheimatet war. Mit dem
Kamenzer Marienaltar des Dresdner Altertumsmuseums
gehört das Werk aufs engste zusammen. Während der
1499 datierte Madonnenaltar von Schönau auf dem Eigen
noch eine letzte spätgotisehe Entwicklungsstufe au'f-
weist — wie als Einzelwerk in eben diesem Raum der
lebensgroße Gekreuzigte aus Uhyst am Taucher, meister-
liaft im schmerzvollen Ausdruck, der Nürnbergischen Art
verwandt — hat der Marienaltar aus der Nicolaikirche
in Löbau bereits den Uebergang zur Renaissance voli-
zogen. Im Schrein ist die von zwei Engeln gekrönte
Maria mit dem Christkind dargestellt. In den F'lügeln
befinden sich Verkündung, Heimsuchung, Geburt Christi
und Anbetung der heiligen drei Könige in Schnitzerei, in
Malerei Bilder aus der Leidensgeschichte und Petrus,
Paulus, Johannes der Tüufer und Johannes der Evan-
gelist. Die Staffel zeigt eine heilige Sippe. Das Werk,
aus der Schule des mährisch-schlesischen Maler-Bild-
liauers Hans Olmützer stammend, ist um 1519 zu
datieren. r 4
Im anschließenden Diözesanmuseum präponderiert
der sächsische Barock, der, wie die eben erwähnte Lau-
sitzer Gotik, ein Gipfel der Bautzener Kunststätte ist.
Insbesondere die beiden überlebensgroßen, in Lindenholz
geschnitzten Meisterwerke von der Hand Balthasar
Permosers, die Kirchenväter Ambrosius und Augusti-
nus, die an der Spitze von Permosers Gesamtwerk
stehen (um 1725), wundervoll in der tiefen Beseeltheit
der Köpfe, und die schöne Figur des Märtyrers Sebastian
(in eben diesem Raum 50), von Permoser oder aus seiner
Werkstatt, sind prächtig und Mittelpunkt dieser Samm-
lung. Die beiden Statuen der Kirchenväter Augustinus
und Ambrosius waren für den Hochaltar der Dresdner
Hofkapelie geschaffen, kamen aber durch Vermittlung
des Grafen Brühl 1751 als Geschenk an den Bautzeuer
Marienaltar auis Löbau (um 1519) im Stadtmuseum Bautzen
Dom, wo sie blieben, bis die puristische Bewegung, die
„stilgerechte“ Renovierung dcs gotischen Bautzener
Dom St. Petri, 1883—87, sie der dortigen Unterkunft
beraubt hat.
Auch eine größere Zahl stattlicher Altargemälde be-
wahrt das Diözesanmuseum, vor allem zwei Werke des
in Sachsen lange Zeit tätigen Venezianers Giovanni
Antonio Pellegrini: „Die lieilige Dreifaltigkeit“, die als
Mittelstück des Permoser-AItars gleichzeitig mit diesem
nacli Bautzen kam, und die „Sohlüsselübergabe“, die als
Mittelbild für den Hauptaltar des Bautzener Doms ent-
standen ist.
Im zweiten Obergeschoß des Stadtmuseums befin-
det sich ausschließlich die Galerie moderner Gemälde.
Man sieht hier u. a. von Arnold Böcklin eine schwermut-
volle frührömische Landschaftsstudie („Heroische Land-
11t
Schmiedekunst, Zinngießerei und Töpferei, besonders
wichtige heimische Gewerbe. Das unter dem Namen
Bautzener Steinzeug bekannte dunkelbraune, mit
schwarzen Ranken verzierte Zeug ist wahrscheinlich
nur von hier aus in den Handel gebracht, aber wohl in
Muskau hergestellt worden. Der künstlerisch wert-
vollste Inhalt des Obergeschosses ist die reiche „Samm-
lung kirchlicher Altertümer“, zu der das dem Stadt-
museum angegliederte katholische Diözesamnuseum des
Domstifts St. Petri die kostbarsten Stücke hinzufiigte.
Der Raum 48 enthält die größten Schätze der gotischen
Lausitzer Bildschnitzerschule. Nachdem man die frühe-
sten vorhandenen Werke, den Ulbersdorfer, von der
Prager Hofkunstschule Karls IV. beeinflußten Marien-
altar, dessen Entstehungszeit um 1400 ist, und den um
50 Jahre späteren Pohlaer Annenaltar betrachtet hat,
kann man hier bewundernd vor dem Kittlitzer Altarwerk
stehen. Im Mittelteile, dem Schreine, steht die Gestalt
der Jungfrau Maria, rechts von ihr der heilige Procop,
dem die Kittlitzer Kirche geweiht war, links Anna mit
Maria und Christkind, das „heilige Selbdritt“. In den
Flügeln, und zwar im rechten Flügel, sind die Figuren
der heiligen Katharina und der heiligen Barbara auf-
gestellt, im linkendie des hciligen Andreas und Johannes
des Täufers. Der Hintergrund ist bei sämtlichen Figuren
ein vergoldeter, brokatstoffartig gemusterter. Die Be-
maiung der Flügel stellt das Marienleben und das Leben
des heiligen Procop, sowie den Tod des Johannes und
des Andreas dar. Im Unterteil des Altaraufsatzes, der
Staffel, werden die Martern eines Papstes und des hei-
iigeri Sebastian gezeigt.
Der Meister dieses Altars, der 1490—1500 zu datie-
ren ist, dürfte nach den Forsciiungen Brugers Bernhard
der „Moler“ oder der „Schnitzer“ sein, der in den
Bautzener Ratsakten öfters erwähnt und wohl in
Bautzen oder Kamenz beheimatet war. Mit dem
Kamenzer Marienaltar des Dresdner Altertumsmuseums
gehört das Werk aufs engste zusammen. Während der
1499 datierte Madonnenaltar von Schönau auf dem Eigen
noch eine letzte spätgotisehe Entwicklungsstufe au'f-
weist — wie als Einzelwerk in eben diesem Raum der
lebensgroße Gekreuzigte aus Uhyst am Taucher, meister-
liaft im schmerzvollen Ausdruck, der Nürnbergischen Art
verwandt — hat der Marienaltar aus der Nicolaikirche
in Löbau bereits den Uebergang zur Renaissance voli-
zogen. Im Schrein ist die von zwei Engeln gekrönte
Maria mit dem Christkind dargestellt. In den F'lügeln
befinden sich Verkündung, Heimsuchung, Geburt Christi
und Anbetung der heiligen drei Könige in Schnitzerei, in
Malerei Bilder aus der Leidensgeschichte und Petrus,
Paulus, Johannes der Tüufer und Johannes der Evan-
gelist. Die Staffel zeigt eine heilige Sippe. Das Werk,
aus der Schule des mährisch-schlesischen Maler-Bild-
liauers Hans Olmützer stammend, ist um 1519 zu
datieren. r 4
Im anschließenden Diözesanmuseum präponderiert
der sächsische Barock, der, wie die eben erwähnte Lau-
sitzer Gotik, ein Gipfel der Bautzener Kunststätte ist.
Insbesondere die beiden überlebensgroßen, in Lindenholz
geschnitzten Meisterwerke von der Hand Balthasar
Permosers, die Kirchenväter Ambrosius und Augusti-
nus, die an der Spitze von Permosers Gesamtwerk
stehen (um 1725), wundervoll in der tiefen Beseeltheit
der Köpfe, und die schöne Figur des Märtyrers Sebastian
(in eben diesem Raum 50), von Permoser oder aus seiner
Werkstatt, sind prächtig und Mittelpunkt dieser Samm-
lung. Die beiden Statuen der Kirchenväter Augustinus
und Ambrosius waren für den Hochaltar der Dresdner
Hofkapelie geschaffen, kamen aber durch Vermittlung
des Grafen Brühl 1751 als Geschenk an den Bautzeuer
Marienaltar auis Löbau (um 1519) im Stadtmuseum Bautzen
Dom, wo sie blieben, bis die puristische Bewegung, die
„stilgerechte“ Renovierung dcs gotischen Bautzener
Dom St. Petri, 1883—87, sie der dortigen Unterkunft
beraubt hat.
Auch eine größere Zahl stattlicher Altargemälde be-
wahrt das Diözesanmuseum, vor allem zwei Werke des
in Sachsen lange Zeit tätigen Venezianers Giovanni
Antonio Pellegrini: „Die lieilige Dreifaltigkeit“, die als
Mittelstück des Permoser-AItars gleichzeitig mit diesem
nacli Bautzen kam, und die „Sohlüsselübergabe“, die als
Mittelbild für den Hauptaltar des Bautzener Doms ent-
standen ist.
Im zweiten Obergeschoß des Stadtmuseums befin-
det sich ausschließlich die Galerie moderner Gemälde.
Man sieht hier u. a. von Arnold Böcklin eine schwermut-
volle frührömische Landschaftsstudie („Heroische Land-
11t