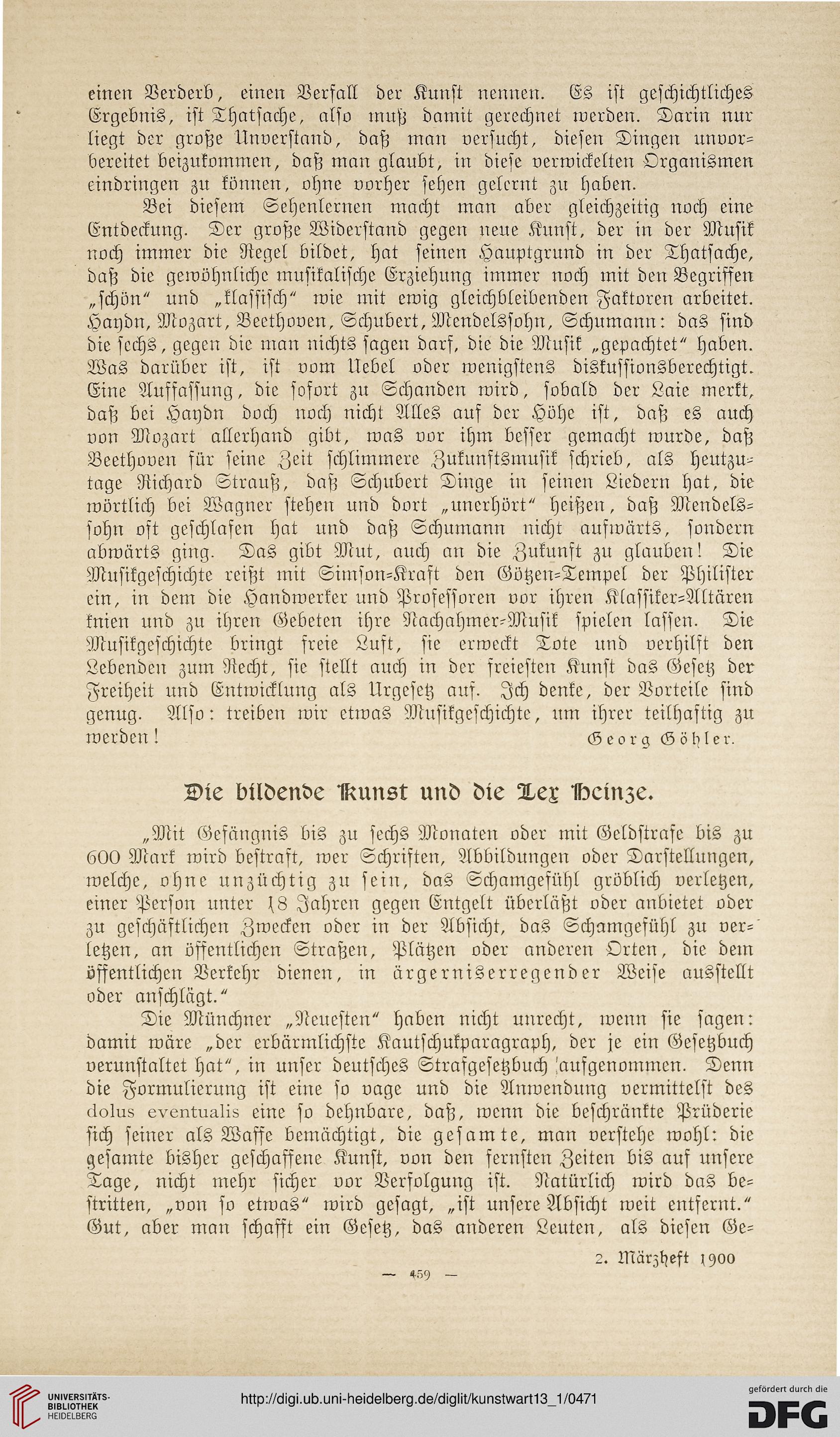einen Verderb, einen Verfall der Kunst nennen. Es ist geschichtliches
Ergebnis, ist Thatsache, also mutz damit gerechnet werden. Darin nur
liegt der große Unverstand, daß man versucht, diesen Dingen unvor-
bereitet beizukommen, daß man glaubt, in diese verwicketten Organismen
eindringen zu können, ohne vorher sehen gelernt zu haben.
Bei diesem Sehenlernen macht man aber gleichzeitig noch eine
Entdeckung. Der große Widerstand gegen neue Kunst, der in der Musik
noch immer die Regel bildet, hat seinen Hauptgrund in der Thatsache,
daß die gewöhnliche musikalische Erziehung immer noch mit den Begriffen
„schön" und „klassisch" wie mit ewig gleichbleibenden Faktoren arbeitet.
Haydn, Mozart, Veethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann: das sind
die sechs, gegen die man nichts sagen dars, die die Musik „gepachtet" haben.
Was darüber ist, ist vom Uebel oder wenigstens diskussionsberechtigt.
Eine Aussassung, die sofort zu Schanden wird, sobald der Laie merkt,
daß bei Haydn doch noch nicht Alles auf der Höhe ist, daß es auch
von Mozart allerhand gibt, was vor ihm besser gemacht wurde, daß
Beethoven sür seine Zeit schlimmere Zukunstsmusik schrieb, als heutzu-
tage Richard Strauß, daß Schubert Dinge in seinen Liedern hat, die
wörtlich bei Wagner stehen und dort „unerhört" heißen, daß Mendels-
sohn ost geschlafen hat und daß Schumann nicht auswärts, sondern
abwürts ging. Das gibt Mut, auch an die Zukunft zu glauben! Die
Musikgeschichte reißt mit Simson-Krast den Götzen-Tempel der Philister
ein, in dem die Handwerker und Professoren vor ihren Klassiker-Altären
knien und zu ihren Gebeten ihre Nachahmer-Musik spielen lassen. Die
Musikgeschichte bringt sreie Lust, sie erweckt Tote und verhilft den
Lebenden zum Recht, sie stellt auch in der freiesten Kunst das Gesetz der
Freiheit und Entwicklung als Urgesetz aus. Jch denke, der Vorteile sind
genug. Also: treiben wir etwas Musikgeschichte, um ihrer teilhastig zu
werden! Georg Göhler.
DLe blldende Ilrunst und die Lex Deinze.
„Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrase bis zu
600 Mark wird bestrast, wer Schristen, Abbildungen oder Darstellungen,
welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgesühl gröblich verletzen,
emer Person unter s8 Jahren gegen Entgelt überläßt oder anbietet oder
zu geschästlichen Zwecken oder in der Absicht, das Schamgefühl zu ver-
letzen, an öffentlichen Straßen, Plätzen oder anderen Orten, die dem
öffentlichen Verkehr dienen, in ürgerniserregender Weise ausstellt
oder anschlägt."
Die Münchner „Neuesten" haben nicht unrecht, wenn sie sagen:
damit wäre „der erbärmlichste Kautschukparagraph, der je ein Gesetzbuch
verunstaltet hat", in unser deutsches Strasgesetzbuch !ausgenommen. Denn
die Formulierung ist eine so vage und die Anwendung vermittelst des
ckoIu8 eveMuuli8 eine so dehnbare, daß, wenn die beschränkte Prüderie
sich seiner als Waffe bemächtigt, die gesamte, man verstehe wohl: die
gesamte bisher geschaffene Kunst, von den sernsten Zeiten bis auf unsere
Tage, nicht mehr sicher vor Versolgung ist. Natürlich wird das be-
stritten, „von so etwas" wird gesagt, „ist unsere Absicht weit entfernt."
Gut, aber man schafft ein Gesetz, das anderen Leuten, als diesen Ge-
2. Märzheft 1900
Ergebnis, ist Thatsache, also mutz damit gerechnet werden. Darin nur
liegt der große Unverstand, daß man versucht, diesen Dingen unvor-
bereitet beizukommen, daß man glaubt, in diese verwicketten Organismen
eindringen zu können, ohne vorher sehen gelernt zu haben.
Bei diesem Sehenlernen macht man aber gleichzeitig noch eine
Entdeckung. Der große Widerstand gegen neue Kunst, der in der Musik
noch immer die Regel bildet, hat seinen Hauptgrund in der Thatsache,
daß die gewöhnliche musikalische Erziehung immer noch mit den Begriffen
„schön" und „klassisch" wie mit ewig gleichbleibenden Faktoren arbeitet.
Haydn, Mozart, Veethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann: das sind
die sechs, gegen die man nichts sagen dars, die die Musik „gepachtet" haben.
Was darüber ist, ist vom Uebel oder wenigstens diskussionsberechtigt.
Eine Aussassung, die sofort zu Schanden wird, sobald der Laie merkt,
daß bei Haydn doch noch nicht Alles auf der Höhe ist, daß es auch
von Mozart allerhand gibt, was vor ihm besser gemacht wurde, daß
Beethoven sür seine Zeit schlimmere Zukunstsmusik schrieb, als heutzu-
tage Richard Strauß, daß Schubert Dinge in seinen Liedern hat, die
wörtlich bei Wagner stehen und dort „unerhört" heißen, daß Mendels-
sohn ost geschlafen hat und daß Schumann nicht auswärts, sondern
abwürts ging. Das gibt Mut, auch an die Zukunft zu glauben! Die
Musikgeschichte reißt mit Simson-Krast den Götzen-Tempel der Philister
ein, in dem die Handwerker und Professoren vor ihren Klassiker-Altären
knien und zu ihren Gebeten ihre Nachahmer-Musik spielen lassen. Die
Musikgeschichte bringt sreie Lust, sie erweckt Tote und verhilft den
Lebenden zum Recht, sie stellt auch in der freiesten Kunst das Gesetz der
Freiheit und Entwicklung als Urgesetz aus. Jch denke, der Vorteile sind
genug. Also: treiben wir etwas Musikgeschichte, um ihrer teilhastig zu
werden! Georg Göhler.
DLe blldende Ilrunst und die Lex Deinze.
„Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrase bis zu
600 Mark wird bestrast, wer Schristen, Abbildungen oder Darstellungen,
welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgesühl gröblich verletzen,
emer Person unter s8 Jahren gegen Entgelt überläßt oder anbietet oder
zu geschästlichen Zwecken oder in der Absicht, das Schamgefühl zu ver-
letzen, an öffentlichen Straßen, Plätzen oder anderen Orten, die dem
öffentlichen Verkehr dienen, in ürgerniserregender Weise ausstellt
oder anschlägt."
Die Münchner „Neuesten" haben nicht unrecht, wenn sie sagen:
damit wäre „der erbärmlichste Kautschukparagraph, der je ein Gesetzbuch
verunstaltet hat", in unser deutsches Strasgesetzbuch !ausgenommen. Denn
die Formulierung ist eine so vage und die Anwendung vermittelst des
ckoIu8 eveMuuli8 eine so dehnbare, daß, wenn die beschränkte Prüderie
sich seiner als Waffe bemächtigt, die gesamte, man verstehe wohl: die
gesamte bisher geschaffene Kunst, von den sernsten Zeiten bis auf unsere
Tage, nicht mehr sicher vor Versolgung ist. Natürlich wird das be-
stritten, „von so etwas" wird gesagt, „ist unsere Absicht weit entfernt."
Gut, aber man schafft ein Gesetz, das anderen Leuten, als diesen Ge-
2. Märzheft 1900