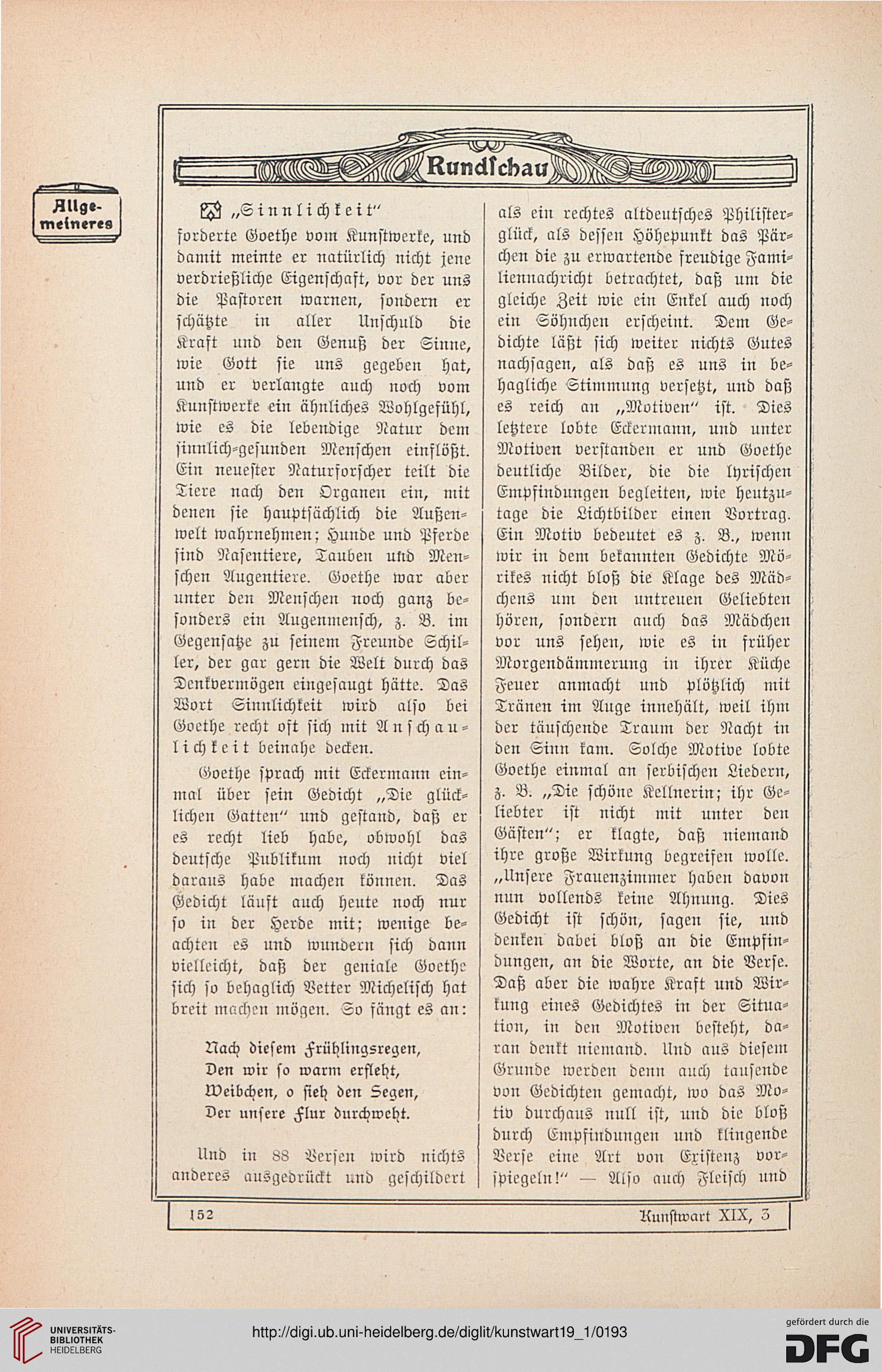-IUg.-
ni.in.i'.s
kA „S inn li ch k e i t"
forderte Goethe vom Kunstwerke, und
damit meinte er natürlich nicht jene
verdrießliche Eigenschaft, vor der uns
die Pastoren warnen, sondern er
schätzte in aller Unschuld die
Kraft und den Genuß der Sinne,
wie Gott sie nns gegeben hat,
und er verlangte auch noch vom
Knnstwerke ein ähnliches Wohlgefühl,
wie es die lebendige Natur dem
sinnlich-gesunden Menschcn einslößt.
Ein neuester Naturforscher tcilt die
Tiere nach den Organen cin, niit
denen sie hauptsüchlich die Außcn-
welt wahrnehmen; Hunde und Pferde
sind Nasentiere, Tauben uüd Men-
schen Augentiere. Goethe war aber
unter den Menschen noch ganz be-
sonders ein Augenmensch, z. B. im
Gegcnsatze zu seinem Freunde Schil-
ler, der gar gern die Welt durch das
Dcnkvermögen ciugesaugt hätte. Das
Wort Siuulichkeit wird also bei
Goethe recht ost sich mit Anschau-
lichkeit beinahe decken.
Goethe sprach mit Eckermann cin-
mal über sein Gedicht „Die glück-
lichen Gattcn" und gestand, daß er
es recht lieb habc, obwohl das
deutsche Publikum noch uicht viel
daraus habe machen können. Das
Gedicht läuft auch heute noch nur
so in der Herde mit; wenige be-
achten es und wundern sich dann
vielleicht, daß der geuiale Gocthe
sich so behaglich Vetter Michelisch hat
breit machcu mögeu. So fängt es an:
Nach diesem Frühlingsregen,
Den wir so warm erfleht,
Weibchen, o sieh den 5egen,
Der unsere Flur durchwcht.
Und in 88 Versen wird nichts
anderes ausgedrückt und geschildert
als eiu rechtes altdeutschcs Philister-
glück, als desseu Höhepunkt das Pär-
chen die zu erwartende freudige F-ami-
liennachricht betrachtet, daß um die
glciche Zeit wie ciu Enkel auch uoch
ein Söhnchen erscheiut. Dem Ge-
dichte läßt sich weiter nichts Gutcs
nachsagen, als daß es uns iu be-
hagliche Stimmung versetzt, und daß
es rcich an „Motiven" ist. Dies
letztere lobte Eckermann, und uutcr
Motiven verstanden er und Goethe
deutliche Bilder, die die lyrischen
Empfindungen begleiten, wie heutzu-
tage die Lichtbilder einen Vortrag.
Ein Motiv bedeutet es z. B., wenu
wir in dem bekannten Gedichte Mö-
rikes nicht bloß die Klage des Müd-
chcns um den untreuen Geliebten
hörcn, sondern auch das Mädchen
vor uns sehen, wie es in srüher
Morgendämmerung iu ihrcr Küche
F-euer anmacht und Plötzlich mit
Tränen im Auge inuehält, weil ihm
der täuschende Traum der Nacht in
dcn Sinn kam. Solche Motive lobte
Goethe einmal an serbischen Liedcru,
z. B. „Die schöne Kellnerin; ihr Ge-
liebter ist nicht mit unter den
Gästen"; er klagte, daß niemand
ihre großc Wirkung bcgrcifcn wolle.
„Unsere F-rauenzimmer haben davon
nun vollends kciue Ahnung. Dies
Gedicht ist schön, sagen sie, und
denken dabei bloß an die Empfin-
dungen, an die Worte, an die Bersc.
Daß aber die wahre Kraft und Wir-
kung eines Gedichtes in der Situa-
tiou, in deu Motiven besteht, da-
ran denkt uiemand. ilnd ans diesem
Grunde werden denu auch tausende
von Gedichten gemacht, wo das Mo-
tiv durchaus null ist, und die bloß
durch Empfiudungen nnd klingende
Verse eine Art vou Existeuz vor-
spiegelu!" — Also auch Fleisch und
IS2
Runstwcnt XIX, 3
ni.in.i'.s
kA „S inn li ch k e i t"
forderte Goethe vom Kunstwerke, und
damit meinte er natürlich nicht jene
verdrießliche Eigenschaft, vor der uns
die Pastoren warnen, sondern er
schätzte in aller Unschuld die
Kraft und den Genuß der Sinne,
wie Gott sie nns gegeben hat,
und er verlangte auch noch vom
Knnstwerke ein ähnliches Wohlgefühl,
wie es die lebendige Natur dem
sinnlich-gesunden Menschcn einslößt.
Ein neuester Naturforscher tcilt die
Tiere nach den Organen cin, niit
denen sie hauptsüchlich die Außcn-
welt wahrnehmen; Hunde und Pferde
sind Nasentiere, Tauben uüd Men-
schen Augentiere. Goethe war aber
unter den Menschen noch ganz be-
sonders ein Augenmensch, z. B. im
Gegcnsatze zu seinem Freunde Schil-
ler, der gar gern die Welt durch das
Dcnkvermögen ciugesaugt hätte. Das
Wort Siuulichkeit wird also bei
Goethe recht ost sich mit Anschau-
lichkeit beinahe decken.
Goethe sprach mit Eckermann cin-
mal über sein Gedicht „Die glück-
lichen Gattcn" und gestand, daß er
es recht lieb habc, obwohl das
deutsche Publikum noch uicht viel
daraus habe machen können. Das
Gedicht läuft auch heute noch nur
so in der Herde mit; wenige be-
achten es und wundern sich dann
vielleicht, daß der geuiale Gocthe
sich so behaglich Vetter Michelisch hat
breit machcu mögeu. So fängt es an:
Nach diesem Frühlingsregen,
Den wir so warm erfleht,
Weibchen, o sieh den 5egen,
Der unsere Flur durchwcht.
Und in 88 Versen wird nichts
anderes ausgedrückt und geschildert
als eiu rechtes altdeutschcs Philister-
glück, als desseu Höhepunkt das Pär-
chen die zu erwartende freudige F-ami-
liennachricht betrachtet, daß um die
glciche Zeit wie ciu Enkel auch uoch
ein Söhnchen erscheiut. Dem Ge-
dichte läßt sich weiter nichts Gutcs
nachsagen, als daß es uns iu be-
hagliche Stimmung versetzt, und daß
es rcich an „Motiven" ist. Dies
letztere lobte Eckermann, und uutcr
Motiven verstanden er und Goethe
deutliche Bilder, die die lyrischen
Empfindungen begleiten, wie heutzu-
tage die Lichtbilder einen Vortrag.
Ein Motiv bedeutet es z. B., wenu
wir in dem bekannten Gedichte Mö-
rikes nicht bloß die Klage des Müd-
chcns um den untreuen Geliebten
hörcn, sondern auch das Mädchen
vor uns sehen, wie es in srüher
Morgendämmerung iu ihrcr Küche
F-euer anmacht und Plötzlich mit
Tränen im Auge inuehält, weil ihm
der täuschende Traum der Nacht in
dcn Sinn kam. Solche Motive lobte
Goethe einmal an serbischen Liedcru,
z. B. „Die schöne Kellnerin; ihr Ge-
liebter ist nicht mit unter den
Gästen"; er klagte, daß niemand
ihre großc Wirkung bcgrcifcn wolle.
„Unsere F-rauenzimmer haben davon
nun vollends kciue Ahnung. Dies
Gedicht ist schön, sagen sie, und
denken dabei bloß an die Empfin-
dungen, an die Worte, an die Bersc.
Daß aber die wahre Kraft und Wir-
kung eines Gedichtes in der Situa-
tiou, in deu Motiven besteht, da-
ran denkt uiemand. ilnd ans diesem
Grunde werden denu auch tausende
von Gedichten gemacht, wo das Mo-
tiv durchaus null ist, und die bloß
durch Empfiudungen nnd klingende
Verse eine Art vou Existeuz vor-
spiegelu!" — Also auch Fleisch und
IS2
Runstwcnt XIX, 3