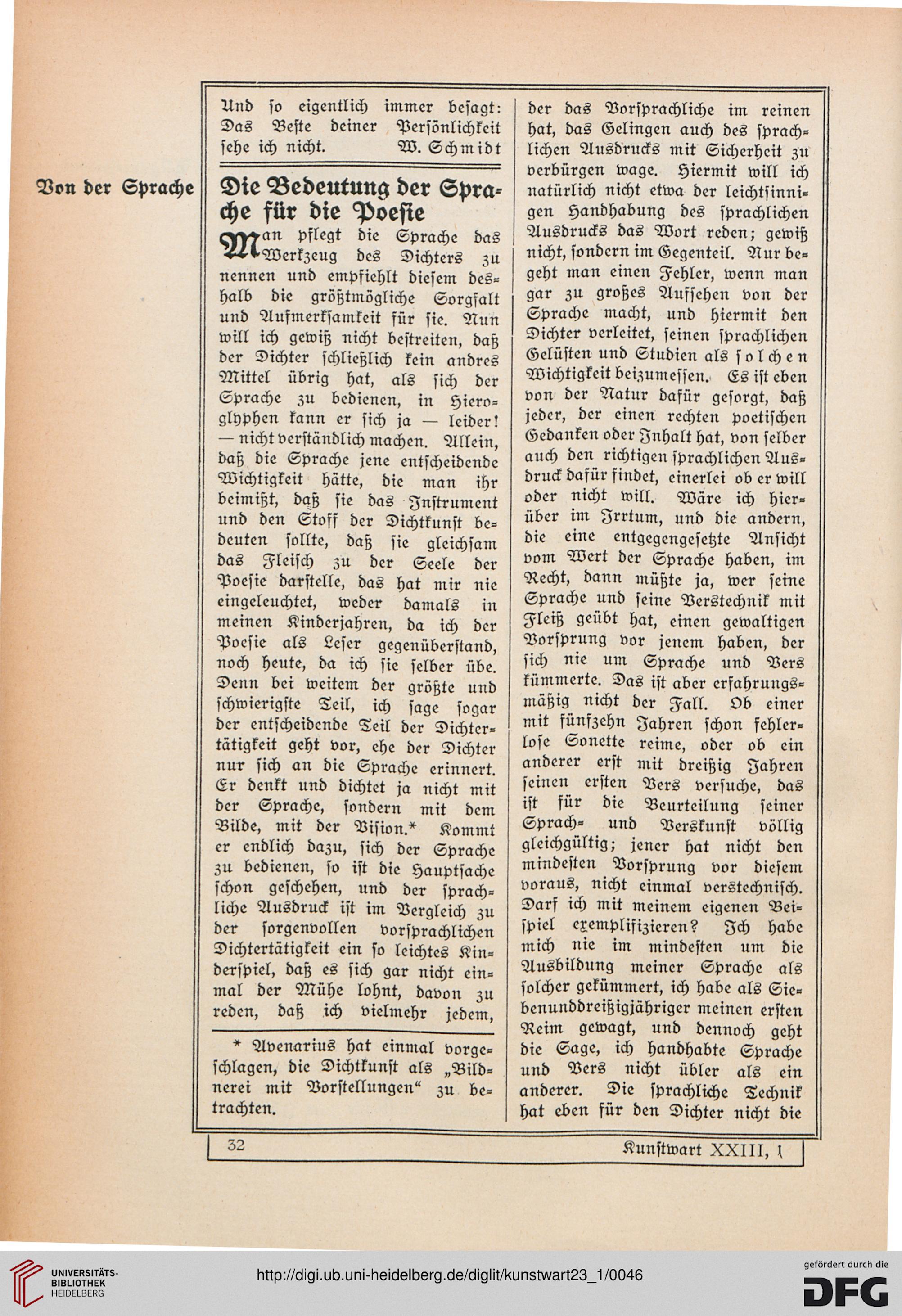Von der Sprache
Urid so eigentlich immer besagt:
Das Beste deiner Persönlichkeit
sehe ich nicht. W. Schmidt
Die Bedeutung der Spra-
che für die Poesie
an pflegt die Sprache das
Werkzeug des Dichtcrs zu
nennen und empfiehlt diesem des--
halb die größtmögliche Sorgfalt
und Aufmerksamkeit für sie. Nun
will ich gewiß nicht bcstreiten, daß
der Dichter schließlich kein andrcs
Mittel übrig hat, als sich dcr
Sprache zu bcdienen, in Hiero-
glyphen kann er sich ja — leiderl
— nicht verständlich machen. Allein,
daß die Sprachc jcne entscheidcnde
Wichtigkcit hätte, dic man ihr
beimißt, daß sie das Instrument
und dcn Stoff der Dichtkunst be-
deuten sollte, daß sie gleichsam
das Fleisch zu dcr Seele der
Poesie darstelle, das hat mir nie
eingeleuchtet, weder damals in
meinen Kinderjahren, da ich dcr
Pocsie als Leser gegenüberstand,
noch heute, da ich sie selber übe.
Denn bei weitem der größte und
schwierigste Leil, ich sage sogar
der entscheidende Teil der Dichtcr-
tätigkeit geht vor, ehe der Dichter
nur sich an die Sprache erinnert.
Er denkt und dichtet ja nicht mit
dcr Sprache, sondern mit dem
Bilde, mit der Vision.* Kommt
cr endlich dazu, sich der Sprache
zu bedienen, so ist die Hauptsache
schon geschehen, und der sprach-
liche Ausdruck ist im Vergleich zu
der sorgcnvollen vorsprachlichen
Dichtertätigkeit ein so leichtes Kin-
derspiel, daß es sich gar nicht ein-
mal der Mühe lohnt, davon zu
reden, daß ich viclmehr jedcm,
* Avenarius hat einmal vorge-
schlagen, die Dichtkunst als ^Bild-
nerei mit Dorstellungen" zu be-
trachten.
der das Vorsprachliche im reinen
hat, das Gelingcn auch des sprach-
lichen Ausdrucks mit Sichcrhcit zu
verbürgen wage. Hiermit will ich
natürlich nicht etwa der leichtsinni-
gen Handhabung dcs sprachlichen
Ausdrucks das Wort redcn; gcwiß
nicht, sondcrn im Gegenteil. Nur be°
geht man einen Fehler, wenn man
gar zu großes Aufsehen von der
Sprache macht, und hiermit den
Dichter vcrleitet, seinen sprachlichen
Gelüsten und Studien als solchen
Wichtigkeit beizumessen. Es ist cbcn
von der Natur dafür gcsorgt, daß
jedcr, dcr einen rcchten poetischcn
Gedanken oder Inhalt hat, von selber
auch dcn richtigcn sprachlichcn Aus-
druck dafür findet, einerlei ob er will
oder nicht will. Wäre ich hicr-
über im Irrtum, und die andern,
die eine entgegengesetzte Ansicht
vom Wert der Sprache haben, im
Rccht, dann müßte ja, wer seine
Sprache und seine Verstechnik mit
Fleiß geübt hat, einen gewaltigen
Vorsprung vor jenem haben, der
sich nie um Sprache und Vers
kümmerte. Das ist aber erfahrungs-
mäßig nicht der Fall. Ob eincr
mit fünfzehn Iahren schon fehler-
lose Sonette reime, odcr ob ein
anderer erst mit dreißig Iahren
scincn crsten Vers versuche, das
ist für die Beurteilung seiner
Sprach» und Verskunst völlig
gleichgültig; jener hat nicht den
mindesten Vorsprung vor diesem
voraus, nicht cinmal verstechnisch.
Darf ich mit meinem eigenen Bei-
spiel cxemplifizieren? Ich habe
mich nie im mindesten um die
Ausbildung mciner Sprache als
solchcr gekümmert, ich habe als Sic-
benunddreißigjähriger meinen crsten
Rcim gcwagt, und dennoch geht
die Sage, ich handhabte Sprache
und Vers nicht übler als ein
andcrer. Die sprachliche Technik
hat eben für dcn Dichter nicht die
32
Kunstwart XXIII, l
Urid so eigentlich immer besagt:
Das Beste deiner Persönlichkeit
sehe ich nicht. W. Schmidt
Die Bedeutung der Spra-
che für die Poesie
an pflegt die Sprache das
Werkzeug des Dichtcrs zu
nennen und empfiehlt diesem des--
halb die größtmögliche Sorgfalt
und Aufmerksamkeit für sie. Nun
will ich gewiß nicht bcstreiten, daß
der Dichter schließlich kein andrcs
Mittel übrig hat, als sich dcr
Sprache zu bcdienen, in Hiero-
glyphen kann er sich ja — leiderl
— nicht verständlich machen. Allein,
daß die Sprachc jcne entscheidcnde
Wichtigkcit hätte, dic man ihr
beimißt, daß sie das Instrument
und dcn Stoff der Dichtkunst be-
deuten sollte, daß sie gleichsam
das Fleisch zu dcr Seele der
Poesie darstelle, das hat mir nie
eingeleuchtet, weder damals in
meinen Kinderjahren, da ich dcr
Pocsie als Leser gegenüberstand,
noch heute, da ich sie selber übe.
Denn bei weitem der größte und
schwierigste Leil, ich sage sogar
der entscheidende Teil der Dichtcr-
tätigkeit geht vor, ehe der Dichter
nur sich an die Sprache erinnert.
Er denkt und dichtet ja nicht mit
dcr Sprache, sondern mit dem
Bilde, mit der Vision.* Kommt
cr endlich dazu, sich der Sprache
zu bedienen, so ist die Hauptsache
schon geschehen, und der sprach-
liche Ausdruck ist im Vergleich zu
der sorgcnvollen vorsprachlichen
Dichtertätigkeit ein so leichtes Kin-
derspiel, daß es sich gar nicht ein-
mal der Mühe lohnt, davon zu
reden, daß ich viclmehr jedcm,
* Avenarius hat einmal vorge-
schlagen, die Dichtkunst als ^Bild-
nerei mit Dorstellungen" zu be-
trachten.
der das Vorsprachliche im reinen
hat, das Gelingcn auch des sprach-
lichen Ausdrucks mit Sichcrhcit zu
verbürgen wage. Hiermit will ich
natürlich nicht etwa der leichtsinni-
gen Handhabung dcs sprachlichen
Ausdrucks das Wort redcn; gcwiß
nicht, sondcrn im Gegenteil. Nur be°
geht man einen Fehler, wenn man
gar zu großes Aufsehen von der
Sprache macht, und hiermit den
Dichter vcrleitet, seinen sprachlichen
Gelüsten und Studien als solchen
Wichtigkeit beizumessen. Es ist cbcn
von der Natur dafür gcsorgt, daß
jedcr, dcr einen rcchten poetischcn
Gedanken oder Inhalt hat, von selber
auch dcn richtigcn sprachlichcn Aus-
druck dafür findet, einerlei ob er will
oder nicht will. Wäre ich hicr-
über im Irrtum, und die andern,
die eine entgegengesetzte Ansicht
vom Wert der Sprache haben, im
Rccht, dann müßte ja, wer seine
Sprache und seine Verstechnik mit
Fleiß geübt hat, einen gewaltigen
Vorsprung vor jenem haben, der
sich nie um Sprache und Vers
kümmerte. Das ist aber erfahrungs-
mäßig nicht der Fall. Ob eincr
mit fünfzehn Iahren schon fehler-
lose Sonette reime, odcr ob ein
anderer erst mit dreißig Iahren
scincn crsten Vers versuche, das
ist für die Beurteilung seiner
Sprach» und Verskunst völlig
gleichgültig; jener hat nicht den
mindesten Vorsprung vor diesem
voraus, nicht cinmal verstechnisch.
Darf ich mit meinem eigenen Bei-
spiel cxemplifizieren? Ich habe
mich nie im mindesten um die
Ausbildung mciner Sprache als
solchcr gekümmert, ich habe als Sic-
benunddreißigjähriger meinen crsten
Rcim gcwagt, und dennoch geht
die Sage, ich handhabte Sprache
und Vers nicht übler als ein
andcrer. Die sprachliche Technik
hat eben für dcn Dichter nicht die
32
Kunstwart XXIII, l