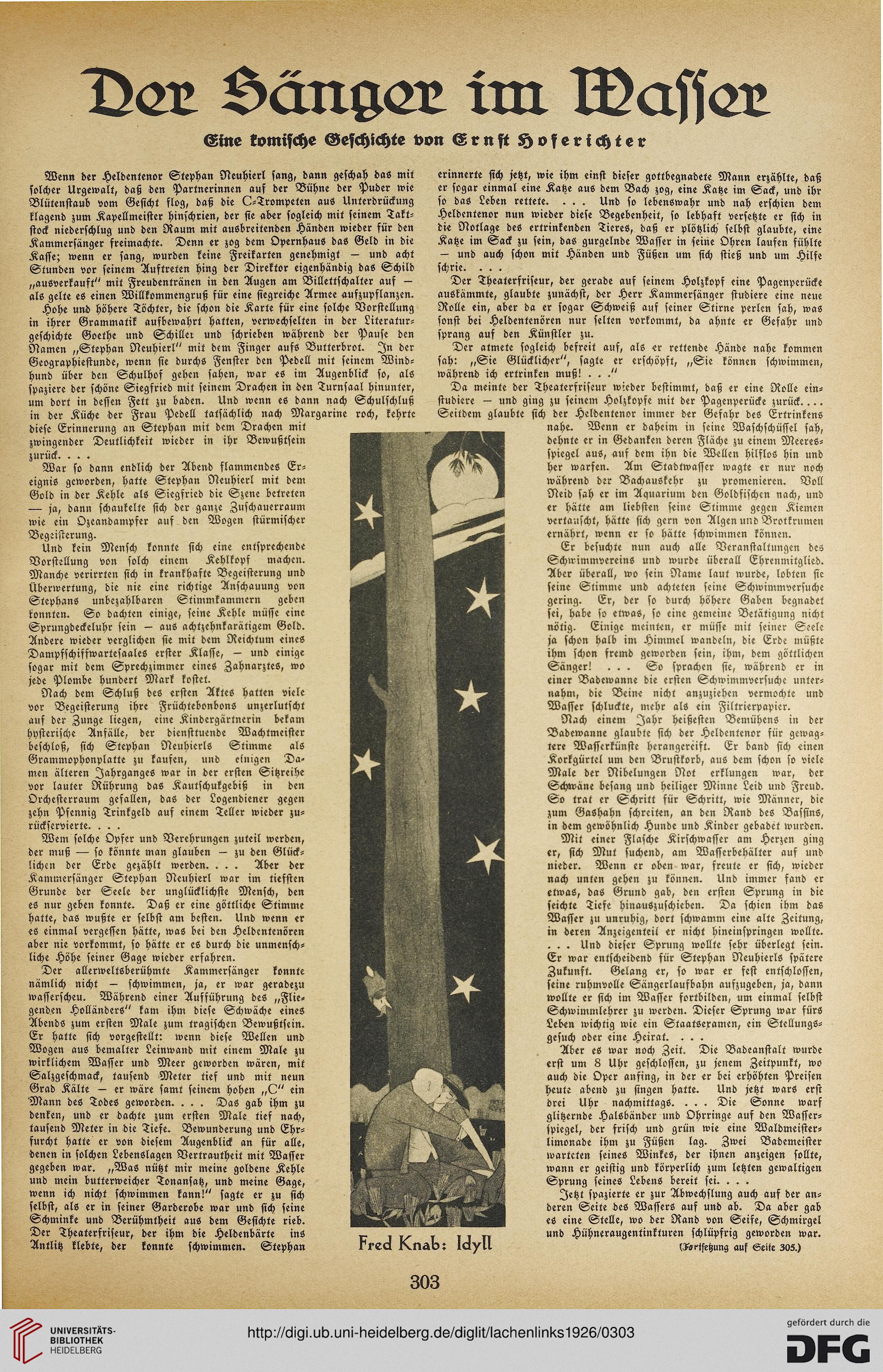Dsr SängsL im Wcrsssr
Eine komische Geschichte von Ernst Hoserichter
Wenn der Heldentenor Stephan Neuhierl sang, dann geschah das mit
solcher Urgewalt, daß den Partnerinnen auf der Bühne der Puder wie
Blutenstaub vom Gesicht flog, daß die G-Trompeten aus Unterdrückung
klagend zum Kapellmeister hinschrien, der sie aber sogleich mit seinem Takt-
ftock niederschlug und den Raum mit ausbreitenden Händen wieder für den
Kammersänger freimachte. Denn er zog dem Opernhaus das Geld in die
Kaste; wenn er sang, wurden keine Freikarten genehmigt - und acht
Stunden vor seinem Auftreten hing der Direktor eigenhändig das Schild
„ausverkauft" mit Freudentränen in den Augen am Billetischalter auf —
als gelte es einen Willkommengruß für eine siegreiche Armee aufzupflanzen.
Hohe und höhere Töchter, die schon die Karte für eine solche Vorstellung
in ihrer Grammatik aufbewahrt halten, verwechselten in der Literatur-
geschichte Goethe und Schiller und schrieben während der Pause den
Namen „Stephan Neuhierl" mit dem Finger aufs Butterbrot. In der
Geographieftunde, wenn sie durchs Fenster den Pedell mit seinem Wind-
hund über den Schulhof geben sahen, war «S im Augenblick so, als
spaziere der schöne Siegfried mit seinem Drachen in den Turnsaal hinunter,
um dort in besten Fett zu baden. Und wenn es dann nach Schulschluß
in der Küche der Frau Pedell tatsächlich nach Margarine roch, kehrte
diese Erinnerung an Stephan mit dem Drachen mit
zwingender Deutlichkeit wieder in ihr Bewußtsein
zurück. . . .
War so dann endlich der Abend flammendes Er-
eignis geworden, hatte Stephan Neuhierl mit dem
Gold in der Kehle als Siegfried die Szene betreten
— ja, dann schaukelte sich der ganze Zuschauerraum
wie ein Ozeandampfer auf den Wogen stürmischer
Begeisterung.
Und kein Mensch konnte sich eine entsprechende
Vorstellung von solch einem Kehlkopf machen.
Manche verirrten sich in krankhafte Begeisterung und
Überwertung, die nie eine richtige Anschauung von
Stephans unbezahlbaren Stimmkammern geben
konnten. So dachten einige, seine Kehle müste «ine
Sprungdeckeluhr sein - aus achtzehnkarätigem Gold.
Andere wieder verglichen sie mit dem Reichtum eines
Dampfschiffwartesaales erster Klaste, — und einige
sogar mit dem Sprechzimmer eines Zahnarztes, wo
jede Plombe hundert Mark kostet.
Nach dem Schluß des ersten Aktes hatten viele
vor Begeisterung ihre Früchtebonbons unzerlutscht
auf der Zunge liegen, eine Kindergärtnerin bekam
hysterische Anfälle, der diensttuende Wachtmeister
beschloß, sich Stephan NeuhierlS Stimme als
Grammophonplatte zu kaufen, und einigen Da-
men älteren Jahrganges war in der ersten Sitzreihe
vor lauter Rührung das Kautschukgebiß in den
Orchesterraum gefallen, das der Logendiener gegen
zehn Pfennig Trinkgeld auf einem Teller wieder zu-
rückservierte. . . .
Wem solche Opfer und Verehrungen zuteil werden,
der muß — so könnte man glauben — zu den Glück-
lichen der Erde gezählt werden. . . . Aber der
Kammersänger Stephan Neuhierl war im tiefsten
Grunde der Seele der unglücklichste Mensch, den
es nur geben konnte. Daß er eine göttliche Stimme
hatte, das wußte er selbst am besten. Und wenn er
eö einmal vergesien hätte, was bei den Heldentenören
aber nie vorkommt, so hätte er es durch dir unmensch-
liche Höhe seiner Gage wieder erfahren.
Der allerweltöberühmte Kammersänger konnte
nämlich nicht — schwimmen, ja, er war geradezu
wasierscheu. Während einer Aufführung des „Flie-
genden Holländers" kam ihm diese Schwäche eines
Abendö zum ersten Male zum tragischen Bewußtsein.
Er hatte sich vorgeftellt: wenn diese Wellen und
Wogen aus bemalter Leinwand mit einem Male zu
wirklichem Waffer und Meer geworden wären, mit
Salzgeschmack, lausend Meter tief und mit neun
Grad Kälte — er wäre samt seinem hohen „C" ein
Mann des Todes geworden. . . . Das gab ihm zu
denken, und er dachte zum ersten Male tief nach,
tausend Meter in die Tiefe. Bewunderung und Ehr-
furcht hatte er von diesem Augenblick an für alle,
denen in solchen Lebenslagen Vertrautheit mit Waffer
gegeben war. „Was nützt mir meine goldene Kehle
und mein butterweicher Tonansah, und meine Gage,
wenn ich nicht schwimmen kann!" sagte er zu sich
selbst, als er in seiner Garderobe war und sich seine
Schminke und Berühmtheit aus dem Gesichte rieb.
Der Theaterfriseur, der ihm die Heldenbärte ins
Antlitz klebte, der konnte schwimmen. Stephan
erinnerte sich jetzt, wie ihm einst dieser gottbegnadete Mann erzählte, daß
er sogar einmal eine Katze aus dem Bach zog, eine Katze im Sack, und ihr
so das Leben rettete. . . . Und so lebenswahr und nah erschien dem
Heldcntenor nun wieder diese Begebenheit, so lebhaft versetzte er sich in
die Notlage des ertrinkenden Tieres, daß er plötzlich selbst glaubte, eine
Katze im Sack zu sein, das gurgelnde Waffer in feine Ohren laufen fühlte
— und auch schon mit Händen und Füßen um sich stieß und um Hilfe
schrie. . . .
Der Theaterfriseur, der gerade auf seinem Holzkopf eine Pagenperücke
auskämmte, glaubte zunächst, der Herr Kammersänger studiere eine neue
Rolle ein, aber da er sogar Schweiß auf seiner Stirne perlen sah, was
sonst bei Heldentenören nur selten vorkommt, da ahnte er Gefahr und
sprang auf den Künstler zu.
Der atmete sogleich befreit auf, als er rettende Hände nahe kommen
sah: „Sie Glücklicher", sagte er erschöpft, „Sie können schwimmen,
während ich ertrinken muß! . . ."
Da meinte der Theaterfriseur wieder bestimmt, daß er eine Rolle ein-
ftudiere — und ging zu seinem Holzkopfe mit der Pagenperücke zurück....
Seitdem glaubte sich der Heldentenor immer der Gefahr des Ertrinkens
nahe. Wenn er daheim in seine Waschschüssel sah,
dehnte er in Gedanken deren Fläche zu einem Meeres-
spiegel aus, auf dem ihn die Wellen hilflos hin und
her warfen. Am Stadtwaffer wagte er nur noch
während der Bachauskehr zu promenieren. Voll
Neid sah er im Aquarium den Goldfischen nach, und
er hätte am liebsten seine Stimme gegen Kiemen
vertauscht, hätte sich gern von Algen und Brotkrumen
ernährt, wenn er so hätte schwimmen können.
Er besuchte nun auch alle Veranstaltungen des
Schwimmvereins und wurde überall Ehrenmitglied.
Aber überall, wo sein Name laut wurde, lobten sie
seine Stimme und achteten seine Schwimmversuche
gering. Er, der so durch höhere Gaben begnadet
sei, habe so etwas, so eine gemeine Betätigung nicht
nötig. Einige meinten, er müsse mit seiner Seele
ja schon halb im Himmel wandeln, die Erde müßte
ihm schon fremd geworden sein, ihm, dem göttlichen
Sänger! . . . So sprachen sie, während er in
einer Badewanne die ersten Schwimmversuche unter-
nahm, die Beine nicht anzuziehen vermochte und
Waffer schluckte, mehr als rin Filtrierpapier.
Nach einem Jahr heißesten Bemühens in der
Badewanne glaubte sich der Heldentenor für gewag-
tere Wafferkünste herangercift. Er band sich einen
Korkgürtel um den Brustkorb, aus dem schon so viele
Male der Nibelungen Not erklungen war, der
Schwäne besang und heiliger Minne Leid und Freud.
So trat er Schritt für Schritt, wie Männer, die
zum Gashahn schreiten, an den Rand des Bassins,
in dem gewöhnlich Hunde und Kinder gebadet wurden.
Mit einer Flasche Kirschwaffer am Herzen ging
er, sich Mut suchend, am Wasserbehälter auf und
nieder. Wenn er oben war, freute er sich, wieder
nach unten gehen zu können. Und immer fand er
etwas, das Grund gab, den ersten Sprung in die
seichte Tiefe hinauszuschieben. Da schien ihm das
Waffer zu unruhig, dort schwamm eine alte Zeitung,
in deren Anzeigenteil er nicht hineinspringen wollte.
. . . Und dieser Sprung wollte sehr überlegt sein.
Er war entscheidend für Stephan NeuhierlS spätere
Zukunft. Gelang er, so war er fest entschlossen,
seine ruhmvolle Sängerlaufbahn aufzugeben, ja, dann
wollte er sich im Waffer fortbilden, um einmal selbst
Schwimmlehrer zu werden. Dieser Sprung war fürs
Leben wichtig wie ein Staatsexamen, ein Stellungs-
gesuch oder eine Heirat. . . .
Aber es war noch Zeit. Die Badeanstalt wurde
erst um 8 Uhr geschloffen, zu jenem Zeitpunkt, wo
auch die Oper anfing, in der er bei erhöhten Preisen
heute abend zu singen hatte. Und jetzt warS erst
drei Uhr nachmittags. . . . Die Sonne warf
glitzernde Halsbänder und Ohrringe auf den Wasser-
jpiegel, der frisch und grün wie eine Waldmrifter-
limonade ihm zu Füßen lag. Zwei Bademeister
warteten seines Winkes, der ihnen anzeigen sollte,
wann er geistig und körperlich zum letzten gewaltigen
Sprung seines Lebens bereit sei. . . .
Jetzt spazierte er zur Abwechslung auch auf der an-
deren Seite des Wassers auf und ab. Da aber gab
es eine Stelle, wo der Rand von Seife, Schmirgel
und Hühneraugentinkturen schlüpfrig geworden war.
(Jartsehung auf Seite 305.)
Fred Knab: Idyll
303
Eine komische Geschichte von Ernst Hoserichter
Wenn der Heldentenor Stephan Neuhierl sang, dann geschah das mit
solcher Urgewalt, daß den Partnerinnen auf der Bühne der Puder wie
Blutenstaub vom Gesicht flog, daß die G-Trompeten aus Unterdrückung
klagend zum Kapellmeister hinschrien, der sie aber sogleich mit seinem Takt-
ftock niederschlug und den Raum mit ausbreitenden Händen wieder für den
Kammersänger freimachte. Denn er zog dem Opernhaus das Geld in die
Kaste; wenn er sang, wurden keine Freikarten genehmigt - und acht
Stunden vor seinem Auftreten hing der Direktor eigenhändig das Schild
„ausverkauft" mit Freudentränen in den Augen am Billetischalter auf —
als gelte es einen Willkommengruß für eine siegreiche Armee aufzupflanzen.
Hohe und höhere Töchter, die schon die Karte für eine solche Vorstellung
in ihrer Grammatik aufbewahrt halten, verwechselten in der Literatur-
geschichte Goethe und Schiller und schrieben während der Pause den
Namen „Stephan Neuhierl" mit dem Finger aufs Butterbrot. In der
Geographieftunde, wenn sie durchs Fenster den Pedell mit seinem Wind-
hund über den Schulhof geben sahen, war «S im Augenblick so, als
spaziere der schöne Siegfried mit seinem Drachen in den Turnsaal hinunter,
um dort in besten Fett zu baden. Und wenn es dann nach Schulschluß
in der Küche der Frau Pedell tatsächlich nach Margarine roch, kehrte
diese Erinnerung an Stephan mit dem Drachen mit
zwingender Deutlichkeit wieder in ihr Bewußtsein
zurück. . . .
War so dann endlich der Abend flammendes Er-
eignis geworden, hatte Stephan Neuhierl mit dem
Gold in der Kehle als Siegfried die Szene betreten
— ja, dann schaukelte sich der ganze Zuschauerraum
wie ein Ozeandampfer auf den Wogen stürmischer
Begeisterung.
Und kein Mensch konnte sich eine entsprechende
Vorstellung von solch einem Kehlkopf machen.
Manche verirrten sich in krankhafte Begeisterung und
Überwertung, die nie eine richtige Anschauung von
Stephans unbezahlbaren Stimmkammern geben
konnten. So dachten einige, seine Kehle müste «ine
Sprungdeckeluhr sein - aus achtzehnkarätigem Gold.
Andere wieder verglichen sie mit dem Reichtum eines
Dampfschiffwartesaales erster Klaste, — und einige
sogar mit dem Sprechzimmer eines Zahnarztes, wo
jede Plombe hundert Mark kostet.
Nach dem Schluß des ersten Aktes hatten viele
vor Begeisterung ihre Früchtebonbons unzerlutscht
auf der Zunge liegen, eine Kindergärtnerin bekam
hysterische Anfälle, der diensttuende Wachtmeister
beschloß, sich Stephan NeuhierlS Stimme als
Grammophonplatte zu kaufen, und einigen Da-
men älteren Jahrganges war in der ersten Sitzreihe
vor lauter Rührung das Kautschukgebiß in den
Orchesterraum gefallen, das der Logendiener gegen
zehn Pfennig Trinkgeld auf einem Teller wieder zu-
rückservierte. . . .
Wem solche Opfer und Verehrungen zuteil werden,
der muß — so könnte man glauben — zu den Glück-
lichen der Erde gezählt werden. . . . Aber der
Kammersänger Stephan Neuhierl war im tiefsten
Grunde der Seele der unglücklichste Mensch, den
es nur geben konnte. Daß er eine göttliche Stimme
hatte, das wußte er selbst am besten. Und wenn er
eö einmal vergesien hätte, was bei den Heldentenören
aber nie vorkommt, so hätte er es durch dir unmensch-
liche Höhe seiner Gage wieder erfahren.
Der allerweltöberühmte Kammersänger konnte
nämlich nicht — schwimmen, ja, er war geradezu
wasierscheu. Während einer Aufführung des „Flie-
genden Holländers" kam ihm diese Schwäche eines
Abendö zum ersten Male zum tragischen Bewußtsein.
Er hatte sich vorgeftellt: wenn diese Wellen und
Wogen aus bemalter Leinwand mit einem Male zu
wirklichem Waffer und Meer geworden wären, mit
Salzgeschmack, lausend Meter tief und mit neun
Grad Kälte — er wäre samt seinem hohen „C" ein
Mann des Todes geworden. . . . Das gab ihm zu
denken, und er dachte zum ersten Male tief nach,
tausend Meter in die Tiefe. Bewunderung und Ehr-
furcht hatte er von diesem Augenblick an für alle,
denen in solchen Lebenslagen Vertrautheit mit Waffer
gegeben war. „Was nützt mir meine goldene Kehle
und mein butterweicher Tonansah, und meine Gage,
wenn ich nicht schwimmen kann!" sagte er zu sich
selbst, als er in seiner Garderobe war und sich seine
Schminke und Berühmtheit aus dem Gesichte rieb.
Der Theaterfriseur, der ihm die Heldenbärte ins
Antlitz klebte, der konnte schwimmen. Stephan
erinnerte sich jetzt, wie ihm einst dieser gottbegnadete Mann erzählte, daß
er sogar einmal eine Katze aus dem Bach zog, eine Katze im Sack, und ihr
so das Leben rettete. . . . Und so lebenswahr und nah erschien dem
Heldcntenor nun wieder diese Begebenheit, so lebhaft versetzte er sich in
die Notlage des ertrinkenden Tieres, daß er plötzlich selbst glaubte, eine
Katze im Sack zu sein, das gurgelnde Waffer in feine Ohren laufen fühlte
— und auch schon mit Händen und Füßen um sich stieß und um Hilfe
schrie. . . .
Der Theaterfriseur, der gerade auf seinem Holzkopf eine Pagenperücke
auskämmte, glaubte zunächst, der Herr Kammersänger studiere eine neue
Rolle ein, aber da er sogar Schweiß auf seiner Stirne perlen sah, was
sonst bei Heldentenören nur selten vorkommt, da ahnte er Gefahr und
sprang auf den Künstler zu.
Der atmete sogleich befreit auf, als er rettende Hände nahe kommen
sah: „Sie Glücklicher", sagte er erschöpft, „Sie können schwimmen,
während ich ertrinken muß! . . ."
Da meinte der Theaterfriseur wieder bestimmt, daß er eine Rolle ein-
ftudiere — und ging zu seinem Holzkopfe mit der Pagenperücke zurück....
Seitdem glaubte sich der Heldentenor immer der Gefahr des Ertrinkens
nahe. Wenn er daheim in seine Waschschüssel sah,
dehnte er in Gedanken deren Fläche zu einem Meeres-
spiegel aus, auf dem ihn die Wellen hilflos hin und
her warfen. Am Stadtwaffer wagte er nur noch
während der Bachauskehr zu promenieren. Voll
Neid sah er im Aquarium den Goldfischen nach, und
er hätte am liebsten seine Stimme gegen Kiemen
vertauscht, hätte sich gern von Algen und Brotkrumen
ernährt, wenn er so hätte schwimmen können.
Er besuchte nun auch alle Veranstaltungen des
Schwimmvereins und wurde überall Ehrenmitglied.
Aber überall, wo sein Name laut wurde, lobten sie
seine Stimme und achteten seine Schwimmversuche
gering. Er, der so durch höhere Gaben begnadet
sei, habe so etwas, so eine gemeine Betätigung nicht
nötig. Einige meinten, er müsse mit seiner Seele
ja schon halb im Himmel wandeln, die Erde müßte
ihm schon fremd geworden sein, ihm, dem göttlichen
Sänger! . . . So sprachen sie, während er in
einer Badewanne die ersten Schwimmversuche unter-
nahm, die Beine nicht anzuziehen vermochte und
Waffer schluckte, mehr als rin Filtrierpapier.
Nach einem Jahr heißesten Bemühens in der
Badewanne glaubte sich der Heldentenor für gewag-
tere Wafferkünste herangercift. Er band sich einen
Korkgürtel um den Brustkorb, aus dem schon so viele
Male der Nibelungen Not erklungen war, der
Schwäne besang und heiliger Minne Leid und Freud.
So trat er Schritt für Schritt, wie Männer, die
zum Gashahn schreiten, an den Rand des Bassins,
in dem gewöhnlich Hunde und Kinder gebadet wurden.
Mit einer Flasche Kirschwaffer am Herzen ging
er, sich Mut suchend, am Wasserbehälter auf und
nieder. Wenn er oben war, freute er sich, wieder
nach unten gehen zu können. Und immer fand er
etwas, das Grund gab, den ersten Sprung in die
seichte Tiefe hinauszuschieben. Da schien ihm das
Waffer zu unruhig, dort schwamm eine alte Zeitung,
in deren Anzeigenteil er nicht hineinspringen wollte.
. . . Und dieser Sprung wollte sehr überlegt sein.
Er war entscheidend für Stephan NeuhierlS spätere
Zukunft. Gelang er, so war er fest entschlossen,
seine ruhmvolle Sängerlaufbahn aufzugeben, ja, dann
wollte er sich im Waffer fortbilden, um einmal selbst
Schwimmlehrer zu werden. Dieser Sprung war fürs
Leben wichtig wie ein Staatsexamen, ein Stellungs-
gesuch oder eine Heirat. . . .
Aber es war noch Zeit. Die Badeanstalt wurde
erst um 8 Uhr geschloffen, zu jenem Zeitpunkt, wo
auch die Oper anfing, in der er bei erhöhten Preisen
heute abend zu singen hatte. Und jetzt warS erst
drei Uhr nachmittags. . . . Die Sonne warf
glitzernde Halsbänder und Ohrringe auf den Wasser-
jpiegel, der frisch und grün wie eine Waldmrifter-
limonade ihm zu Füßen lag. Zwei Bademeister
warteten seines Winkes, der ihnen anzeigen sollte,
wann er geistig und körperlich zum letzten gewaltigen
Sprung seines Lebens bereit sei. . . .
Jetzt spazierte er zur Abwechslung auch auf der an-
deren Seite des Wassers auf und ab. Da aber gab
es eine Stelle, wo der Rand von Seife, Schmirgel
und Hühneraugentinkturen schlüpfrig geworden war.
(Jartsehung auf Seite 305.)
Fred Knab: Idyll
303