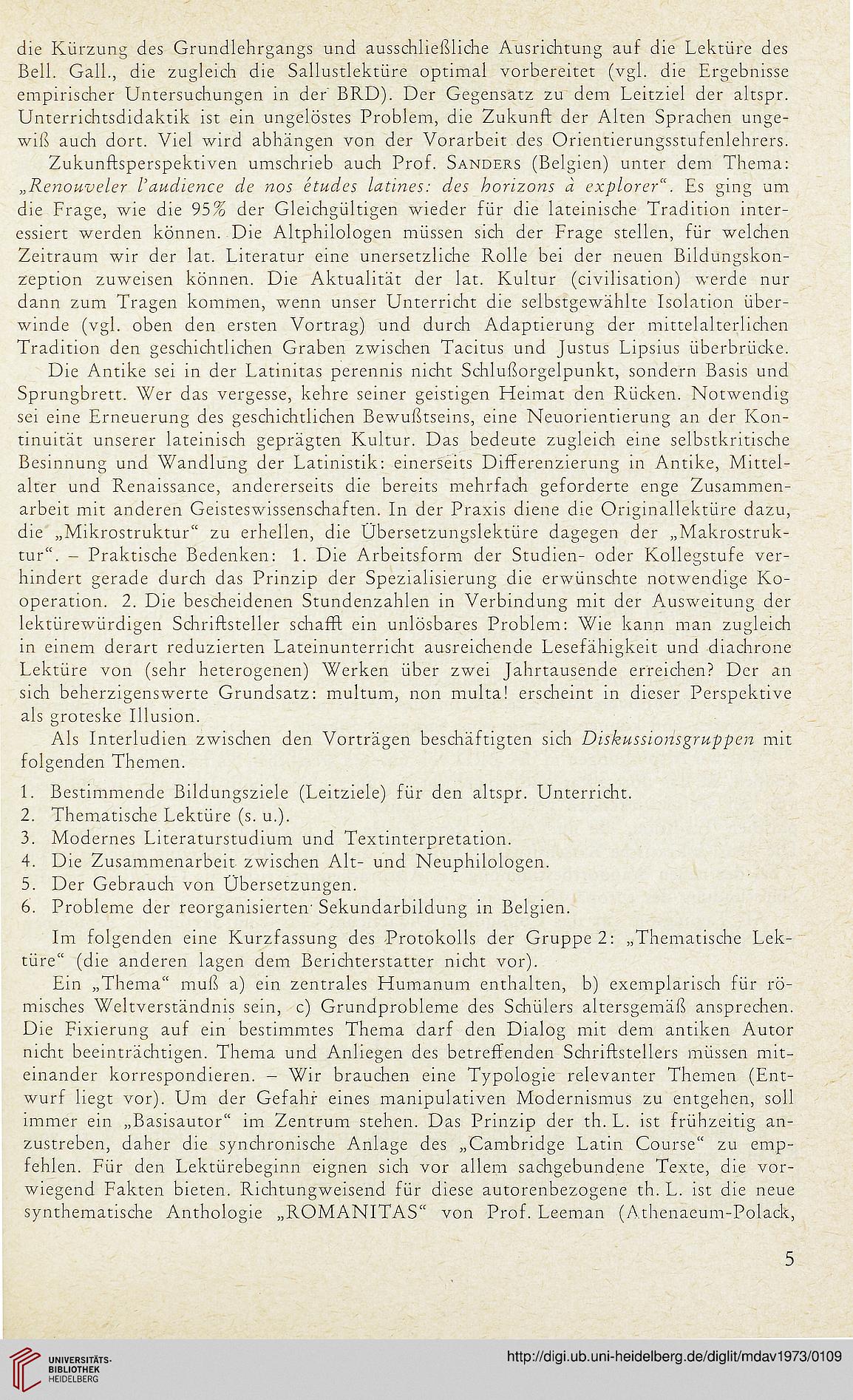die Kürzung des Grundlehrgangs und ausschließliche Ausrichtung auf die Lektüre des
Bell. Gail., die zugleich die Sallustlektüre optimal vorbereitet (vgl. die Ergebnisse
empirischer Untersuchungen in der BRD). Der Gegensatz zu dem Leitziel der altspr.
Unterrichtsdidaktik ist ein ungelöstes Problem, die Zukunft der Alten Sprachen unge-
wiß auch dort. Viel wird abhängen von der Vorarbeit des Orientierungsstufenlehrers.
Zukunftsperspektiven umschrieb auch Prof. Sanders (Belgien) unter dem Thema:
„Renouveler l’audience de nos etudes latines: des horizons a explorer“. Es ging um
die Frage, wie die 95% der Gleichgültigen wieder für die lateinische Tradition inter-
essiert werden können. Die Altphilologen müssen sich der Frage stellen, für welchen
Zeitraum wir der lat. Literatur eine unersetzliche Rolle bei der neuen Bildungskon-
zeption zuweisen können. Die Aktualität der lat. Kultur (civilisation) werde nur
dann zum Tragen kommen, wenn unser Unterricht die selbstgewählte Isolation über-
winde (vgl. oben den ersten Vortrag) und durch Adaptierung der mittelalterlichen
Tradition den geschichtlichen Graben zwischen Tacitus und Justus Lipsius überbrücke.
Die Antike sei in der Latmitas perennis nicht Schlußorgelpunkt, sondern Basis und
Sprungbrett. Wer das vergesse, kehre seiner geistigen Heimat den Rücken. Notwendig
sei eine Erneuerung des geschichtlichen Bewußtseins, eine Neuorientierung an der Kon-
tinuität unserer lateinisch geprägten Kultur. Das bedeute zugleich eine selbstkritische
Besinnung und Wandlung der Latinistik: einerseits Differenzierung in Antike, Mittel-
alter und Renaissance, andererseits die bereits mehrfach geforderte enge Zusammen-
arbeit mit anderen Geisteswissenschaften. In der Praxis diene die Originallektüre dazu,
die „Mikrostruktur“ zu erhellen, die Übersetzungslektüre dagegen der „Makrostruk-
tur“. - Praktische Bedenken: 1. Die Arbeitsform der Studien- oder Kollegstufe ver-
hindert gerade durch das Prinzip der Spezialisierung die erwünschte notwendige Ko-
operation. 2. Die bescheidenen Stundenzahlen in Verbindung mit der Ausweitung der
lektürewürdigen Schriftsteller schafft ein unlösbares Problem: Wie kann man zugleich
in einem derart reduzierten Lateinunterricht ausreichende Lesefähigkeit und diachrone
Lektüre von (sehr heterogenen) Werken über zwei Jahrtausende erreichen? Der an
sich beherzigenswerte Grundsatz: multum, non multa! erscheint in dieser Perspektive
als groteske Illusion.
Als Interludien zwischen den Vorträgen beschäftigten sich Diskussionsgruppen mit
folgenden Themen.
1. Bestimmende Bildungsziele (Leitziele) für den altspr. Unterricht.
2. Thematische Lektüre (s. u.).
3. Modernes Literaturstudium und Textinterpretation.
4. Die Zusammenarbeit zwischen Alt- und Neuphilologen.
5. Der Gebrauch von Übersetzungen.
6. Probleme der reorganisierten' Sekundarbildung in Belgien.
Im folgenden eine Kurzfassung des Protokolls der Gruppe 2: „Thematische Lek-
türe“ (die anderen lagen dem Berichterstatter nicht vor).
Ein „Thema“ muß a) ein zentrales Humanum enthalten, b) exemplarisch für rö-
misches Weltverständnis sein, c) Grundprobleme des Schülers altersgemäß ansprechen.
Die Fixierung auf ein bestimmtes Thema darf den Dialog mit dem antiken Autor
nicht beeinträchtigen. Thema und Anliegen des betreffenden Schriftstellers müssen mit-
einander korrespondieren. - Wir brauchen eine Typologie relevanter Themen (Ent-
wurf liegt vor). Um der Gefahr eines manipulativen Modernismus zu entgehen, soll
immer ein „Basisautor“ im Zentrum stehen. Das Prinzip der th. L. ist frühzeitig an-
zustreben, daher die synchronische Anlage des „Cambridge Latin Course“ zu emp-
fehlen. Für den Lektürebeginn eignen sich vor allem sachgebundene Texte, die vor-
wiegend Fakten bieten. Richtungweisend für diese autorenbezogene th. L. ist die neue
synthematische Anthologie „ROMANITAS“ von Prof. Leeman (A.thenaeum-Polack,
5
Bell. Gail., die zugleich die Sallustlektüre optimal vorbereitet (vgl. die Ergebnisse
empirischer Untersuchungen in der BRD). Der Gegensatz zu dem Leitziel der altspr.
Unterrichtsdidaktik ist ein ungelöstes Problem, die Zukunft der Alten Sprachen unge-
wiß auch dort. Viel wird abhängen von der Vorarbeit des Orientierungsstufenlehrers.
Zukunftsperspektiven umschrieb auch Prof. Sanders (Belgien) unter dem Thema:
„Renouveler l’audience de nos etudes latines: des horizons a explorer“. Es ging um
die Frage, wie die 95% der Gleichgültigen wieder für die lateinische Tradition inter-
essiert werden können. Die Altphilologen müssen sich der Frage stellen, für welchen
Zeitraum wir der lat. Literatur eine unersetzliche Rolle bei der neuen Bildungskon-
zeption zuweisen können. Die Aktualität der lat. Kultur (civilisation) werde nur
dann zum Tragen kommen, wenn unser Unterricht die selbstgewählte Isolation über-
winde (vgl. oben den ersten Vortrag) und durch Adaptierung der mittelalterlichen
Tradition den geschichtlichen Graben zwischen Tacitus und Justus Lipsius überbrücke.
Die Antike sei in der Latmitas perennis nicht Schlußorgelpunkt, sondern Basis und
Sprungbrett. Wer das vergesse, kehre seiner geistigen Heimat den Rücken. Notwendig
sei eine Erneuerung des geschichtlichen Bewußtseins, eine Neuorientierung an der Kon-
tinuität unserer lateinisch geprägten Kultur. Das bedeute zugleich eine selbstkritische
Besinnung und Wandlung der Latinistik: einerseits Differenzierung in Antike, Mittel-
alter und Renaissance, andererseits die bereits mehrfach geforderte enge Zusammen-
arbeit mit anderen Geisteswissenschaften. In der Praxis diene die Originallektüre dazu,
die „Mikrostruktur“ zu erhellen, die Übersetzungslektüre dagegen der „Makrostruk-
tur“. - Praktische Bedenken: 1. Die Arbeitsform der Studien- oder Kollegstufe ver-
hindert gerade durch das Prinzip der Spezialisierung die erwünschte notwendige Ko-
operation. 2. Die bescheidenen Stundenzahlen in Verbindung mit der Ausweitung der
lektürewürdigen Schriftsteller schafft ein unlösbares Problem: Wie kann man zugleich
in einem derart reduzierten Lateinunterricht ausreichende Lesefähigkeit und diachrone
Lektüre von (sehr heterogenen) Werken über zwei Jahrtausende erreichen? Der an
sich beherzigenswerte Grundsatz: multum, non multa! erscheint in dieser Perspektive
als groteske Illusion.
Als Interludien zwischen den Vorträgen beschäftigten sich Diskussionsgruppen mit
folgenden Themen.
1. Bestimmende Bildungsziele (Leitziele) für den altspr. Unterricht.
2. Thematische Lektüre (s. u.).
3. Modernes Literaturstudium und Textinterpretation.
4. Die Zusammenarbeit zwischen Alt- und Neuphilologen.
5. Der Gebrauch von Übersetzungen.
6. Probleme der reorganisierten' Sekundarbildung in Belgien.
Im folgenden eine Kurzfassung des Protokolls der Gruppe 2: „Thematische Lek-
türe“ (die anderen lagen dem Berichterstatter nicht vor).
Ein „Thema“ muß a) ein zentrales Humanum enthalten, b) exemplarisch für rö-
misches Weltverständnis sein, c) Grundprobleme des Schülers altersgemäß ansprechen.
Die Fixierung auf ein bestimmtes Thema darf den Dialog mit dem antiken Autor
nicht beeinträchtigen. Thema und Anliegen des betreffenden Schriftstellers müssen mit-
einander korrespondieren. - Wir brauchen eine Typologie relevanter Themen (Ent-
wurf liegt vor). Um der Gefahr eines manipulativen Modernismus zu entgehen, soll
immer ein „Basisautor“ im Zentrum stehen. Das Prinzip der th. L. ist frühzeitig an-
zustreben, daher die synchronische Anlage des „Cambridge Latin Course“ zu emp-
fehlen. Für den Lektürebeginn eignen sich vor allem sachgebundene Texte, die vor-
wiegend Fakten bieten. Richtungweisend für diese autorenbezogene th. L. ist die neue
synthematische Anthologie „ROMANITAS“ von Prof. Leeman (A.thenaeum-Polack,
5