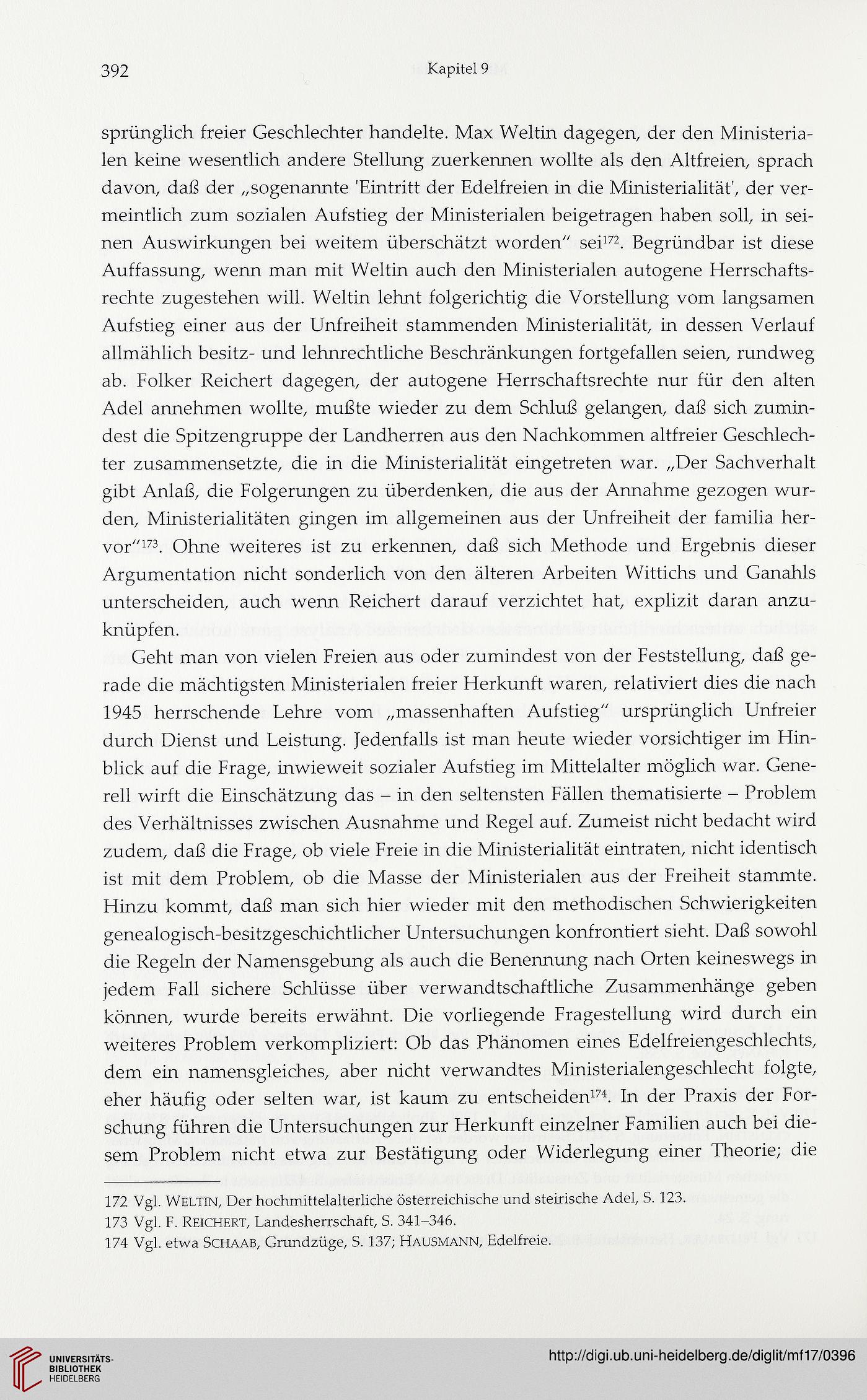392
Kapitel 9
sprünglich freier Geschlechter handelte. Max Weltin dagegen, der den Ministeria-
len keine wesentlich andere Stellung zuerkennen wollte als den Altfreien, sprach
davon, daß der „sogenannte 'Eintritt der Edelfreien in die Ministerialität', der ver-
meintlich zum sozialen Aufstieg der Ministerialen beigetragen haben soll, in sei-
nen Auswirkungen bei weitem überschätzt worden" seüA Begründbar ist diese
Auffassung, wenn man mit Weltin auch den Ministerialen autogene Herrschafts-
rechte zugestehen will. Weltin lehnt folgerichtig die Vorstellung vom langsamen
Aufstieg einer aus der Unfreiheit stammenden Ministerialität, in dessen Verlauf
allmählich besitz- und lehnrechtliche Beschränkungen fortgefallen seien, rundweg
ab. Folker Reichert dagegen, der autogene Herrschaftsrechte nur für den alten
Adel annehmen wollte, mußte wieder zu dem Schluß gelangen, daß sich zumin-
dest die Spitzengruppe der Landherren aus den Nachkommen altfreier Geschlech-
ter zusammensetzte, die in die Ministerialität eingetreten war. „Der Sachverhalt
gibt Anlaß, die Folgerungen zu überdenken, die aus der Annahme gezogen wur-
den, Ministerialitäten gingen im allgemeinen aus der Unfreiheit der familia her-
vor"iA Ohne weiteres ist zu erkennen, daß sich Methode und Ergebnis dieser
Argumentation nicht sonderlich von den älteren Arbeiten Wittichs und Ganahls
unterscheiden, auch wenn Reichert darauf verzichtet hat, explizit daran anzu-
knüpfen.
Geht man von vielen Freien aus oder zumindest von der Feststellung, daß ge-
rade die mächtigsten Ministerialen freier Herkunft waren, relativiert dies die nach
1945 herrschende Lehre vom „massenhaften Aufstieg" ursprünglich Unfreier
durch Dienst und Leistung. Jedenfalls ist man heute wieder vorsichtiger im Hin-
blick auf die Frage, inwieweit sozialer Aufstieg im Mittelalter möglich war. Gene-
rell wirft die Einschätzung das - in den seltensten Fällen thematisierte - Problem
des Verhältnisses zwischen Ausnahme und Regel auf. Zumeist nicht bedacht wird
zudem, daß die Frage, ob viele Freie in die Ministerialität eintraten, nicht identisch
ist mit dem Problem, ob die Masse der Ministerialen aus der Freiheit stammte.
Hinzu kommt, daß man sich hier wieder mit den methodischen Schwierigkeiten
genealogisch-besitzgeschichtlicher Untersuchungen konfrontiert sieht. Daß sowohl
die Regeln der Namensgebung als auch die Benennung nach Orten keineswegs in
jedem Fall sichere Schlüsse über verwandtschaftliche Zusammenhänge geben
können, wurde bereits erwähnt. Die vorliegende Fragestellung wird durch ein
weiteres Problem verkompliziert: Ob das Phänomen eines Edelfreiengeschlechts,
dem ein namensgleiches, aber nicht verwandtes Ministerialengeschlecht folgte,
eher häufig oder selten war, ist kaum zu entscheiden^. In der Praxis der For-
schung führen die Untersuchungen zur Herkunft einzelner Familien auch bei die-
sem Problem nicht etwa zur Bestätigung oder Widerlegung einer Theorie; die
172 Vgl. WELTIN, Der hochmittelalterliche österreichische und steirische Adel, S. 123.
173 Vgl. F. REICHERT, Landesherrschaft, S. 341-346.
174 Vgl. etwa SCHAAB, Grundzüge, S. 137; HAUSMANN, Edelfreie.
Kapitel 9
sprünglich freier Geschlechter handelte. Max Weltin dagegen, der den Ministeria-
len keine wesentlich andere Stellung zuerkennen wollte als den Altfreien, sprach
davon, daß der „sogenannte 'Eintritt der Edelfreien in die Ministerialität', der ver-
meintlich zum sozialen Aufstieg der Ministerialen beigetragen haben soll, in sei-
nen Auswirkungen bei weitem überschätzt worden" seüA Begründbar ist diese
Auffassung, wenn man mit Weltin auch den Ministerialen autogene Herrschafts-
rechte zugestehen will. Weltin lehnt folgerichtig die Vorstellung vom langsamen
Aufstieg einer aus der Unfreiheit stammenden Ministerialität, in dessen Verlauf
allmählich besitz- und lehnrechtliche Beschränkungen fortgefallen seien, rundweg
ab. Folker Reichert dagegen, der autogene Herrschaftsrechte nur für den alten
Adel annehmen wollte, mußte wieder zu dem Schluß gelangen, daß sich zumin-
dest die Spitzengruppe der Landherren aus den Nachkommen altfreier Geschlech-
ter zusammensetzte, die in die Ministerialität eingetreten war. „Der Sachverhalt
gibt Anlaß, die Folgerungen zu überdenken, die aus der Annahme gezogen wur-
den, Ministerialitäten gingen im allgemeinen aus der Unfreiheit der familia her-
vor"iA Ohne weiteres ist zu erkennen, daß sich Methode und Ergebnis dieser
Argumentation nicht sonderlich von den älteren Arbeiten Wittichs und Ganahls
unterscheiden, auch wenn Reichert darauf verzichtet hat, explizit daran anzu-
knüpfen.
Geht man von vielen Freien aus oder zumindest von der Feststellung, daß ge-
rade die mächtigsten Ministerialen freier Herkunft waren, relativiert dies die nach
1945 herrschende Lehre vom „massenhaften Aufstieg" ursprünglich Unfreier
durch Dienst und Leistung. Jedenfalls ist man heute wieder vorsichtiger im Hin-
blick auf die Frage, inwieweit sozialer Aufstieg im Mittelalter möglich war. Gene-
rell wirft die Einschätzung das - in den seltensten Fällen thematisierte - Problem
des Verhältnisses zwischen Ausnahme und Regel auf. Zumeist nicht bedacht wird
zudem, daß die Frage, ob viele Freie in die Ministerialität eintraten, nicht identisch
ist mit dem Problem, ob die Masse der Ministerialen aus der Freiheit stammte.
Hinzu kommt, daß man sich hier wieder mit den methodischen Schwierigkeiten
genealogisch-besitzgeschichtlicher Untersuchungen konfrontiert sieht. Daß sowohl
die Regeln der Namensgebung als auch die Benennung nach Orten keineswegs in
jedem Fall sichere Schlüsse über verwandtschaftliche Zusammenhänge geben
können, wurde bereits erwähnt. Die vorliegende Fragestellung wird durch ein
weiteres Problem verkompliziert: Ob das Phänomen eines Edelfreiengeschlechts,
dem ein namensgleiches, aber nicht verwandtes Ministerialengeschlecht folgte,
eher häufig oder selten war, ist kaum zu entscheiden^. In der Praxis der For-
schung führen die Untersuchungen zur Herkunft einzelner Familien auch bei die-
sem Problem nicht etwa zur Bestätigung oder Widerlegung einer Theorie; die
172 Vgl. WELTIN, Der hochmittelalterliche österreichische und steirische Adel, S. 123.
173 Vgl. F. REICHERT, Landesherrschaft, S. 341-346.
174 Vgl. etwa SCHAAB, Grundzüge, S. 137; HAUSMANN, Edelfreie.