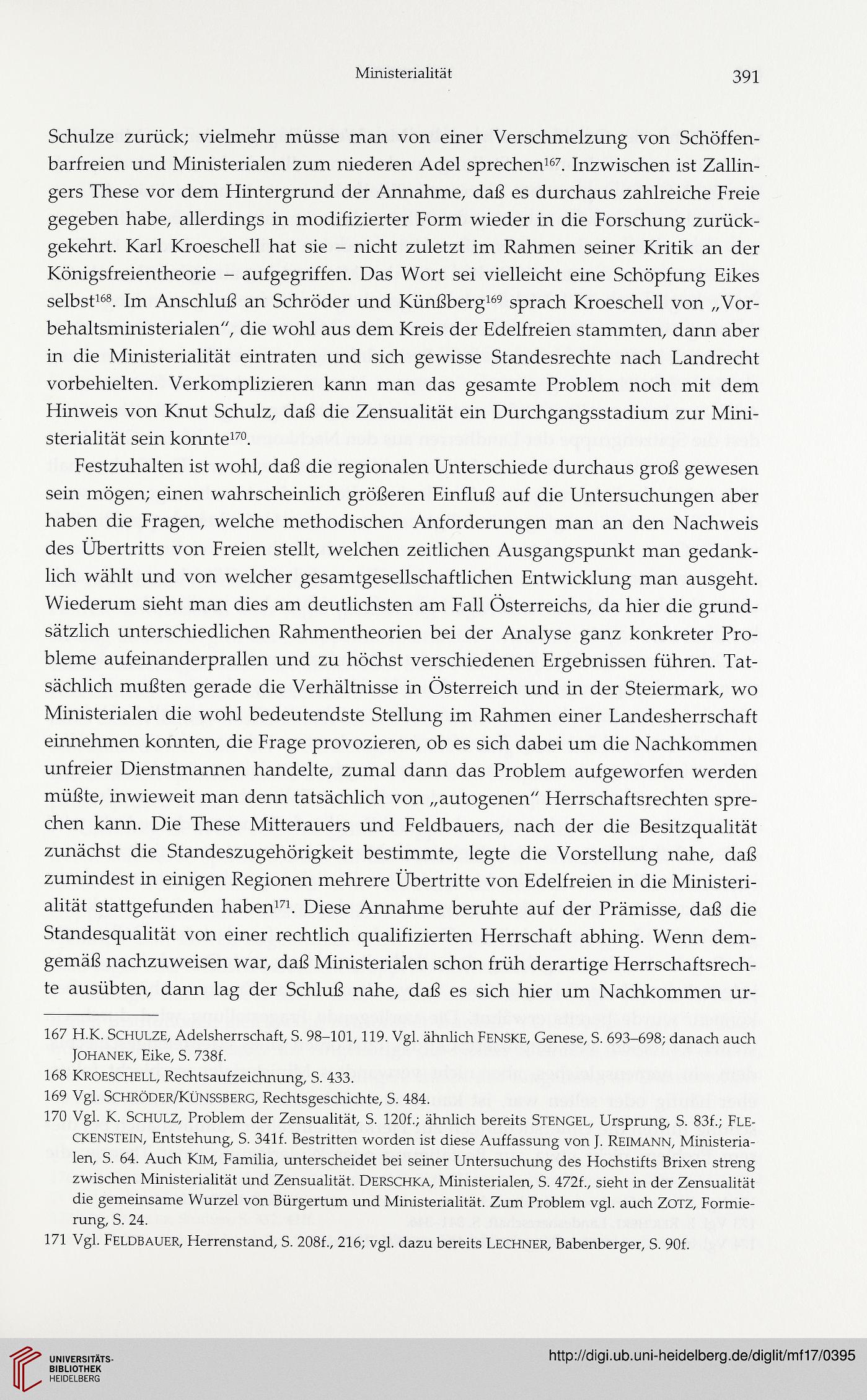Ministerialität
391
Schulze zurück; vielmehr müsse man von einer Verschmelzung von Schöffen-
barfreien und Ministerialen zum niederen Adel sprechen^?. Inzwischen ist Zallin-
gers These vor dem Hintergrund der Annahme, daß es durchaus zahlreiche Freie
gegeben habe, allerdings in modifizierter Form wieder in die Forschung zurück-
gekehrt. Karl Kroeschell hat sie - nicht zuletzt im Rahmen seiner Kritik an der
Königsfreientheorie - aufgegriffen. Das Wort sei vielleicht eine Schöpfung Eikes
selbst^. Im Anschluß an Schröder und Künßbergi^ sprach Kroeschell von „Vor-
behaltsministerialen", die wohl aus dem Kreis der Edelfreien stammten, dann aber
in die Ministerialität eintraten und sich gewisse Standesrechte nach Landrecht
vorbehielten. Verkomplizieren kann man das gesamte Problem noch mit dem
Hinweis von Knut Schulz, daß die Zensualität ein Durchgangsstadium zur Mini-
sterialität sein konnte^".
Festzuhalten ist wohl, daß die regionalen Unterschiede durchaus groß gewesen
sein mögen; einen wahrscheinlich größeren Einfluß auf die Untersuchungen aber
haben die Fragen, welche methodischen Anforderungen man an den Nachweis
des Übertritts von Freien stellt, welchen zeitlichen Ausgangspunkt man gedank-
lich wählt und von welcher gesamtgesellschaftlichen Entwicklung man ausgeht.
Wiederum sieht man dies am deutlichsten am Fall Österreichs, da hier die grund-
sätzlich unterschiedlichen Rahmentheorien bei der Analyse ganz konkreter Pro-
bleme aufeinanderprallen und zu höchst verschiedenen Ergebnissen führen. Tat-
sächlich mußten gerade die Verhältnisse in Österreich und in der Steiermark, wo
Ministerialen die wohl bedeutendste Stellung im Rahmen einer Landesherrschaft
einnehmen konnten, die Frage provozieren, ob es sich dabei um die Nachkommen
unfreier Dienstmannen handelte, zumal dann das Problem aufgeworfen werden
müßte, inwieweit man denn tatsächlich von „autogenen" Herrschaftsrechten spre-
chen kann. Die These Mitterauers und Feldbauers, nach der die Besitzqualität
zunächst die Standeszugehörigkeit bestimmte, legte die Vorstellung nahe, daß
zumindest in einigen Regionen mehrere Übertritte von Edelfreien in die Ministeri-
alität stattgefunden habend Diese Annahme beruhte auf der Prämisse, daß die
Standesqualität von einer rechtlich qualifizierten Herrschaft abhing. Wenn dem-
gemäß nachzuweisen war, daß Ministerialen schon früh derartige Herrschaftsrech-
te ausübten, dann lag der Schluß nahe, daß es sich hier um Nachkommen ur-
167 H.K. SCHULZE, Adelsherrschaft, S. 98-101,119. Vgl. ähnlich FENSKE, Genese, S. 693-698; danach auch
JOHANEK, Eike, S. 738f.
168 KROESCHELL, Rechtsaufzeichnung, S. 433.
169 Vgl. SCHRÖDER/KÜNSSBERG, Rechtsgeschichte, S. 484.
170 Vgl. K. SCHULZ, Problem der Zensualität, S. 120f.; ähnlich bereits STENGEL, Ursprung, S. 83f.; FLE-
CKENSTEIN, Entstehung, S. 341f. Bestritten worden ist diese Auffassung von J. REIMANN, Ministeria-
len, S. 64. Auch KlM, Familia, unterscheidet bei seiner Untersuchung des Hochstifts Brixen streng
zwischen Ministerialität und Zensualität. DERSCHKA, Ministerialen, S. 472f., sieht in der Zensualität
die gemeinsame Wurzel von Bürgertum und Ministerialität. Zum Problem vgl. auch ZOTZ, Formie-
rung, S. 24.
171 Vgl. FELDBAUER, Herrenstand, S. 208f., 216; vgl. dazu bereits LECHNER, Babenberger, S. 90f.
391
Schulze zurück; vielmehr müsse man von einer Verschmelzung von Schöffen-
barfreien und Ministerialen zum niederen Adel sprechen^?. Inzwischen ist Zallin-
gers These vor dem Hintergrund der Annahme, daß es durchaus zahlreiche Freie
gegeben habe, allerdings in modifizierter Form wieder in die Forschung zurück-
gekehrt. Karl Kroeschell hat sie - nicht zuletzt im Rahmen seiner Kritik an der
Königsfreientheorie - aufgegriffen. Das Wort sei vielleicht eine Schöpfung Eikes
selbst^. Im Anschluß an Schröder und Künßbergi^ sprach Kroeschell von „Vor-
behaltsministerialen", die wohl aus dem Kreis der Edelfreien stammten, dann aber
in die Ministerialität eintraten und sich gewisse Standesrechte nach Landrecht
vorbehielten. Verkomplizieren kann man das gesamte Problem noch mit dem
Hinweis von Knut Schulz, daß die Zensualität ein Durchgangsstadium zur Mini-
sterialität sein konnte^".
Festzuhalten ist wohl, daß die regionalen Unterschiede durchaus groß gewesen
sein mögen; einen wahrscheinlich größeren Einfluß auf die Untersuchungen aber
haben die Fragen, welche methodischen Anforderungen man an den Nachweis
des Übertritts von Freien stellt, welchen zeitlichen Ausgangspunkt man gedank-
lich wählt und von welcher gesamtgesellschaftlichen Entwicklung man ausgeht.
Wiederum sieht man dies am deutlichsten am Fall Österreichs, da hier die grund-
sätzlich unterschiedlichen Rahmentheorien bei der Analyse ganz konkreter Pro-
bleme aufeinanderprallen und zu höchst verschiedenen Ergebnissen führen. Tat-
sächlich mußten gerade die Verhältnisse in Österreich und in der Steiermark, wo
Ministerialen die wohl bedeutendste Stellung im Rahmen einer Landesherrschaft
einnehmen konnten, die Frage provozieren, ob es sich dabei um die Nachkommen
unfreier Dienstmannen handelte, zumal dann das Problem aufgeworfen werden
müßte, inwieweit man denn tatsächlich von „autogenen" Herrschaftsrechten spre-
chen kann. Die These Mitterauers und Feldbauers, nach der die Besitzqualität
zunächst die Standeszugehörigkeit bestimmte, legte die Vorstellung nahe, daß
zumindest in einigen Regionen mehrere Übertritte von Edelfreien in die Ministeri-
alität stattgefunden habend Diese Annahme beruhte auf der Prämisse, daß die
Standesqualität von einer rechtlich qualifizierten Herrschaft abhing. Wenn dem-
gemäß nachzuweisen war, daß Ministerialen schon früh derartige Herrschaftsrech-
te ausübten, dann lag der Schluß nahe, daß es sich hier um Nachkommen ur-
167 H.K. SCHULZE, Adelsherrschaft, S. 98-101,119. Vgl. ähnlich FENSKE, Genese, S. 693-698; danach auch
JOHANEK, Eike, S. 738f.
168 KROESCHELL, Rechtsaufzeichnung, S. 433.
169 Vgl. SCHRÖDER/KÜNSSBERG, Rechtsgeschichte, S. 484.
170 Vgl. K. SCHULZ, Problem der Zensualität, S. 120f.; ähnlich bereits STENGEL, Ursprung, S. 83f.; FLE-
CKENSTEIN, Entstehung, S. 341f. Bestritten worden ist diese Auffassung von J. REIMANN, Ministeria-
len, S. 64. Auch KlM, Familia, unterscheidet bei seiner Untersuchung des Hochstifts Brixen streng
zwischen Ministerialität und Zensualität. DERSCHKA, Ministerialen, S. 472f., sieht in der Zensualität
die gemeinsame Wurzel von Bürgertum und Ministerialität. Zum Problem vgl. auch ZOTZ, Formie-
rung, S. 24.
171 Vgl. FELDBAUER, Herrenstand, S. 208f., 216; vgl. dazu bereits LECHNER, Babenberger, S. 90f.