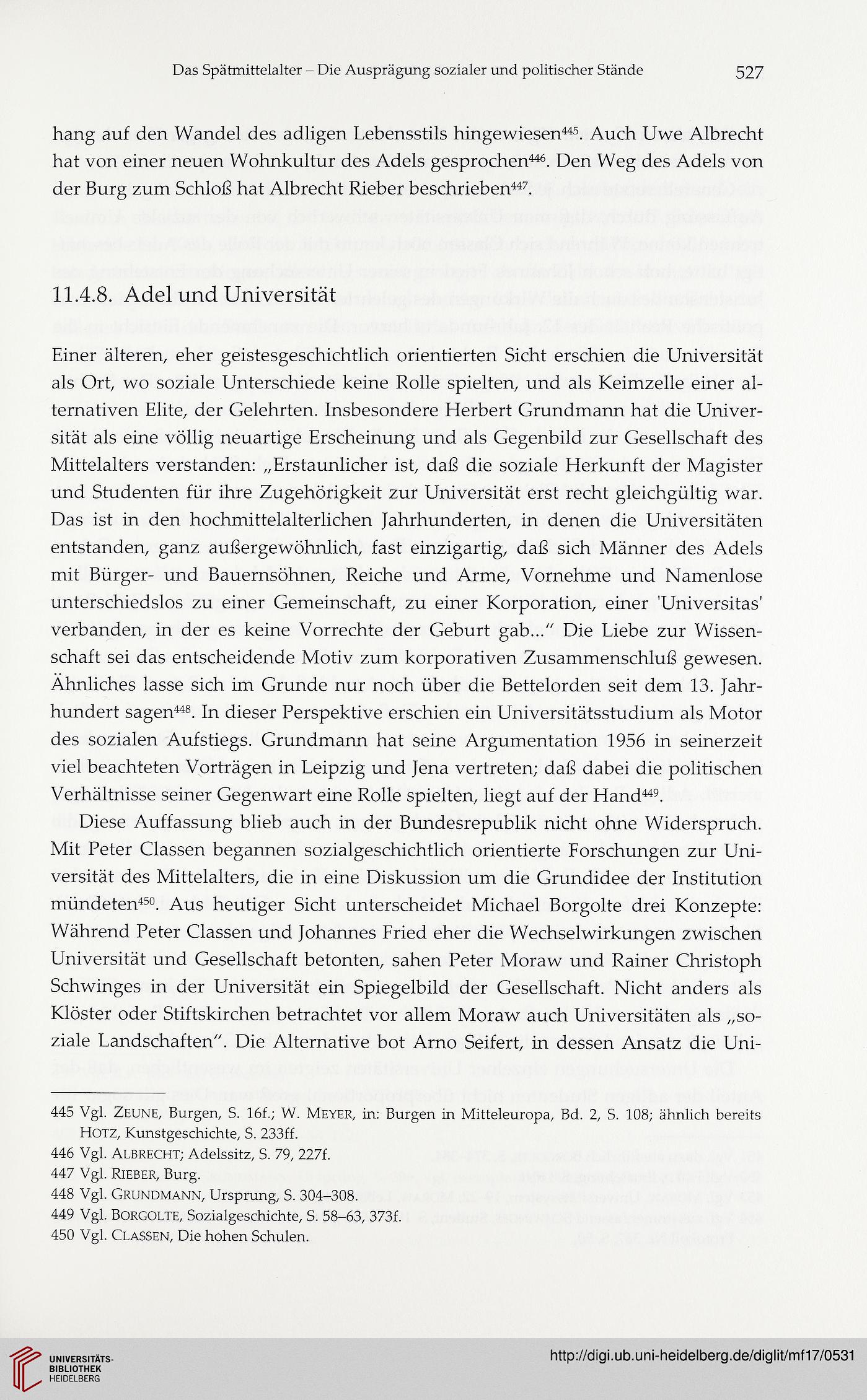527
hang auf den Wandel des adligen Lebensstils hingewiesen^h Auch Uwe Albrecht
hat von einer neuen Wohnkultur des Adels gesprochen^. Den Weg des Adels von
der Burg zum Schloß hat Albrecht Rieber beschrieben^.
11.4.8. Adel und Universität
Einer älteren, eher geistesgeschichtlich orientierten Sicht erschien die Universität
als Ort, wo soziale Unterschiede keine Rolle spielten, und als Keimzelle einer al-
ternativen Elite, der Gelehrten. Insbesondere Herbert Grundmann hat die Univer-
sität als eine völlig neuartige Erscheinung und als Gegenbild zur Gesellschaft des
Mittelalters verstanden: „Erstaunlicher ist, daß die soziale Herkunft der Magister
und Studenten für ihre Zugehörigkeit zur Universität erst recht gleichgültig war.
Das ist in den hochmittelalterlichen Jahrhunderten, in denen die Universitäten
entstanden, ganz außergewöhnlich, fast einzigartig, daß sich Männer des Adels
mit Bürger- und Bauernsöhnen, Reiche und Arme, Vornehme und Namenlose
unterschiedslos zu einer Gemeinschaft, zu einer Korporation, einer 'Universitas'
verbanden, in der es keine Vorrechte der Geburt gab..." Die Liebe zur Wissen-
schaft sei das entscheidende Motiv zum korporativen Zusammenschluß gewesen.
Ähnliches lasse sich im Grunde nur noch über die Bettelorden seit dem 13. Jahr-
hundert sagend In dieser Perspektive erschien ein Universitätsstudium als Motor
des sozialen Aufstiegs. Grundmann hat seine Argumentation 1956 in seinerzeit
viel beachteten Vorträgen in Leipzig und Jena vertreten; daß dabei die politischen
Verhältnisse seiner Gegenwart eine Rolle spielten, liegt auf der Hand^h
Diese Auffassung blieb auch in der Bundesrepublik nicht ohne Widerspruch.
Mit Peter Classen begannen sozialgeschichtlich orientierte Forschungen zur Uni-
versität des Mittelalters, die in eine Diskussion um die Grundidee der Institution
mündeten^. Aus heutiger Sicht unterscheidet Michael Borgolte drei Konzepte:
Während Peter Classen und Johannes Fried eher die Wechselwirkungen zwischen
Universität und Gesellschaft betonten, sahen Peter Moraw und Rainer Christoph
Schwinges in der Universität ein Spiegelbild der Gesellschaft. Nicht anders als
Klöster oder Stiftskirchen betrachtet vor allem Moraw auch Universitäten als „so-
ziale Landschaften". Die Alternative bot Arno Seifert, in dessen Ansatz die Uni-
445 Vgl. ZEUNE, Burgen, S. 16f.; W. MEYER, in: Burgen in Mitteleuropa, Bd. 2, S. 108; ähnlich bereits
HOTZ, Kunstgeschichte, S. 233fi.
446 Vgl. ALBRECHT; Adelssitz, S. 79, 227f.
447 Vgl. RiEBER, Burg.
448 Vgl. GRUNDMANN, Ursprung, S. 304-308.
449 Vgl. BORGOLTE, Sozialgeschichte, S. 58-63, 373f.
450 Vgl. CLASSEN, Die hohen Schulen.