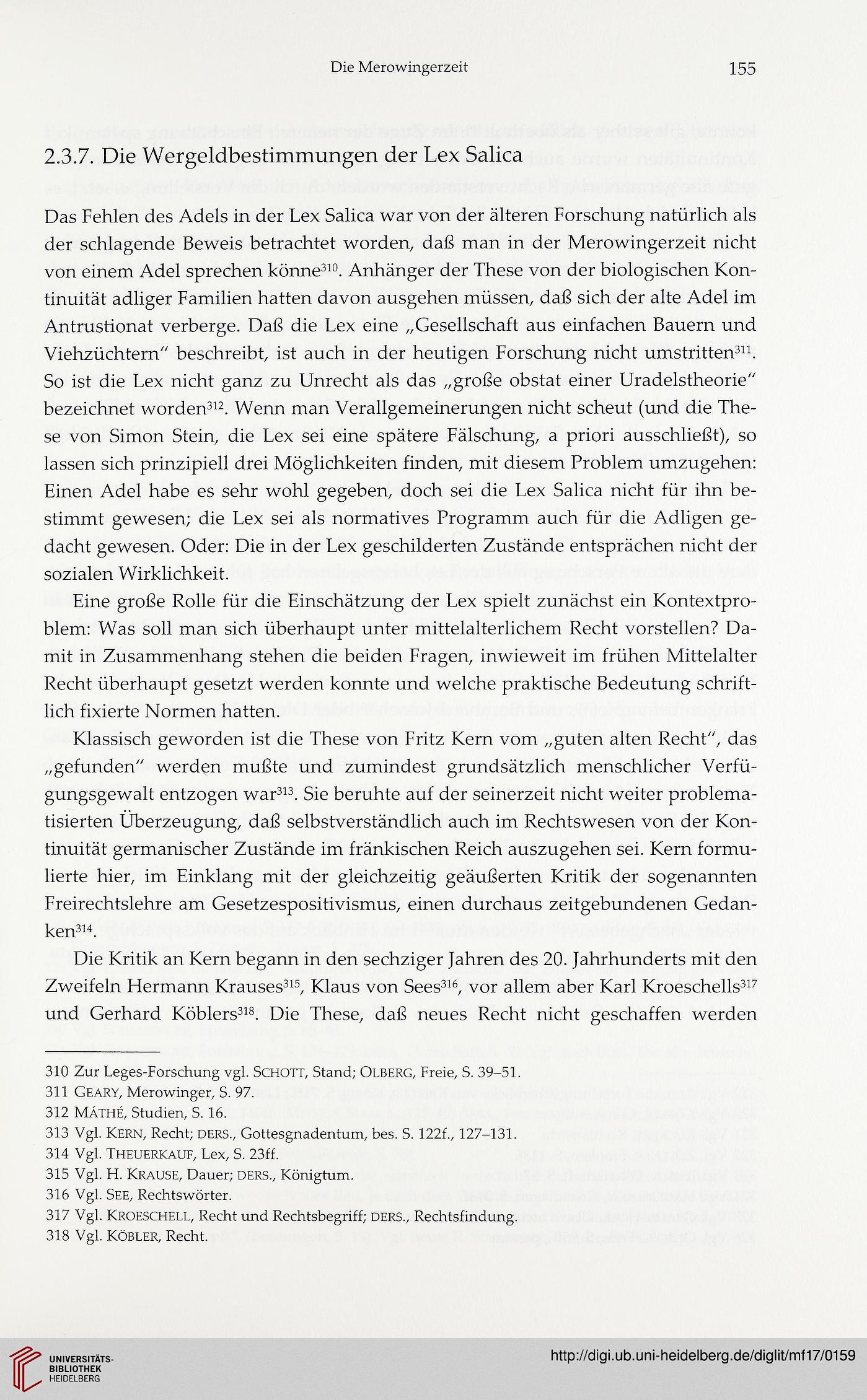Die Merowingerzeit
155
2.3.7. Die Wergeidbestimmungen der Lex Salica
Das Fehlen des Adels in der Lex Salica war von der älteren Forschung natürlich als
der schlagende Beweis betrachtet worden, daß man in der Merowingerzeit nicht
von einem Adel sprechen kömWA Anhänger der These von der biologischen Kon-
tinuität adliger Familien hatten davon ausgehen müssen, daß sich der alte Adel im
Antrustionat verberge. Daß die Lex eine „Gesellschaft aus einfachen Bauern und
Viehzüchtern" beschreibt, ist auch in der heutigen Forschung nicht umstritten^.
So ist die Lex nicht ganz zu Unrecht als das „große obstat einer Uradelstheorie"
bezeichnet worden^. Wenn man Verallgemeinerungen nicht scheut (und die The-
se von Simon Stein, die Lex sei eine spätere Fälschung, a priori ausschließt), so
lassen sich prinzipiell drei Möglichkeiten finden, mit diesem Problem umzugehen:
Einen Adel habe es sehr wohl gegeben, doch sei die Lex Salica nicht für ihn be-
stimmt gewesen; die Lex sei als normatives Programm auch für die Adligen ge-
dacht gewesen. Oder: Die in der Lex geschilderten Zustände entsprächen nicht der
sozialen Wirklichkeit.
Eine große Rolle für die Einschätzung der Lex spielt zunächst ein Kontextpro-
blem: Was soll man sich überhaupt unter mittelalterlichem Recht vorstellen? Da-
mit in Zusammenhang stehen die beiden Fragen, inwieweit im frühen Mittelalter
Recht überhaupt gesetzt werden konnte und welche praktische Bedeutung schrift-
lich fixierte Normen hatten.
Klassisch geworden ist die TTtese von Fritz Kern vom „guten alten Recht", das
„gefunden" werden mußte und zumindest grundsätzlich menschlicher Verfü-
gungsgewalt entzogen waDA Sie beruhte auf der seinerzeit nicht weiter problema-
tisierten Überzeugung, daß selbstverständlich auch im Rechtswesen von der Kon-
tinuität germanischer Zustände im fränkischen Reich auszugehen sei. Kern formu-
lierte hier, im Einklang mit der gleichzeitig geäußerten Kritik der sogenannten
Freirechtslehre am Gesetzespositivismus, einen durchaus zeitgebundenen Gedan-
ken^.
Die Kritik an Kern begann in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit den
Zweifeln Hermann Krauses^^ Klaus von Sees^^, vor allem aber Karl Kroeschells^?
und Gerhard Köblers^A Die These, daß neues Recht nicht geschaffen werden
310 Zur Leges-Forschung vgl. SCHOTT, Stand; OLBERG, Freie, S. 39-51.
311 GEARY, Merowinger, S. 97.
312 MÄTHE, Studien, S. 16.
313 Vgl. KERN, Recht; DERS., Gottesgnadentum, bes. S. 122f., 127-131.
314 Vgl. THEUERKAUF, Lex, S. 23ff.
315 Vgl. H. KRAUSE, Dauer; DERS., Königtum.
316 Vgl. SEE, Rechtswörter.
317 Vgl. KROESCHELL, Recht und Rechtsbegriff; DERS., Rechtsfindung.
318 Vgl. KÖBLER, Recht.
155
2.3.7. Die Wergeidbestimmungen der Lex Salica
Das Fehlen des Adels in der Lex Salica war von der älteren Forschung natürlich als
der schlagende Beweis betrachtet worden, daß man in der Merowingerzeit nicht
von einem Adel sprechen kömWA Anhänger der These von der biologischen Kon-
tinuität adliger Familien hatten davon ausgehen müssen, daß sich der alte Adel im
Antrustionat verberge. Daß die Lex eine „Gesellschaft aus einfachen Bauern und
Viehzüchtern" beschreibt, ist auch in der heutigen Forschung nicht umstritten^.
So ist die Lex nicht ganz zu Unrecht als das „große obstat einer Uradelstheorie"
bezeichnet worden^. Wenn man Verallgemeinerungen nicht scheut (und die The-
se von Simon Stein, die Lex sei eine spätere Fälschung, a priori ausschließt), so
lassen sich prinzipiell drei Möglichkeiten finden, mit diesem Problem umzugehen:
Einen Adel habe es sehr wohl gegeben, doch sei die Lex Salica nicht für ihn be-
stimmt gewesen; die Lex sei als normatives Programm auch für die Adligen ge-
dacht gewesen. Oder: Die in der Lex geschilderten Zustände entsprächen nicht der
sozialen Wirklichkeit.
Eine große Rolle für die Einschätzung der Lex spielt zunächst ein Kontextpro-
blem: Was soll man sich überhaupt unter mittelalterlichem Recht vorstellen? Da-
mit in Zusammenhang stehen die beiden Fragen, inwieweit im frühen Mittelalter
Recht überhaupt gesetzt werden konnte und welche praktische Bedeutung schrift-
lich fixierte Normen hatten.
Klassisch geworden ist die TTtese von Fritz Kern vom „guten alten Recht", das
„gefunden" werden mußte und zumindest grundsätzlich menschlicher Verfü-
gungsgewalt entzogen waDA Sie beruhte auf der seinerzeit nicht weiter problema-
tisierten Überzeugung, daß selbstverständlich auch im Rechtswesen von der Kon-
tinuität germanischer Zustände im fränkischen Reich auszugehen sei. Kern formu-
lierte hier, im Einklang mit der gleichzeitig geäußerten Kritik der sogenannten
Freirechtslehre am Gesetzespositivismus, einen durchaus zeitgebundenen Gedan-
ken^.
Die Kritik an Kern begann in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit den
Zweifeln Hermann Krauses^^ Klaus von Sees^^, vor allem aber Karl Kroeschells^?
und Gerhard Köblers^A Die These, daß neues Recht nicht geschaffen werden
310 Zur Leges-Forschung vgl. SCHOTT, Stand; OLBERG, Freie, S. 39-51.
311 GEARY, Merowinger, S. 97.
312 MÄTHE, Studien, S. 16.
313 Vgl. KERN, Recht; DERS., Gottesgnadentum, bes. S. 122f., 127-131.
314 Vgl. THEUERKAUF, Lex, S. 23ff.
315 Vgl. H. KRAUSE, Dauer; DERS., Königtum.
316 Vgl. SEE, Rechtswörter.
317 Vgl. KROESCHELL, Recht und Rechtsbegriff; DERS., Rechtsfindung.
318 Vgl. KÖBLER, Recht.