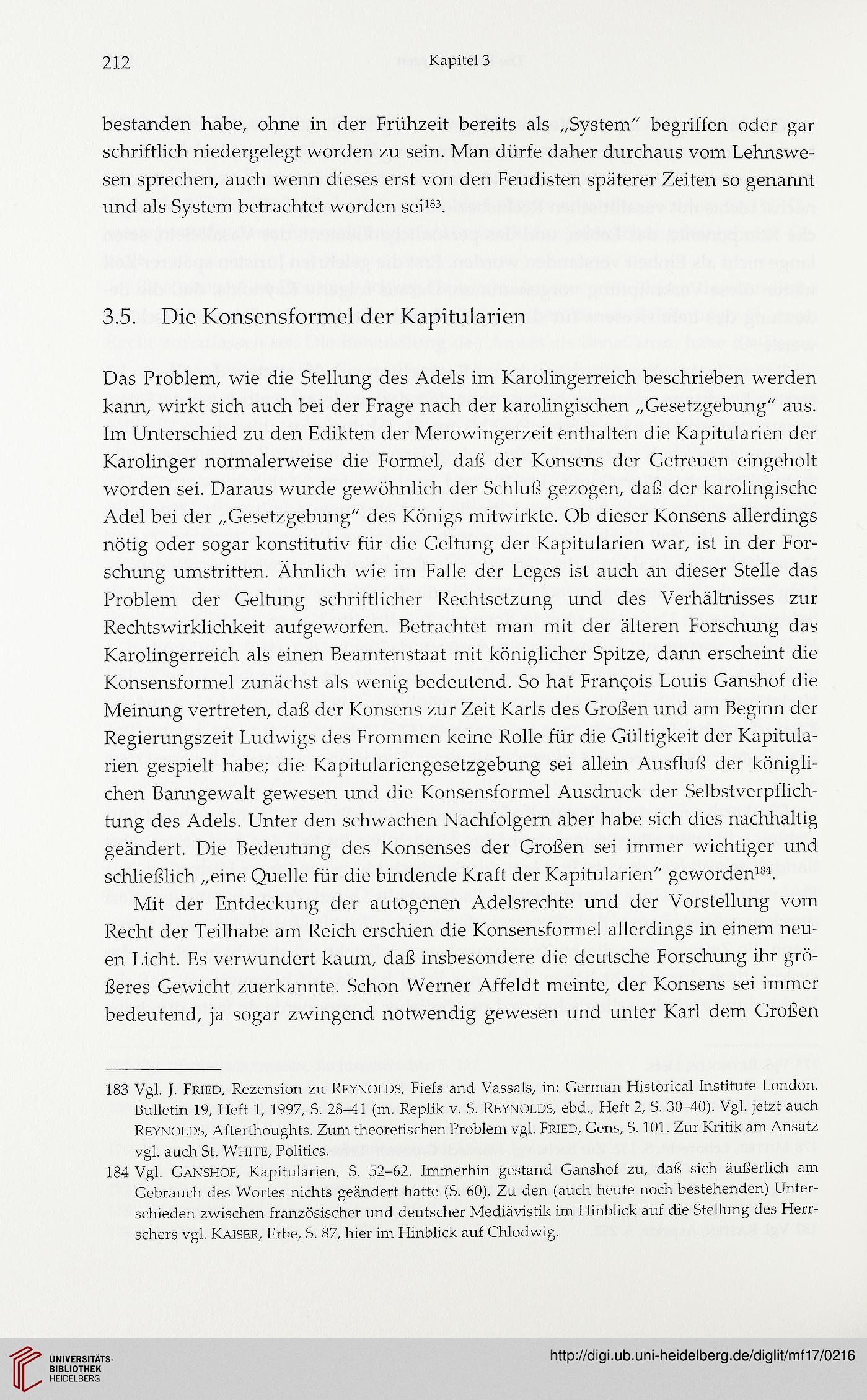212
Kapitel 3
bestanden habe, ohne in der Frühzeit bereits als „System" begriffen oder gar
schriftlich niedergelegt worden zu sein. Man dürfe daher durchaus vom Lehnswe-
sen sprechen, auch wenn dieses erst von den Feudisten späterer Zeiten so genannt
und als System betrachtet worden seiW
3.5. Die Konsensformel der Kapitularien
Das Problem, wie die Stellung des Adels im Karolingerreich beschrieben werden
kann, wirkt sich auch bei der Frage nach der karolingischen „Gesetzgebung" aus.
Im Unterschied zu den Edikten der Merowingerzeit enthalten die Kapitularien der
Karolinger normalerweise die Formel, daß der Konsens der Getreuen eingeholt
worden sei. Daraus wurde gewöhnlich der Schluß gezogen, daß der karolingische
Adel bei der „Gesetzgebung" des Königs mitwirkte. Ob dieser Konsens allerdings
nötig oder sogar konstitutiv für die Geltung der Kapitularien war, ist in der For-
schung umstritten. Ähnlich wie im Falle der Leges ist auch an dieser Stelle das
Problem der Geltung schriftlicher Rechtsetzung und des Verhältnisses zur
Rechtswirklichkeit aufgeworfen. Betrachtet man mit der älteren Forschung das
Karolingerreich als einen Beamtenstaat mit königlicher Spitze, dann erscheint die
Konsensformel zunächst als wenig bedeutend. So hat Frangois Louis Ganshof die
Meinung vertreten, daß der Konsens zur Zeit Karls des Großen und am Beginn der
Regierungszeit Ludwigs des Frommen keine Rolle für die Gültigkeit der Kapitula-
rien gespielt habe; die Kapitulariengesetzgebung sei allein Ausfluß der königli-
chen Banngewalt gewesen und die Konsensformel Ausdruck der Selbstverpflich-
tung des Adels. Unter den schwachen Nachfolgern aber habe sich dies nachhaltig
geändert. Die Bedeutung des Konsenses der Großen sei immer wichtiger und
schließlich „eine Quelle für die bindende Kraft der Kapitularien" geworden^.
Mit der Entdeckung der autogenen Adelsrechte und der Vorstellung vom
Recht der Teilhabe am Reich erschien die Konsensformel allerdings in einem neu-
en Licht. Es verwundert kaum, daß insbesondere die deutsche Forschung ihr grö-
ßeres Gewicht zuerkannte. Schon Werner Affeldt meinte, der Konsens sei immer
bedeutend, ja sogar zwingend notwendig gewesen und unter Karl dem Großen
183 Vgl. J. FRIED, Rezension zu REYNOLDS, Fiefs and Vassais, in: German Historical Institute London.
Bulletin 19, Heft 1, 1997, S. 28-41 (m. Replik v. S. REYNOLDS, ebd., Heft 2, S. 30-40). Vgl. jetzt auch
REYNOLDS, Afterthoughts. Zum theoretischen Problem vgl. FRIED, Gens, S. 101. Zur Kritik am Ansatz
vgl. auch St. WHITE, Politics.
184 Vgl. GANSHOF, Kapitularien, S. 52-62. Immerhin gestand Ganshof zu, daß sich äußerlich am
Gebrauch des Wortes nichts geändert hatte (S. 60). Zu den (auch heute noch bestehenden) Unter-
schieden zwischen französischer und deutscher Mediävistik im Hinblick auf die Stellung des Herr-
schers vgl. KAISER, Erbe, S. 87, hier im Hinblick auf Chlodwig.
Kapitel 3
bestanden habe, ohne in der Frühzeit bereits als „System" begriffen oder gar
schriftlich niedergelegt worden zu sein. Man dürfe daher durchaus vom Lehnswe-
sen sprechen, auch wenn dieses erst von den Feudisten späterer Zeiten so genannt
und als System betrachtet worden seiW
3.5. Die Konsensformel der Kapitularien
Das Problem, wie die Stellung des Adels im Karolingerreich beschrieben werden
kann, wirkt sich auch bei der Frage nach der karolingischen „Gesetzgebung" aus.
Im Unterschied zu den Edikten der Merowingerzeit enthalten die Kapitularien der
Karolinger normalerweise die Formel, daß der Konsens der Getreuen eingeholt
worden sei. Daraus wurde gewöhnlich der Schluß gezogen, daß der karolingische
Adel bei der „Gesetzgebung" des Königs mitwirkte. Ob dieser Konsens allerdings
nötig oder sogar konstitutiv für die Geltung der Kapitularien war, ist in der For-
schung umstritten. Ähnlich wie im Falle der Leges ist auch an dieser Stelle das
Problem der Geltung schriftlicher Rechtsetzung und des Verhältnisses zur
Rechtswirklichkeit aufgeworfen. Betrachtet man mit der älteren Forschung das
Karolingerreich als einen Beamtenstaat mit königlicher Spitze, dann erscheint die
Konsensformel zunächst als wenig bedeutend. So hat Frangois Louis Ganshof die
Meinung vertreten, daß der Konsens zur Zeit Karls des Großen und am Beginn der
Regierungszeit Ludwigs des Frommen keine Rolle für die Gültigkeit der Kapitula-
rien gespielt habe; die Kapitulariengesetzgebung sei allein Ausfluß der königli-
chen Banngewalt gewesen und die Konsensformel Ausdruck der Selbstverpflich-
tung des Adels. Unter den schwachen Nachfolgern aber habe sich dies nachhaltig
geändert. Die Bedeutung des Konsenses der Großen sei immer wichtiger und
schließlich „eine Quelle für die bindende Kraft der Kapitularien" geworden^.
Mit der Entdeckung der autogenen Adelsrechte und der Vorstellung vom
Recht der Teilhabe am Reich erschien die Konsensformel allerdings in einem neu-
en Licht. Es verwundert kaum, daß insbesondere die deutsche Forschung ihr grö-
ßeres Gewicht zuerkannte. Schon Werner Affeldt meinte, der Konsens sei immer
bedeutend, ja sogar zwingend notwendig gewesen und unter Karl dem Großen
183 Vgl. J. FRIED, Rezension zu REYNOLDS, Fiefs and Vassais, in: German Historical Institute London.
Bulletin 19, Heft 1, 1997, S. 28-41 (m. Replik v. S. REYNOLDS, ebd., Heft 2, S. 30-40). Vgl. jetzt auch
REYNOLDS, Afterthoughts. Zum theoretischen Problem vgl. FRIED, Gens, S. 101. Zur Kritik am Ansatz
vgl. auch St. WHITE, Politics.
184 Vgl. GANSHOF, Kapitularien, S. 52-62. Immerhin gestand Ganshof zu, daß sich äußerlich am
Gebrauch des Wortes nichts geändert hatte (S. 60). Zu den (auch heute noch bestehenden) Unter-
schieden zwischen französischer und deutscher Mediävistik im Hinblick auf die Stellung des Herr-
schers vgl. KAISER, Erbe, S. 87, hier im Hinblick auf Chlodwig.