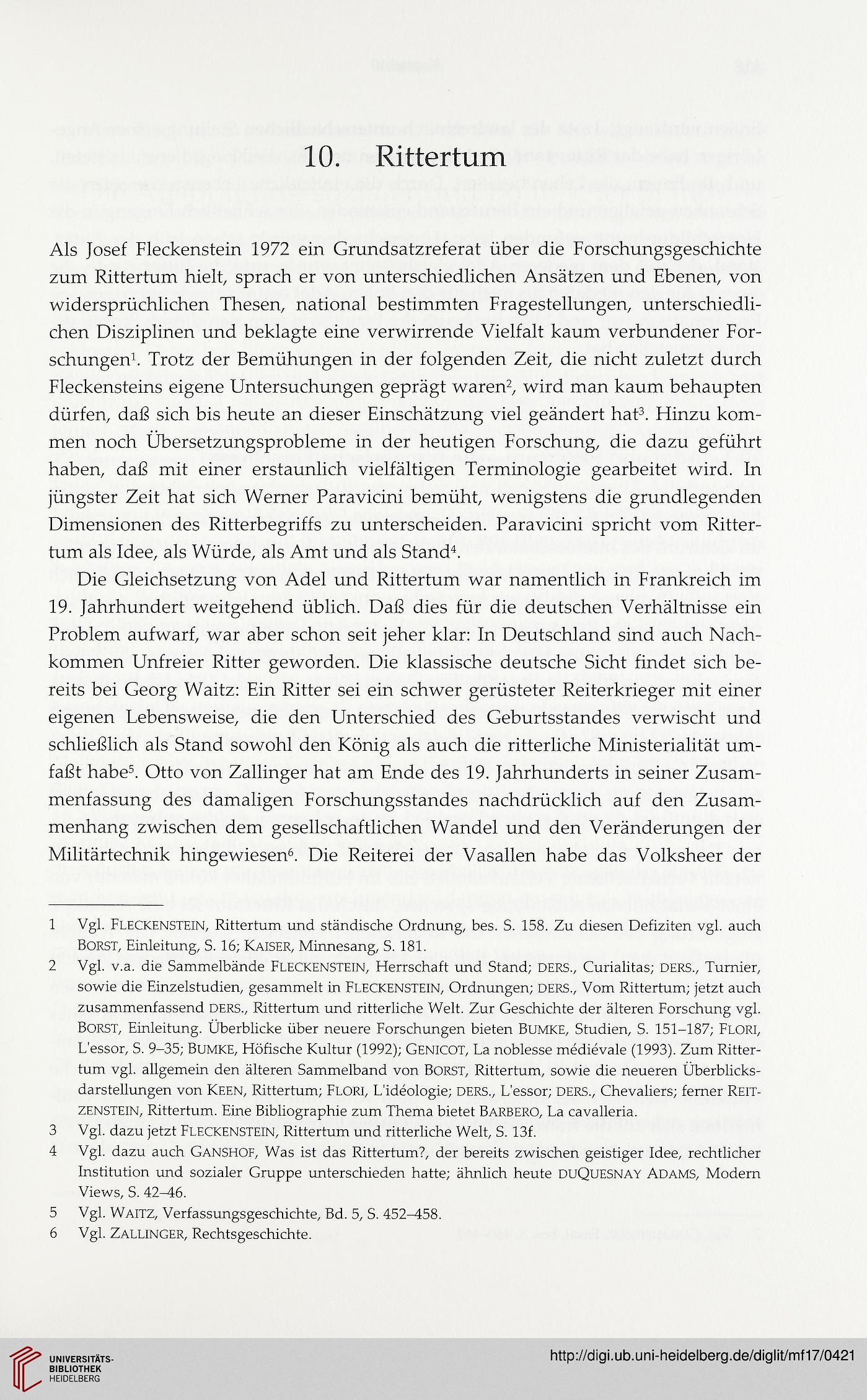10. Rittertum
Als Josef Fleckenstein 1972 ein Grundsatzreferat über die Forschungsgeschichte
zum Rittertum hielt, sprach er von unterschiedlichen Ansätzen und Ebenen, von
widersprüchlichen Thesen, national bestimmten Fragestellungen, unterschiedli-
chen Disziplinen und beklagte eine verwirrende Vielfalt kaum verbundener For-
schungen^. Trotz der Bemühungen in der folgenden Zeit, die nicht zuletzt durch
Fleckensteins eigene Untersuchungen geprägt warerü, wird man kaum behaupten
dürfen, daß sich bis heute an dieser Einschätzung viel geändert hatk Hinzu kom-
men noch Übersetzungsprobleme in der heutigen Forschung, die dazu geführt
haben, daß mit einer erstaunlich vielfältigen Terminologie gearbeitet wird. In
jüngster Zeit hat sich Werner Paravicini bemüht, wenigstens die grundlegenden
Dimensionen des Ritterbegriffs zu unterscheiden. Paravicini spricht vom Ritter-
tum als Idee, als Würde, als Amt und als StancP.
Die Gleichsetzung von Adel und Rittertum war namentlich in Frankreich im
19. Jahrhundert weitgehend üblich. Daß dies für die deutschen Verhältnisse ein
Problem aufwarf, war aber schon seit jeher klar: In Deutschland sind auch Nach-
kommen Unfreier Ritter geworden. Die klassische deutsche Sicht findet sich be-
reits bei Georg Waitz: Ein Ritter sei ein schwer gerüsteter Reiterkrieger mit einer
eigenen Lebensweise, die den Unterschied des Geburtsstandes verwischt und
schließlich als Stand sowohl den König als auch die ritterliche Ministerialität um-
faßt habek Otto von Zallinger hat am Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Zusam-
menfassung des damaligen Forschungsstandes nachdrücklich auf den Zusam-
menhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und den Veränderungen der
Militärtechnik hinge wiesenk Die Reiterei der Vasallen habe das Volksheer der
1 Vgl. FLECKENSTEIN, Rittertum und ständische Ordnung, bes. S. 158. Zu diesen Defiziten vgl. auch
BORST, Einleitung, S. 16; KAISER, Minnesang, S. 181.
2 Vgl. v.a. die Sammelbände FLECKENSTEIN, Herrschaft und Stand; DERS., Curialitas; DERS., Turnier,
sowie die Einzelstudien, gesammelt in FLECKENSTEIN, Ordnungen; DERS., Vom Rittertum; jetzt auch
zusammenfassend DERS., Rittertum und ritterliche Welt. Zur Geschichte der älteren Forschung vgl.
BORST, Einleitung. Überblicke über neuere Forschungen bieten BUMKE, Studien, S. 151-187; FLORI,
L'essor, S. 9-35; BUMKE, Höfische Kultur (1992); GENICOT, La noblesse medievale (1993). Zum Ritter-
tum vgl. allgemein den älteren Sammelband von BORST, Rittertum, sowie die neueren Überblicks-
darstellungen von KEEN, Rittertum; FLORI, L'ideologie; DERS., L'essor; DERS., Chevaliers; ferner REIT-
ZENSTEIN, Rittertum. Eine Bibliographie zum Thema bietet BARBERO, La Cavalleria.
3 Vgl. dazu jetzt FLECKENSTEIN, Rittertum und ritterliche Welt, S. 13f.
4 Vgl. dazu auch GANSHOF, Was ist das Rittertum?, der bereits zwischen geistiger Idee, rechtlicher
Institution und sozialer Gruppe unterschieden hatte; ähnlich heute DUQUESNAY ADAMS, Modem
Views, S. 42-46.
5 Vgl. WAITZ, Verfassungsgeschichte, Bd. 5, S. 452-458.
6 Vgl. ZALLINGER, Rechtsgeschichte.
Als Josef Fleckenstein 1972 ein Grundsatzreferat über die Forschungsgeschichte
zum Rittertum hielt, sprach er von unterschiedlichen Ansätzen und Ebenen, von
widersprüchlichen Thesen, national bestimmten Fragestellungen, unterschiedli-
chen Disziplinen und beklagte eine verwirrende Vielfalt kaum verbundener For-
schungen^. Trotz der Bemühungen in der folgenden Zeit, die nicht zuletzt durch
Fleckensteins eigene Untersuchungen geprägt warerü, wird man kaum behaupten
dürfen, daß sich bis heute an dieser Einschätzung viel geändert hatk Hinzu kom-
men noch Übersetzungsprobleme in der heutigen Forschung, die dazu geführt
haben, daß mit einer erstaunlich vielfältigen Terminologie gearbeitet wird. In
jüngster Zeit hat sich Werner Paravicini bemüht, wenigstens die grundlegenden
Dimensionen des Ritterbegriffs zu unterscheiden. Paravicini spricht vom Ritter-
tum als Idee, als Würde, als Amt und als StancP.
Die Gleichsetzung von Adel und Rittertum war namentlich in Frankreich im
19. Jahrhundert weitgehend üblich. Daß dies für die deutschen Verhältnisse ein
Problem aufwarf, war aber schon seit jeher klar: In Deutschland sind auch Nach-
kommen Unfreier Ritter geworden. Die klassische deutsche Sicht findet sich be-
reits bei Georg Waitz: Ein Ritter sei ein schwer gerüsteter Reiterkrieger mit einer
eigenen Lebensweise, die den Unterschied des Geburtsstandes verwischt und
schließlich als Stand sowohl den König als auch die ritterliche Ministerialität um-
faßt habek Otto von Zallinger hat am Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Zusam-
menfassung des damaligen Forschungsstandes nachdrücklich auf den Zusam-
menhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und den Veränderungen der
Militärtechnik hinge wiesenk Die Reiterei der Vasallen habe das Volksheer der
1 Vgl. FLECKENSTEIN, Rittertum und ständische Ordnung, bes. S. 158. Zu diesen Defiziten vgl. auch
BORST, Einleitung, S. 16; KAISER, Minnesang, S. 181.
2 Vgl. v.a. die Sammelbände FLECKENSTEIN, Herrschaft und Stand; DERS., Curialitas; DERS., Turnier,
sowie die Einzelstudien, gesammelt in FLECKENSTEIN, Ordnungen; DERS., Vom Rittertum; jetzt auch
zusammenfassend DERS., Rittertum und ritterliche Welt. Zur Geschichte der älteren Forschung vgl.
BORST, Einleitung. Überblicke über neuere Forschungen bieten BUMKE, Studien, S. 151-187; FLORI,
L'essor, S. 9-35; BUMKE, Höfische Kultur (1992); GENICOT, La noblesse medievale (1993). Zum Ritter-
tum vgl. allgemein den älteren Sammelband von BORST, Rittertum, sowie die neueren Überblicks-
darstellungen von KEEN, Rittertum; FLORI, L'ideologie; DERS., L'essor; DERS., Chevaliers; ferner REIT-
ZENSTEIN, Rittertum. Eine Bibliographie zum Thema bietet BARBERO, La Cavalleria.
3 Vgl. dazu jetzt FLECKENSTEIN, Rittertum und ritterliche Welt, S. 13f.
4 Vgl. dazu auch GANSHOF, Was ist das Rittertum?, der bereits zwischen geistiger Idee, rechtlicher
Institution und sozialer Gruppe unterschieden hatte; ähnlich heute DUQUESNAY ADAMS, Modem
Views, S. 42-46.
5 Vgl. WAITZ, Verfassungsgeschichte, Bd. 5, S. 452-458.
6 Vgl. ZALLINGER, Rechtsgeschichte.