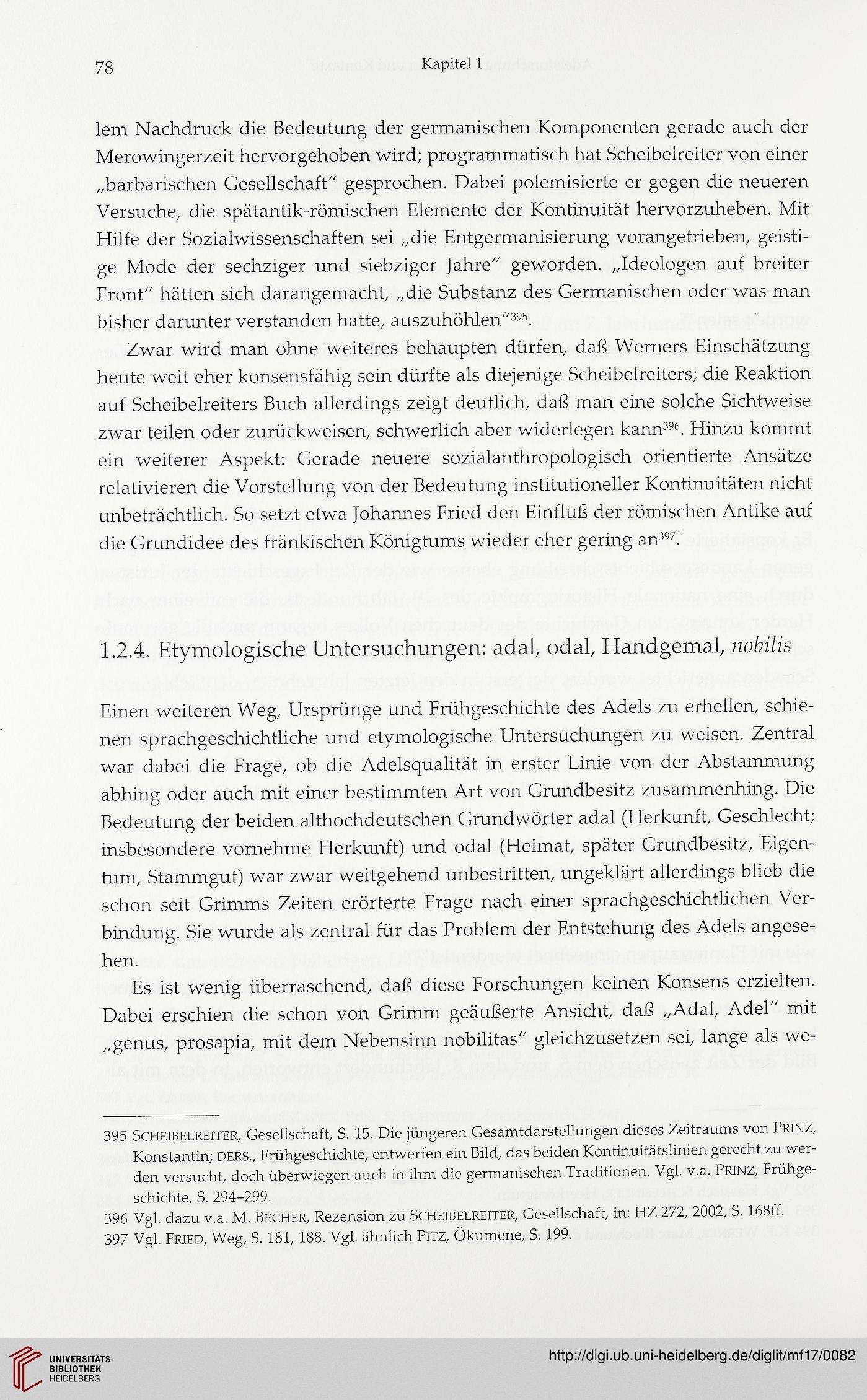78
Kapitel 1
lern Nachdruck die Bedeutung der germanischen Komponenten gerade auch der
Merowingerzeit hervorgehoben wird; programmatisch hat Scheibeireiter von einer
„barbarischen Gesellschaft" gesprochen. Dabei polemisierte er gegen die neueren
Versuche, die spätantik-römischen Elemente der Kontinuität hervorzuheben. Mit
Hilfe der Sozialwissenschaften sei „die Entgermanisierung vorangetrieben, geisti-
ge Mode der sechziger und siebziger Jahre" geworden. „Ideologen auf breiter
Front" hätten sich darangemacht, „die Substanz des Germanischen oder was man
bisher darunter verstanden hatte, auszuhöhlen"^.
Zwar wird man ohne weiteres behaupten dürfen, daß Werners Einschätzung
heute weit eher konsensfähig sein dürfte als diejenige Scheibeireiters; die Reaktion
auf Scheibeireiters Buch allerdings zeigt deutlich, daß man eine solche Sichtweise
zwar teilen oder zurückweisen, schwerlich aber widerlegen kaniWL Hinzu kommt
ein weiterer Aspekt: Gerade neuere sozialanthropologisch orientierte Ansätze
relativieren die Vorstellung von der Bedeutung institutioneller Kontinuitäten nicht
unbeträchtlich. So setzt etwa Johannes Fried den Einfluß der römischen Antike auf
die Grundidee des fränkischen Königtums wieder eher gering ardV
1.2.4. Etymologische Untersuchungen: adal, odal, Handgemal, noh'hs
Einen weiteren Weg, Ursprünge und Frühgeschichte des Adels zu erhellen, schie-
nen sprachgeschichtliche und etymologische Untersuchungen zu weisen. Zentral
war dabei die Frage, ob die Adelsqualität in erster Linie von der Abstammung
abhing oder auch mit einer bestimmten Art von Grundbesitz zusammenhing. Die
Bedeutung der beiden althochdeutschen Grundwörter adal (Herkunft, Geschlecht;
insbesondere vornehme Herkunft) und odal (Heimat, später Grundbesitz, Eigen-
tum, Stammgut) war zwar weitgehend unbestritten, ungeklärt allerdings blieb die
schon seit Grimms Zeiten erörterte Frage nach einer sprachgeschichtlichen Ver-
bindung. Sie wurde als zentral für das Problem der Entstehung des Adels angese-
hen.
Es ist wenig überraschend, daß diese Forschungen keinen Konsens erzielten.
Dabei erschien die schon von Grimm geäußerte Ansicht, daß „Adal, Adel" mit
„genus, prosapia, mit dem Nebensinn nobilitas" gleichzusetzen sei, lange als we-
395 SCHEIBELREITER, Gesellschaft, S. 15. Die jüngeren Gesamtdarstellungen dieses Zeitraums von PRINZ,
Konstantin; DERS., Frühgeschichte, entwerfen ein Bild, das beiden Kontinuitätslinien gerecht zu wer-
den versucht, doch überwiegen auch in ihm die germanischen Traditionen. Vgl. v.a. PRINZ, Frühge-
schichte, S. 294-299.
396 Vgl. dazu v.a. M. BECHER, Rezension zu SCHEIBELREITER, Gesellschaft, in: HZ 272, 2002, S. 168ff.
397 Vgl. FRIED, Weg, S. 181, 188. Vgl. ähnlich PlTZ, Ökumene, S. 199.
Kapitel 1
lern Nachdruck die Bedeutung der germanischen Komponenten gerade auch der
Merowingerzeit hervorgehoben wird; programmatisch hat Scheibeireiter von einer
„barbarischen Gesellschaft" gesprochen. Dabei polemisierte er gegen die neueren
Versuche, die spätantik-römischen Elemente der Kontinuität hervorzuheben. Mit
Hilfe der Sozialwissenschaften sei „die Entgermanisierung vorangetrieben, geisti-
ge Mode der sechziger und siebziger Jahre" geworden. „Ideologen auf breiter
Front" hätten sich darangemacht, „die Substanz des Germanischen oder was man
bisher darunter verstanden hatte, auszuhöhlen"^.
Zwar wird man ohne weiteres behaupten dürfen, daß Werners Einschätzung
heute weit eher konsensfähig sein dürfte als diejenige Scheibeireiters; die Reaktion
auf Scheibeireiters Buch allerdings zeigt deutlich, daß man eine solche Sichtweise
zwar teilen oder zurückweisen, schwerlich aber widerlegen kaniWL Hinzu kommt
ein weiterer Aspekt: Gerade neuere sozialanthropologisch orientierte Ansätze
relativieren die Vorstellung von der Bedeutung institutioneller Kontinuitäten nicht
unbeträchtlich. So setzt etwa Johannes Fried den Einfluß der römischen Antike auf
die Grundidee des fränkischen Königtums wieder eher gering ardV
1.2.4. Etymologische Untersuchungen: adal, odal, Handgemal, noh'hs
Einen weiteren Weg, Ursprünge und Frühgeschichte des Adels zu erhellen, schie-
nen sprachgeschichtliche und etymologische Untersuchungen zu weisen. Zentral
war dabei die Frage, ob die Adelsqualität in erster Linie von der Abstammung
abhing oder auch mit einer bestimmten Art von Grundbesitz zusammenhing. Die
Bedeutung der beiden althochdeutschen Grundwörter adal (Herkunft, Geschlecht;
insbesondere vornehme Herkunft) und odal (Heimat, später Grundbesitz, Eigen-
tum, Stammgut) war zwar weitgehend unbestritten, ungeklärt allerdings blieb die
schon seit Grimms Zeiten erörterte Frage nach einer sprachgeschichtlichen Ver-
bindung. Sie wurde als zentral für das Problem der Entstehung des Adels angese-
hen.
Es ist wenig überraschend, daß diese Forschungen keinen Konsens erzielten.
Dabei erschien die schon von Grimm geäußerte Ansicht, daß „Adal, Adel" mit
„genus, prosapia, mit dem Nebensinn nobilitas" gleichzusetzen sei, lange als we-
395 SCHEIBELREITER, Gesellschaft, S. 15. Die jüngeren Gesamtdarstellungen dieses Zeitraums von PRINZ,
Konstantin; DERS., Frühgeschichte, entwerfen ein Bild, das beiden Kontinuitätslinien gerecht zu wer-
den versucht, doch überwiegen auch in ihm die germanischen Traditionen. Vgl. v.a. PRINZ, Frühge-
schichte, S. 294-299.
396 Vgl. dazu v.a. M. BECHER, Rezension zu SCHEIBELREITER, Gesellschaft, in: HZ 272, 2002, S. 168ff.
397 Vgl. FRIED, Weg, S. 181, 188. Vgl. ähnlich PlTZ, Ökumene, S. 199.